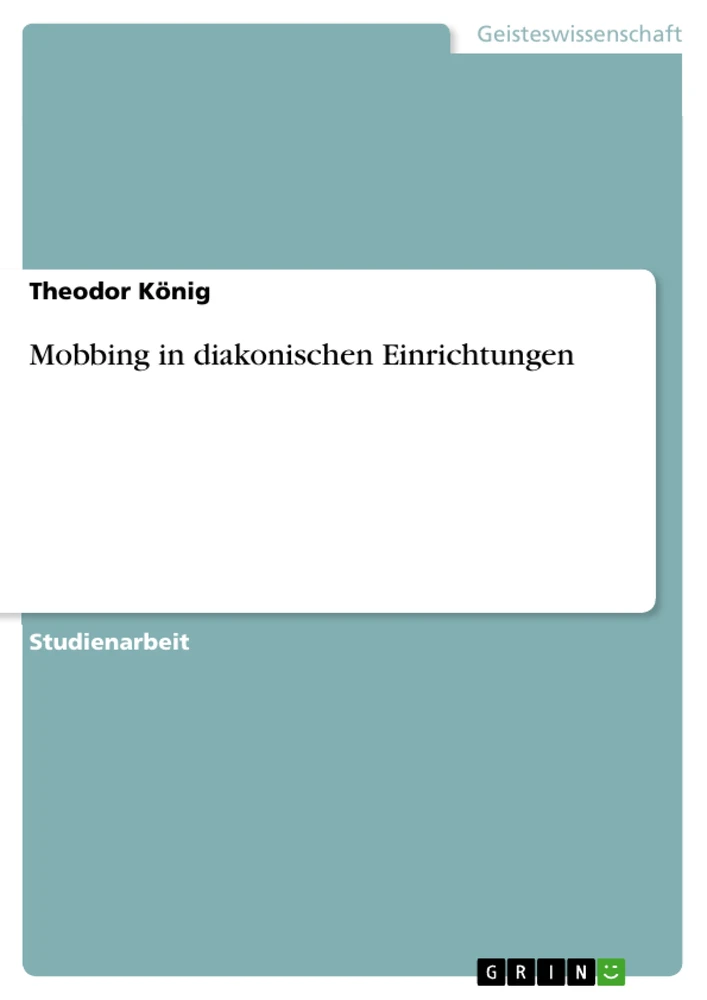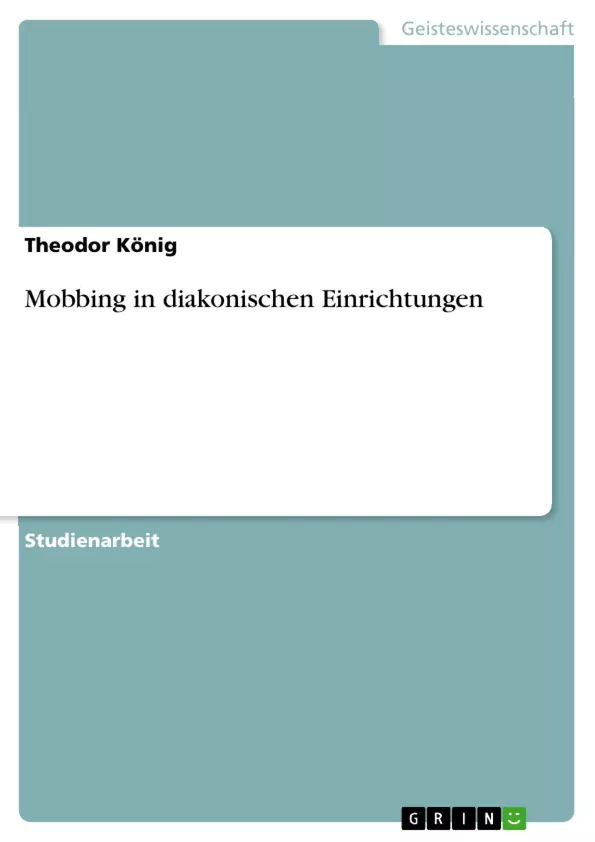In dieser Arbeit geht es um Erscheinungsformen und Inhalte des Mobbings in diakonischen Einrichtungen. Zentral ist dabei die Fragestellung, wie diakonische Einrichtungen Mobbing entgegenwirken können. Hier wird zum einen auf allgemeine Strategien der Organisation eingegangen, zum anderen wird aber auch auf Führungsverhalten Bezug genommen, mit dem auf Mobbing reagiert wird und durch das Mobbing erschwert wird.
Die soziale Arbeit in diakonischen Einrichtungen wird in der Öffentlichkeit vielfach als engagiert umgesetzte Arbeit für kranke, arme, sozial benachteiligte oder schwache Menschen der Kirche wahrgenommen, obwohl diese Einrichtungen vielfach ein problematisches und spannungsgeladenes Verhältnis zur Kirche haben. Insgesamt gehören zur Diakonie aktuell ca. 27.000 verschiedene Einrichtungen, bei denen 450000 hauptamtliche und 400000 ehrenamtliche Mitarbeiter arbeiten. Damit ist die Diakonie als Zusammenschluss dieser Einrichtungen einer der größten Arbeitgeber in Deutschland. Problematisch für das Arbeitsklima und die Wirksamkeit der sozialen Arbeit diakonischer Einrichtungen sind dabei Mobbinghandlungen, die weitreichende Konsequenzen für die Arbeit in der Diakonie haben. Das Arbeitsklima in einer diakonischen Einrichtung ist äußerst wichtige für die Qualität des Arbeitsplatzes und die soziale Arbeit. Mobbinghandlungen können eklatante Auswirkungen sowohl auf die Mitarbeiter als auch auf das Betriebsklima haben. Ein aus dem Mobbing resultierendes schlechtes Arbeitsklima kann zu einem vermehrten Ausfall der Mitarbeiter führen. Dies kann einen wirtschaftlichen Schaden für das Unternehmen mit sich bringen. Für Einrichtungen der Diakonie ergeben sich daher Herausforderungen, Mobbing und den Auswirkungen des Mobbings zu begegnen und auf diese mit dem Führungsverhalten der Vorgesetzten zu reagieren und Strategien und Handlungsmöglichkeiten gegen das Mobbing zu entwickeln.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Theoretische Grundlagen
- 2.1 Definition des Begriffs ‚Mobbing‘
- 2.2 Arten und Verläufe von Mobbing
- 2.2.1 Arten von Mobbing
- 2.2.2 Verlauf von Mobbingprozessen
- 2.3 Auswirkungen des Mobbings
- 2.3.1 Auswirkungen beim einzelnen Mitarbeiter
- 2.3.2 Auswirkungen am Arbeitsplatz
- 3 Mobbing bei diakonischen Trägern
- 3.1 Hintergründe und Ursachen des Mobbings
- 3.2 Strategien gegen Mobbing und ihre Wirksamkeit
- 3.2.1 Mobbing zum unerwünschten Fehlverhalten erklären
- 3.2.2 Teamfähigkeit und Konfliktfähigkeit erlernen
- 3.2.3 Gestaltungsbereich Führung: Wertschätzung und Anerkennung.
- 3.3 Mobbing und das Verhalten von Führungskräften
- 4 Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung & Themen
Diese Arbeit widmet sich den Erscheinungsformen und Inhalten des Mobbings, insbesondere in diakonischen Einrichtungen. Das primäre Ziel ist es, die zentrale Fragestellung zu beantworten, wie diakonische Einrichtungen Mobbing effektiv entgegenwirken können, um das Arbeitsklima und die Qualität der sozialen Arbeit zu verbessern.
- Definition und verschiedene Erscheinungsformen von Mobbing.
- Auswirkungen von Mobbing auf individuelle Mitarbeiter und das gesamte Arbeitsklima.
- Spezifische Hintergründe und Ursachen von Mobbing in diakonischen Kontexten.
- Entwicklung und Implementierung allgemeiner organisationaler Strategien gegen Mobbing.
- Die entscheidende Rolle von Führungskräften im Umgang mit Mobbing und dessen Prävention.
- Maßnahmen zur Förderung von Teamfähigkeit, Konfliktlösung und Wertschätzung am Arbeitsplatz.
Auszug aus dem Buch
2.1 Definition des Begriffs ‚Mobbing‘
Der Begriff „Mobbing“ leitet sich von dem englischen Verb „to mob“ ab. Im Englischen bedeutet es angreifen, anpöbeln, jemanden umringen oder be- drängen.2 In Anlehnung an Wolmerath und Esser werden mit Mobbing Vor- gänge im Berufsleben bezeichnet, die durch argwillige Handlungen gegen- über anderen Mitarbeitern gekennzeichnet werden. Diese Handlungen finden regelmäßig statt und verfestigen sich über eine längere Zeit. 3 Leymann spe- zifiziert diese Handlungen als „negative kommunikative Handlungen, die ge- gen eine Person gerichtet sind (von einer oder mehreren anderen) und die sehr oft und über einen längeren Zeitraum hinaus vorkommen und damit die Beziehung zwischen Täter und Opfer kennzeichnen“4. Im Gegensatz zu Wolmerath und Esser konkretisiert Leymann seine Definition des Begriffes Mobbing und zählt insgesamt 45 verschiedene Handlungstypen auf, die bei Mobbing vorkommen können. Des Weiteren heißt es, dass diese Handlun- gen mindestens über einen Zeitraum von sechs Monaten einmal pro Woche vorkommen müssen. Erst dann kann man nach Leymann von Mobbing spre- chen.5 Ähnlich definiert auch das Bundesarbeitsgericht Mobbing als: „[...] fortgesetzte, aufeinander aufbauende oder ineinander übergreifende, der Anfeindung, Schikane oder Diskriminierung dienende Verhaltensweisen, die nach Art und Ablauf im Regelfall eine Übergeordneten, von der Rechtsord- nung nicht gedeckten Zielsetzung förderlich sind und jedenfalls in ihrer Ge- samtheit das allgemeine Persönlichkeitsrecht oder andere ebenso geschütz- te Rechte, wie die Ehre oder Gesundheit des Betroffenen verletzen“.6 Die dargelegten Definitionen zeigen den grundlegenden Unterschied zwi- schen den Begriffen „Mobbing“ und „Konflikt“. Im Gegensatz zu zwischen- menschlichen Konflikten handelt es sich bei Mobbing um beabsichtigte, an- dauernde und wiederkehrende Attacken, Ungerechtigkeiten und Rechtswid- rigkeiten, in denen es stets einen Beteiligten gibt, der die Opferrolle ein- nimmt. Mobbing impliziert, dass die gegen einen Mitarbeiter gerichteten Handlungen von diesem als unangemessen empfunden werden und inner- halb eines langen Zeitraums in hoher Intensität stattfinden. Dabei fühlt sich der Handlungsempfänger unterlegen und leidet evtl. bereits unter gesund- heitlichen Beeinträchtigungen.7 Mobbing zielt auf die Kränkung, Entwertung, Isolierung und Ausstoßung anderer, um sich eigene Vorteile zu verschaffen.8
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Dieses Kapitel stellt die Relevanz des Themas Mobbing in diakonischen Einrichtungen dar, beleuchtet dessen weitreichende Auswirkungen auf Arbeitsklima und Mitarbeiter und formuliert die zentrale Forschungsfrage zur Mobbingprävention.
Theoretische Grundlagen: Hier wird der Begriff Mobbing detailliert definiert, von bloßen Konflikten abgegrenzt, und es werden verschiedene Arten sowie die typischen Phasen von Mobbingprozessen erläutert. Zudem werden die gravierenden physischen und psychischen Auswirkungen auf einzelne Mitarbeiter und das gesamte Arbeitsumfeld dargelegt.
Mobbing bei diakonischen Trägern: Dieses Kapitel widmet sich den spezifischen Hintergründen und Ursachen des Mobbings in diakonischen Einrichtungen. Es werden organisatorische Strategien und die entscheidende Rolle von Führungskräften bei der Prävention und Bekämpfung von Mobbing untersucht.
Fazit: Das Fazit fasst die schwerwiegenden Konsequenzen von Mobbing für das Arbeitsklima und das Wohlbefinden der Mitarbeiter zusammen. Es betont die besonderen Herausforderungen in diakonischen Einrichtungen und hebt die Notwendigkeit klarer Präventionsstrukturen und eines verantwortungsvollen Führungsverhaltens hervor.
Schlüsselwörter
Mobbing, Diakonie, Arbeitsplatz, Konfliktmanagement, Führungskräfte, Arbeitsklima, Prävention, psychische Folgen, soziale Arbeit, Teamfähigkeit, Stress, Anerkennung, Fürsorgepflicht, Organisation, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Arbeit grundsätzlich?
Die Arbeit befasst sich grundsätzlich mit dem Phänomen Mobbing am Arbeitsplatz, insbesondere innerhalb diakonischer Einrichtungen, und analysiert dessen Erscheinungsformen, Auswirkungen sowie wirksame Strategien zu dessen Prävention und Bekämpfung.
Was sind die zentralen Themenfelder?
Zentrale Themenfelder umfassen die Definition und Typologie des Mobbings, dessen weitreichende Folgen für Individuen und das Betriebsklima, die spezifischen Rahmenbedingungen des Mobbings in der Diakonie sowie organisatorische und führungstechnische Gegenstrategien.
Was ist das primäre Ziel oder die Forschungsfrage?
Das primäre Ziel ist es, die Erscheinungsformen und Inhalte des Mobbings in diakonischen Einrichtungen zu analysieren und die Forschungsfrage zu beantworten, wie diese Einrichtungen Mobbing wirkungsvoll begegnen und entgegenwirken können.
Welche wissenschaftliche Methode wird verwendet?
Die Arbeit basiert auf einer theoretischen Analyse und der Synthese bestehender Fachliteratur und empirischer Erkenntnisse, um die komplexen Zusammenhänge des Mobbings zu beleuchten und Handlungsempfehlungen für diakonische Träger abzuleiten.
Was wird im Hauptteil behandelt?
Der Hauptteil behandelt die theoretischen Grundlagen des Begriffs Mobbing, seine verschiedenen Arten und Verlaufsformen, die Auswirkungen auf den einzelnen Mitarbeiter und den Arbeitsplatz sowie die besonderen Herausforderungen und Lösungsansätze für Mobbing in diakonischen Organisationen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Die Arbeit wird charakterisiert durch Schlüsselwörter wie Mobbing, Diakonie, Arbeitsplatz, Konfliktmanagement, Führungskräfte, Arbeitsklima, Prävention, psychische Folgen, soziale Arbeit, Teamfähigkeit, Stress, Anerkennung, Fürsorgepflicht, Organisation und Deutschland.
Warum ist Mobbing in diakonischen Einrichtungen ein besonderes Problem?
Mobbing ist in diakonischen Einrichtungen ein besonderes Problem, da die soziale Arbeit oft mit hohen emotionalen und körperlichen Belastungen verbunden ist, verschiedene Qualifikationen und Hierarchien aufeinandertreffen und auch der Einsatz von günstigen Arbeitskräften wie Ein-Euro-Jobbern zu Frustration und Spannungen führen kann.
Welche Phasen des Mobbingverlaufs nach Leymann werden beschrieben?
Nach Leymann durchläuft ein Mobbingprozess typischerweise fünf Phasen: Konflikte in der Organisation, Mobbing und Psychoterror, Rechtsbrüche durch die Personalverwaltung, ärztliche und therapeutische Fehldiagnosen und schließlich den Ausschluss aus der Arbeitswelt.
Welche Rolle spielt das Führungsverhalten bei der Prävention von Mobbing?
Das Führungsverhalten ist entscheidend für die Prävention von Mobbing, da Führungskräfte Mobbing frühzeitig erkennen, klar kommunizieren, dass Mobbing nicht toleriert wird, und durch Wertschätzung sowie Anerkennung ein positives Arbeitsklima fördern können.
Welche konkreten Strategien können diakonische Träger gegen Mobbing einsetzen?
Diakonische Träger können Mobbing zum unerwünschten Fehlverhalten erklären, Team- und Konfliktfähigkeit der Mitarbeiter fördern, Führungskräfte sensibilisieren und qualifizieren, Mobbing-Arbeitskreise einrichten und klare Verfahrenswege sowie Ansprechpartner etablieren.
- Quote paper
- Theodor König (Author), 2016, Mobbing in diakonischen Einrichtungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1597057