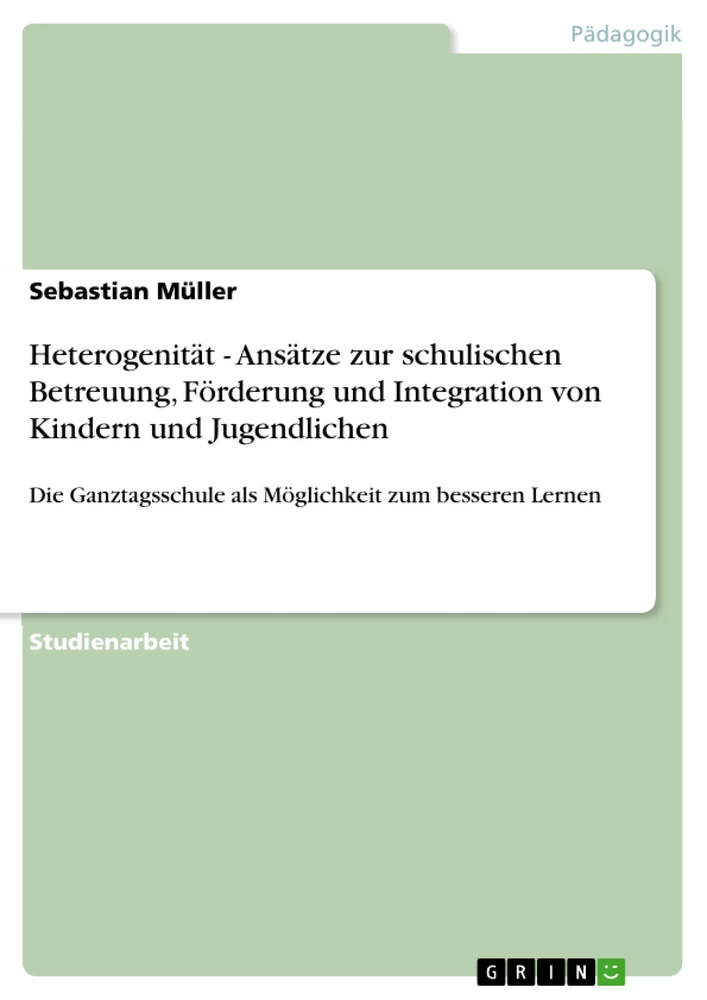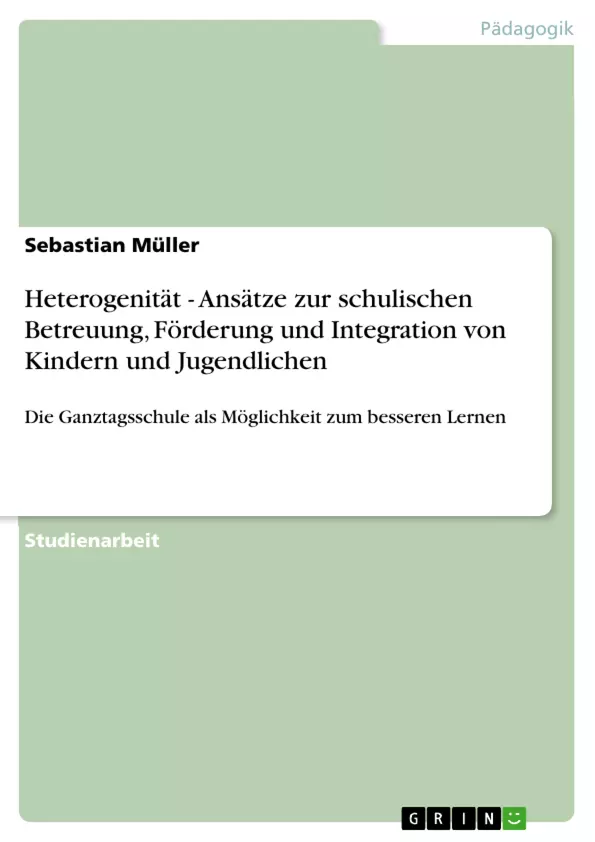Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema: „Heterogenität- Ansätze zur schulischen Betreuung, Förderung und Integration von Kindern und Jugendlichen -besser Lernen durch die
Ganztagsschule!?“.
Im Interesse der Arbeit liegt es, den Leser in das Thema der Heterogenität in Schule und Unterricht einzuführen, um dann zu untersuchen wie wichtig eine Umgestaltung des deutschen Schulwesens in Bezug auf den Unterricht ist. Es soll an Beispielen aus dem Ganztagsschulbetrieb gezeigt werden wie Betreuung, Förderung und Integration besser vereinbart werden können und welche
Möglichkeiten die Ganztagsschule dabei bieten kann.
Das Thema Heterogenität hat nicht erst seit PISA Eingang in die schulpädagogische und bildungspolitische Diskussion gefunden. Forderungen nach einem produktiven Umgang mit Vielfalt
stehen derzeit im Mittelpunkt zahlreicher schulpädagogischer Veröffentlichungen. Oftmals hört man Schlagworte wie individuelle Förderung, neue Lernkultur, Flexibilisierung und Chancengleichheit. Die Verschiedenheit von Schülerinnen und Schülern wird dabei häufig als unterrichtspraktisches Problem betrachtet, auf das die Lehrer mit einem breiteren Methodenrepertoire reagieren müssten.
Mit diesem komplexen Problem wird sich die Arbeit beschäftigen. Sie soll zeigen wie wichtig die Schule (Ganztagsschule) als Lernwelt für die Kinder und Jugendlichen ist um in der späteren Gesellschaft zu bestehen. Lernende und Lehrende aller Schulstufen erleben alltäglich wie sehr Kinder und Jugendliche sich unterscheiden. Das Schulsystem muss mit dieser Vielfalt umgehen können und sie zum Vorteil der Schüler ausbauen. Leider ist dies noch der Ausnahmefall an
deutschen Schulen. Homogenität, daher Einheitlichkeit von Schülern und dessen Lerngeschwindigkeit, werden als unabdingbare Voraussetzung angesehen und Heterogenität hingegen als Lernhindernis und Belastung. Die Unterschiedlichkeit muss jedoch als wesentliches Konstrukt pädagogischer Praxis angesehen werden. Die Politik stellt daher neue Ansprüche an die Schule. Es wird ein produktiver Umgang mit Heterogenität, die Weiterentwicklung von Unterricht und Maßnahmen zu einer individuellen Förderung und zugleich Erneuerung der Schulstruktur gefordert. Die Arbeit versucht zu klären inwieweit die geforderten Maßnahmen überhaupt erforderlich sind und will untersuchen ob die Ganztagsschule hier einen Lösungsansatz bieten kann und wodurch dies sichergestellt wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Heterogenität an Deutschen Schulen
- Schule und Gesellschaft im Wechselspiel
- Das Deutsche Schulsystem- Vielfalt und Relevanz für die schulische Bildung
- Die Ganztagsschule als Ansatz für Integration und gleichzeitige Förderung aller Schüler
- Theoretische Vorbetrachtungen
- Begriffliche Einordnung
- Begründungen für die Ganztagsschule- Vorteile
- Begründungen gegen die Ganztagsschule- Nachteile
- Was leisten Ganztagsschulen?- Strukturelemente und Tagesablauf
- Ganztagsschule aus Sicht der Schüler
- Situation in Deutschland
- Theoretische Vorbetrachtungen
- Zusammenfassung/Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Heterogenität in Schule und Unterricht und analysiert die Bedeutung einer Umgestaltung des deutschen Schulwesens im Hinblick auf die Unterrichtsgestaltung. Am Beispiel der Ganztagsschule werden die Möglichkeiten zur besseren Vereinbarkeit von Betreuung, Förderung und Integration untersucht. Die Arbeit beleuchtet die Relevanz der Ganztagsschule als Lernwelt für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, die im späteren Leben in einer vielfältigen Gesellschaft bestehen müssen.
- Heterogenität als Herausforderung für das deutsche Schulsystem
- Bedeutung individueller Förderung und neuer Lernkulturen
- Die Ganztagsschule als Lösungsansatz für die Herausforderungen der Heterogenität
- Chancen und Risiken der Ganztagsschule
- Aktuelle Entwicklungen im deutschen Schulsystem
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt das Thema Heterogenität in Schule und Unterricht vor und führt die Bedeutung der Umgestaltung des deutschen Schulwesens im Kontext des Unterrichts ein.
- Kapitel 1 befasst sich mit dem Wechselspiel von Schule und Gesellschaft und beleuchtet die Bedeutung des deutschen Schulsystems im Kontext der Heterogenität.
- Kapitel 2 untersucht die Ganztagsschule als Ansatz zur Integration und gleichzeitigen Förderung aller Schüler. Dieses Kapitel beinhaltet theoretische Vorbetrachtungen mit einer begrifflichen Einordnung, die Vorteile und Nachteile der Ganztagsschule sowie die Strukturelemente und den Tagesablauf.
- Kapitel 2 beleuchtet außerdem die Perspektive der Schüler auf die Ganztagsschule und die aktuelle Situation in Deutschland.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Heterogenität, Ganztagsschule, Bildungssystem, individuelle Förderung, Integration, Chancengleichheit, Lernkultur und Schulentwicklung. Der Fokus liegt auf dem deutschen Schulsystem, insbesondere auf der Rolle der Ganztagsschule in der Bewältigung der Herausforderungen der Heterogenität.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Heterogenität im Schulkontext?
Heterogenität bezieht sich auf die Vielfalt der Schüler hinsichtlich ihrer Herkunft, Lernvoraussetzungen und individuellen Fähigkeiten.
Wie kann die Ganztagsschule bei Heterogenität helfen?
Sie bietet mehr Zeit für individuelle Förderung, soziale Integration und eine bessere Vereinbarkeit von Betreuung und Bildung.
Was sind die Nachteile der Ganztagsschule?
Die Arbeit diskutiert auch kritische Aspekte wie die mögliche Überforderung der Schüler durch einen langen Schultag und organisatorische Hürden.
Warum ist individuelle Förderung heute so wichtig?
Da Lerngruppen immer vielfältiger werden, reicht Frontalunterricht oft nicht mehr aus; neue Lernkulturen müssen auf die Bedürfnisse jedes Einzelnen eingehen.
Wie beurteilen Schüler selbst die Ganztagsschule?
Ein Kapitel der Arbeit befasst sich explizit mit der Sichtweise der Kinder und Jugendlichen auf den strukturierten Ganztagsbetrieb.
- Quote paper
- MA Sebastian Müller (Author), 2008, Heterogenität - Ansätze zur schulischen Betreuung, Förderung und Integration von Kindern und Jugendlichen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/159706