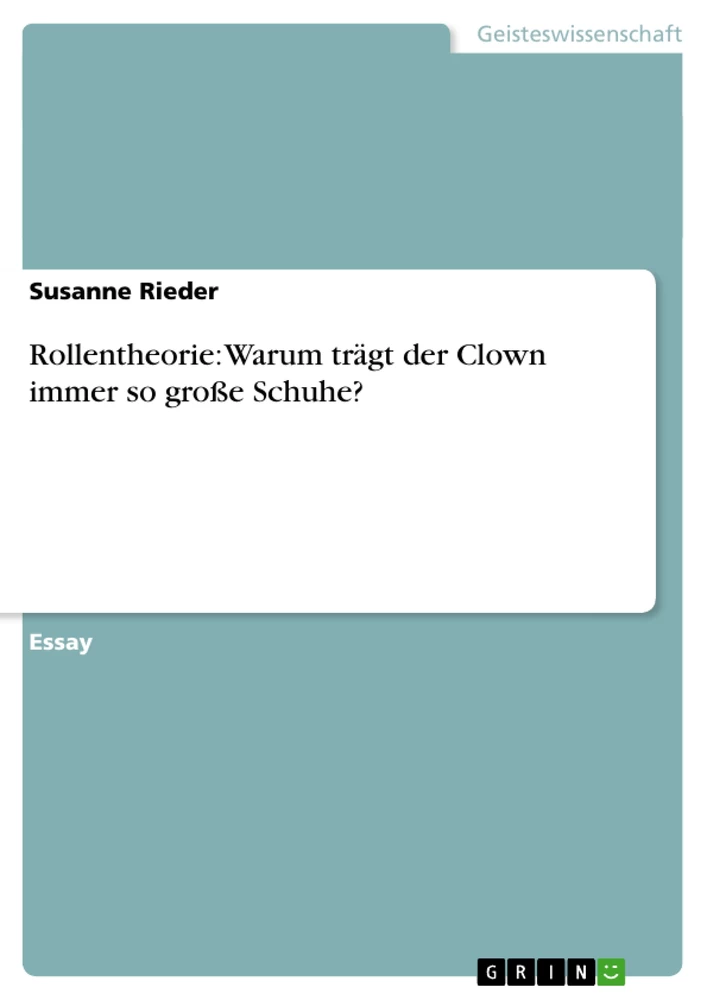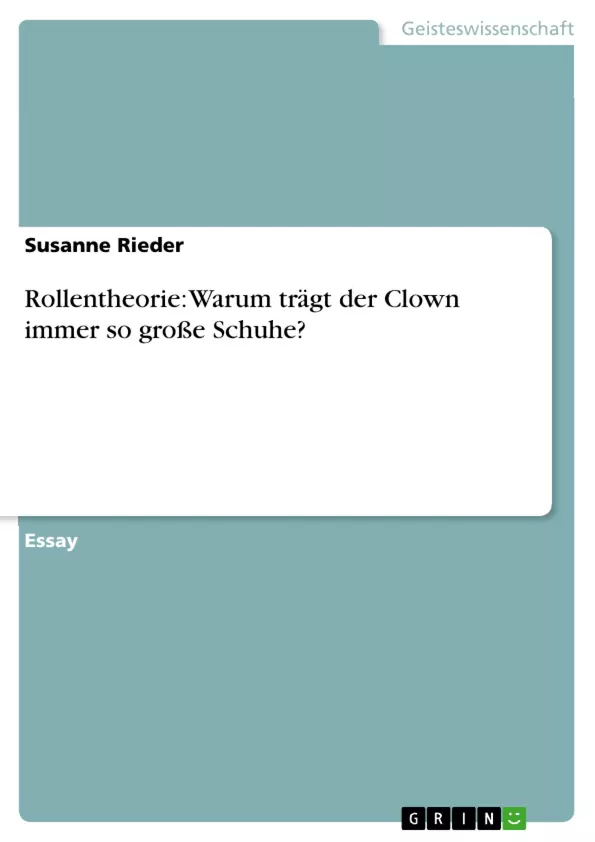Wenn uns ein unbekannter Gast auf einer Party vorgestellt wird, dann erfahren wir meist etwas über Name, Alter, Beruf, Familienstand und eventuell noch über die Hobbys des Fremden. Dann haben wir das Gefühl, er wäre uns doch nicht mehr so fremd. Wie kommt das? Es gibt viele Menschen, die gleiche Merkmale in Beruf, Alter und so weiter aufweisen. Trotzdem glauben wir einen Fremden aufgrund weniger Aussagen, wenn auch nur flüchtig, zu kennen. Sind das nur vorschnelle Bilder, die wir uns zusammen reimen oder kann man wirklich einen Fremden anhand weniger Aussagen grob charakterisieren? Wenn das der Fall ist, woher hat dann ein Mensch diese Fähigkeit? Man könnte meinen, derartige Einschätzungen wären oberflächlich und würden das einzigartige Individuum vernachlässigen. Aber sind es nicht gerade diese Vereinfachungen, die uns das Leben im Alltag überhaupt ermöglichen? Indem wir ein bestimmtes System in die vielen Menschen bringen, die uns jeden Tag begegnen, erl eichtern wir uns das Zusammenleben.
Ich habe mich als Kind immer gefragt, warum der Clown ständig so große Schuhe trägt. Ich meine damit nicht den Clown, sondern generell alle Clowns. Ich habe in meinem Leben so viele verschiedene Clowns gesehen: Die einen waren groß, die anderen klein, die nächsten waren dick, andere wiederum sehr schlank. Aber eins hatten sie alle gemeinsam: Sie trugen immer riesige Schuhe. Ist diese Art der Kleidung gewollt und können wir sie somit als „typisches Merkmal eines Clowns“ bezeichnen? Oder war das nur Zufall, denn für mich als einzelne ist es wohl kaum möglich, alle Clowns der Welt zu sehen zu bekommen? Diesen und ähnlichen Fragen möchte ich nun in meiner Arbeit zur Rollentheorie nachgehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Die soziale Rolle
- 1.1. Erwartungen an den Rollenträger
- 1.1.1. Muss-/Soll- und Kann-Erwartungen
- 1.1.2. Shakespeare - ein historisches Beispiel
- 1.2. Rechte und Pflichten der sozialen Rolle
- 1.1. Erwartungen an den Rollenträger
- 2. Der Rollenkonflikt
- 3. Die soziale Position
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rollentheorie anhand des Beispiels des Clowns und seiner auffälligen großen Schuhe. Ziel ist es, die Bedeutung sozialer Rollen für das menschliche Verhalten und die soziale Interaktion zu verdeutlichen. Die Arbeit beleuchtet die Mechanismen, die hinter der scheinbar einfachen Charakterisierung von Menschen anhand weniger Merkmale stecken.
- Soziale Rollen als Richtlinien des menschlichen Verhaltens
- Rollenerwartungen und deren gesellschaftliche Bedingtheit
- Rollenkonflikte und die Balance zwischen Individualität und gesellschaftlicher Anerkennung
- Der Prozess der Sozialisierung und Verinnerlichung von Rollen
- Die Rolle als Vereinfachung der sozialen Wirklichkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein, indem sie die alltägliche Beobachtung der schnellen Einordnung von Menschen anhand weniger Informationen beleuchtet. Sie stellt die Frage nach der Fähigkeit des Menschen zu solchen Vereinfachungen und ihrer Bedeutung für das soziale Zusammenleben. Der Clown und seine großen Schuhe dienen als anschauliches Beispiel für die Rolle und ihre sichtbaren Merkmale. Die Arbeit kündigt die Auseinandersetzung mit der Rollentheorie an.
1. Die soziale Rolle: Dieses Kapitel definiert den Begriff der sozialen Rolle als Richtlinien des menschlichen Verhaltens und Sicherheitssystem für Interaktionen. Es betont, dass Menschen mehrere Rollen verkörpern und dass es keine festen Gesetze für das Rollenverhalten gibt. Die soziale Rolle wird als Verbindung zwischen Individuum und Gesellschaft beschrieben, dient der Analyse menschlichen Handelns und stellt eine wissenschaftliche Vereinfachung der Realität dar.
1.1. Erwartungen an den Rollenträger: Dieses Kapitel befasst sich mit den Erwartungen, die die Gesellschaft an einen Rollenträger stellt. Diese Erwartungen sind sozial und zeitlich bedingt, wie am Beispiel der Rolle der Frau im Wandel der Zeit gezeigt wird. Die Arbeit diskutiert die individuelle Entscheidung des Rollenträgers, den Erwartungen zu entsprechen oder sie abzulehnen, und die damit verbundenen Sanktionen. Sozialisierung und Verinnerlichung werden als Lernprozesse für das Rollenverhalten dargestellt. Die Existenz rollenloser Personen wird als soziologisch unwahrscheinlich betrachtet.
2. Der Rollenkonflikt: (Kapitel fehlt im Originaltext - Eine Zusammenfassung kann hier nicht erstellt werden.)
3. Die soziale Position: (Kapitel fehlt im Originaltext - Eine Zusammenfassung kann hier nicht erstellt werden.)
Schlüsselwörter
Rollentheorie, soziale Rolle, Rollenerwartungen, Sozialisierung, Verinnerlichung, Rollenkonflikt, soziale Position, gesellschaftliche Erwartungen, Individualität, Sanktionen, Vereinfachung der sozialen Realität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Rollentheorie am Beispiel des Clowns
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Rollentheorie, insbesondere die Bedeutung sozialer Rollen für menschliches Verhalten und soziale Interaktion. Sie verwendet das Beispiel des Clowns mit seinen großen Schuhen als anschauliche Metapher für die sichtbaren Merkmale einer sozialen Rolle.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt soziale Rollen als Richtlinien menschlichen Verhaltens, Rollenerwartungen und ihre gesellschaftliche Bedingtheit, Rollenkonflikte, den Prozess der Sozialisierung und Verinnerlichung von Rollen, sowie die Rolle als Vereinfachung sozialer Wirklichkeit. Konkret werden Erwartungen an Rollenträger, Rechte und Pflichten sozialer Rollen und die soziale Position analysiert.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit enthält eine Einleitung, ein Kapitel zur sozialen Rolle (inkl. Unterkapitel zu Erwartungen an den Rollenträger), ein Kapitel zum Rollenkonflikt (leider unvollständig im Originaltext), ein Kapitel zur sozialen Position (ebenfalls unvollständig), sowie eine Zusammenfassung und Schlüsselwörter. Ein Inhaltsverzeichnis ist ebenfalls vorhanden.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Bedeutung sozialer Rollen für das menschliche Verhalten und die soziale Interaktion zu verdeutlichen und die Mechanismen hinter der scheinbaren einfachen Charakterisierung von Menschen anhand weniger Merkmale zu beleuchten.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Rollentheorie, soziale Rolle, Rollenerwartungen, Sozialisierung, Verinnerlichung, Rollenkonflikt, soziale Position, gesellschaftliche Erwartungen, Individualität, Sanktionen, Vereinfachung der sozialen Realität.
Was wird in der Einleitung beschrieben?
Die Einleitung führt in die Thematik ein, indem sie die alltägliche Beobachtung der schnellen Einordnung von Menschen anhand weniger Informationen beleuchtet. Sie stellt die Frage nach der Fähigkeit des Menschen zu solchen Vereinfachungen und ihrer Bedeutung für das soziale Zusammenleben. Der Clown und seine großen Schuhe dienen als anschauliches Beispiel.
Was wird im Kapitel "Die soziale Rolle" erklärt?
Dieses Kapitel definiert den Begriff der sozialen Rolle als Richtlinien des menschlichen Verhaltens und Sicherheitssystem für Interaktionen. Es betont, dass Menschen mehrere Rollen verkörpern und es keine festen Gesetze für das Rollenverhalten gibt. Die soziale Rolle wird als Verbindung zwischen Individuum und Gesellschaft beschrieben.
Was wird im Kapitel "Erwartungen an den Rollenträger" behandelt?
Dieses Kapitel befasst sich mit den gesellschaftlichen Erwartungen an einen Rollenträger. Es werden die soziale und zeitliche Bedingtheit dieser Erwartungen diskutiert, sowie die individuelle Entscheidung des Rollenträgers, diesen Erwartungen zu entsprechen oder sie abzulehnen, und die damit verbundenen Sanktionen. Sozialisierung und Verinnerlichung werden als Lernprozesse für das Rollenverhalten dargestellt.
Warum fehlen die Kapitel "Der Rollenkonflikt" und "Die soziale Position"?
Die Kapitel "Der Rollenkonflikt" und "Die soziale Position" sind im Originaltext unvollständig und können daher nicht zusammengefasst werden.
- Quote paper
- Susanne Rieder (Author), 2005, Rollentheorie: Warum trägt der Clown immer so große Schuhe?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/159751