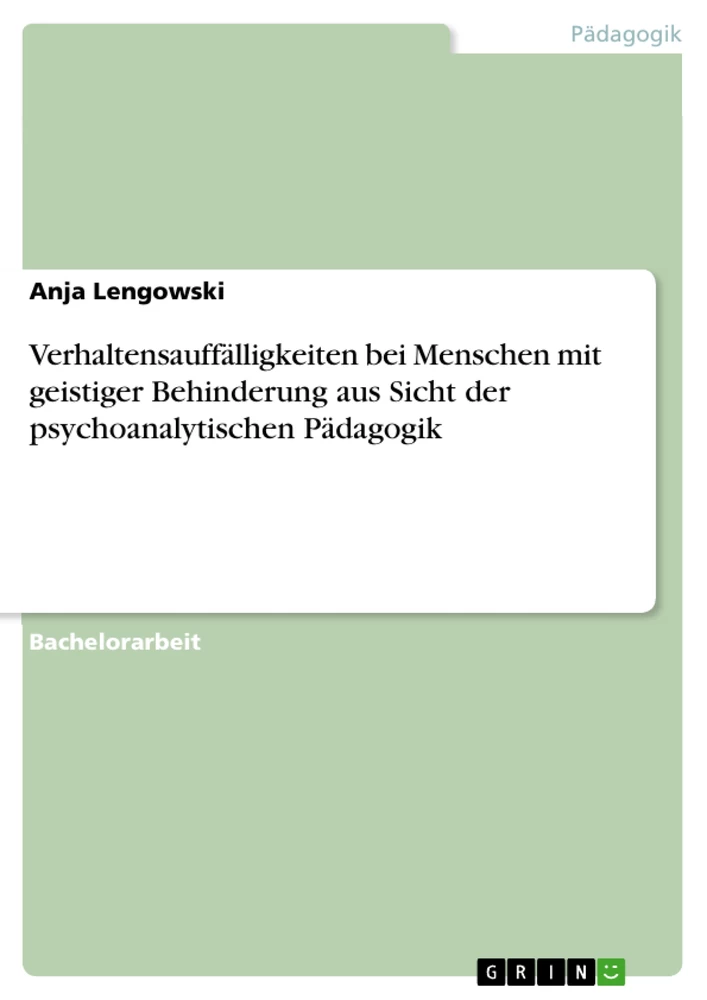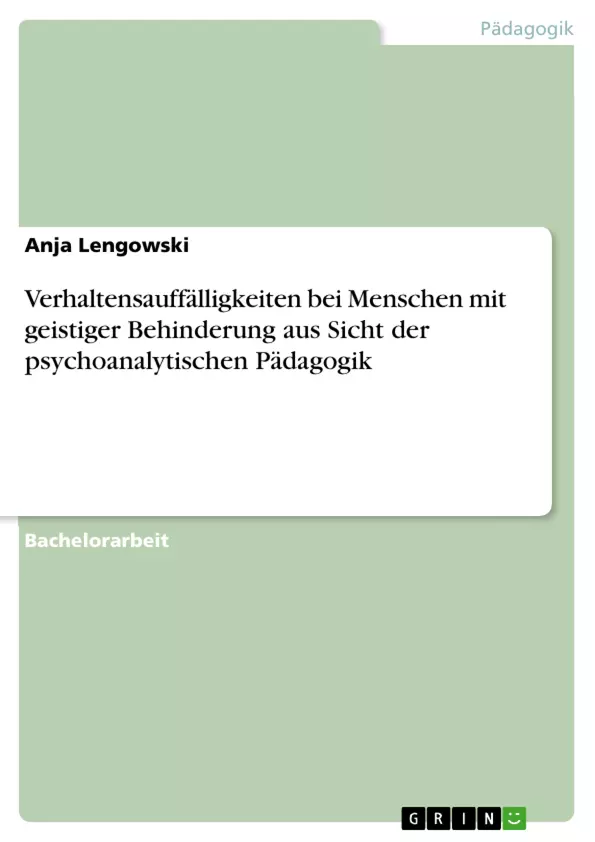Im ersten Abschnitt soll zunächst auf die Frage der Häufigkeit und Entstehungsbedingungen von Verhaltensauffälligkeiten bei Menschen mit geistiger Behinderung eingegangen werden, um danach eine Begriffsdefinition für Verhaltensauffälligkeiten und für Geistige Behinderung im Sinne einer Psychoanalytischen Pädagogik zu finden. Im darauf folgenden Kapitel zur Psychoanalytischen Pädagogik soll durch eine Bestimmung ihrer wesentlichen Inhalte und Ziele, sowie die Erläuterung ihrer grundlegenden Begrifflichkeiten, eine Grundlage für das Verständnis der verschiedenen Entwicklungstendenzen innerhalb der Psychoanalytischen Pädagogik geschaffen werden, um dann der Frage nachgehen zu können, wie Verhaltensauffälligkeiten bei Menschen mit geistiger Behinderung aus Sicht der Psychoanalytischen Pädagogik erklärt werden. Die Entstehung und Entwicklung der Psychoanalytischen Pädagogik und der, für Menschen mit geistiger Behinderung und Verhaltensauffälligkeiten bedeutsamen Erklärungsansätze wird darauf folgend dargestellt. Im letzten und zentralen Abschnitt der Arbeit soll der Frage nachgegangen werden, welche handlungsorientierten Möglichkeiten es in der psychoanalytisch orientierten Richtung für Pädagogen im Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten bei Menschen mit geistiger Behinderung gibt. Dazu wird exemplarisch das Konzept Niedeckens ausführlich vorgestellt und auf verstehende Ansätze von Verhaltensauffälligkeiten bei geistiger Behinderung untersucht. Abschließend folgt die Schilderung des Szenischen Verstehens, das Niedecken bereits in ihrem Ansatz aufgegriffen hat. Das Konzept wird dargestellt, da ich es als das wesentliche psychoanalytisch orientierte Handlungsinstrument für Pädagogen erachte.
Bei der Bearbeitung des Themas werde ich mich auf einschlägige Fachliteratur beziehen. In Anbetracht dessen, dass die Psychoanalytische Pädagogik an sich, und speziell die Psychoanalytische Pädagogik geistig Behinderter eine noch nicht all zu lange Rezeptionsgeschichte besitzt, wird die verwendetet Literatur relativ aktuell sein.
Auf Grund der dadurch vereinfachten Schreibweise werde ich in der folgenden Arbeit immer die männliche Form bei Subjekten beibehalten. Dies soll nicht einen Ausschluss oder die Diskriminierung der jeweils weiblichen „Vertreter“ implizieren (...)
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Verhaltensauffälligkeiten bei Menschen mit Geistiger Behinderung
- Begriffsbestimmung Verhaltensauffälligkeiten
- Begriffsbestimmung Geistige Behinderung
- Psychoanalytische Pädagogik
- Was ist Psychoanalytische Pädagogik?
- Übertragung und Gegenübertragung
- Projektion und Projektive Identifizierung
- Die Weg zur „Klassischen Psychoanalytischen Pädagogik“
- Psychoanalytische Pädagogik und Geistige Behinderung
- Ausgewählte Konzepte der Psychoanalytischen Pädagogik zu Verhaltensauffälligkeiten bei Menschen mit geistiger Behinderung
- Dietmut Niedecken „Namenlos“
- Was ist geistige Behinderung?
- Die Organisierung von geistiger Behinderung
- Verhaltensauffälligkeiten bei Menschen mit geistiger Behinderung aus Niedeckens Sicht
- Bewertung
- Das Konzept des Szenischen Verstehens
- Szenisches Verstehen in der psychoanalytischen Pädagogik
- Szenisches Verstehen in der Geistigbehindertenpädagogik
- Bewertung
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Entstehung und Auswirkungen von Verhaltensauffälligkeiten bei Menschen mit geistiger Behinderung aus Sicht der Psychoanalytischen Pädagogik. Sie beleuchtet die relevanten Konzepte und Ansätze der Psychoanalytischen Pädagogik, insbesondere das Konzept von Dietmut Niedecken „Namenlos“ und das Szenische Verstehen, und analysiert deren Anwendung im pädagogischen Kontext.
- Begriffsbestimmung und Entstehung von Verhaltensauffälligkeiten bei Menschen mit geistiger Behinderung
- Grundlagen und Entwicklung der Psychoanalytischen Pädagogik
- Anwendung psychoanalytischer Konzepte in der Geistigbehindertenpädagogik
- Das Konzept von Dietmut Niedecken „Namenlos“ und die Rolle der Beziehungsebene
- Szenisches Verstehen als Handlungsinstrument für Pädagogen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung schildert die persönliche Begegnung der Autorin mit einem Mädchen mit Verhaltensauffälligkeiten und beschreibt, wie diese Erfahrung ihr Interesse für die Psychoanalytische Pädagogik weckte. Der erste Abschnitt der Arbeit befasst sich mit der Häufigkeit und Entstehung von Verhaltensauffälligkeiten bei Menschen mit geistiger Behinderung und definiert die Begriffe „Verhaltensauffälligkeiten“ und „Geistige Behinderung“ aus der Sicht der Psychoanalytischen Pädagogik. Das folgende Kapitel erläutert die wesentlichen Inhalte und Ziele der Psychoanalytischen Pädagogik, inklusive zentraler Begrifflichkeiten wie Übertragung, Gegenübertragung, Projektion und projektive Identifizierung. Der Abschnitt „Ausgewählte Konzepte der Psychoanalytischen Pädagogik zu Verhaltensauffälligkeiten bei Menschen mit geistiger Behinderung“ fokussiert sich auf das Konzept von Dietmut Niedecken „Namenlos“ und das Szenische Verstehen. Es werden die zentralen Aspekte dieser Konzepte dargestellt und ihre Anwendung im Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten bei Menschen mit geistiger Behinderung diskutiert.
Schlüsselwörter
Psychoanalytische Pädagogik, Verhaltensauffälligkeiten, Geistige Behinderung, Übertragung, Gegenübertragung, Projektion, projektive Identifizierung, Dietmut Niedecken, „Namenlos“, Szenisches Verstehen, Handlungsinstrument, pädagogischer Kontext.
Häufig gestellte Fragen
Wie erklärt die psychoanalytische Pädagogik Verhaltensauffälligkeiten?
Sie sieht Verhaltensauffälligkeiten als Ausdruck unbewusster Konflikte und Beziehungsdynamiken, die oft durch Übertragung und Gegenübertragung zwischen Kind und Pädagoge sichtbar werden.
Was versteht Dietmut Niedecken unter der „Organisierung“ von Behinderung?
Niedecken argumentiert in ihrem Konzept „Namenlos“, dass geistige Behinderung nicht nur ein biologischer Defekt ist, sondern durch die soziale Interaktion und die Abwehrprozesse des Umfelds mitgestaltet wird.
Was ist „Szenisches Verstehen“?
Es ist ein Handlungsinstrument, bei dem der Pädagoge das Verhalten des Kindes als Teil einer Szene begreift, um die dahinterliegenden Botschaften und Gefühle des Kindes zu entschlüsseln.
Welche Rolle spielen Übertragung und Gegenübertragung?
Übertragung bedeutet, dass das Kind Gefühle aus früheren Beziehungen auf den Pädagogen projiziert. Die Gegenübertragung sind die emotionalen Reaktionen des Pädagogen darauf, die als Diagnosewerkzeug dienen können.
Sind Verhaltensauffälligkeiten bei geistiger Behinderung häufiger?
Die Arbeit untersucht die Häufigkeit und zeigt auf, dass die spezifischen Lebens- und Beziehungsbedingungen von Menschen mit geistiger Behinderung die Entstehung von Auffälligkeiten begünstigen können.
- Quote paper
- Anja Lengowski (Author), 2009, Verhaltensauffälligkeiten bei Menschen mit geistiger Behinderung aus Sicht der psychoanalytischen Pädagogik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/159756