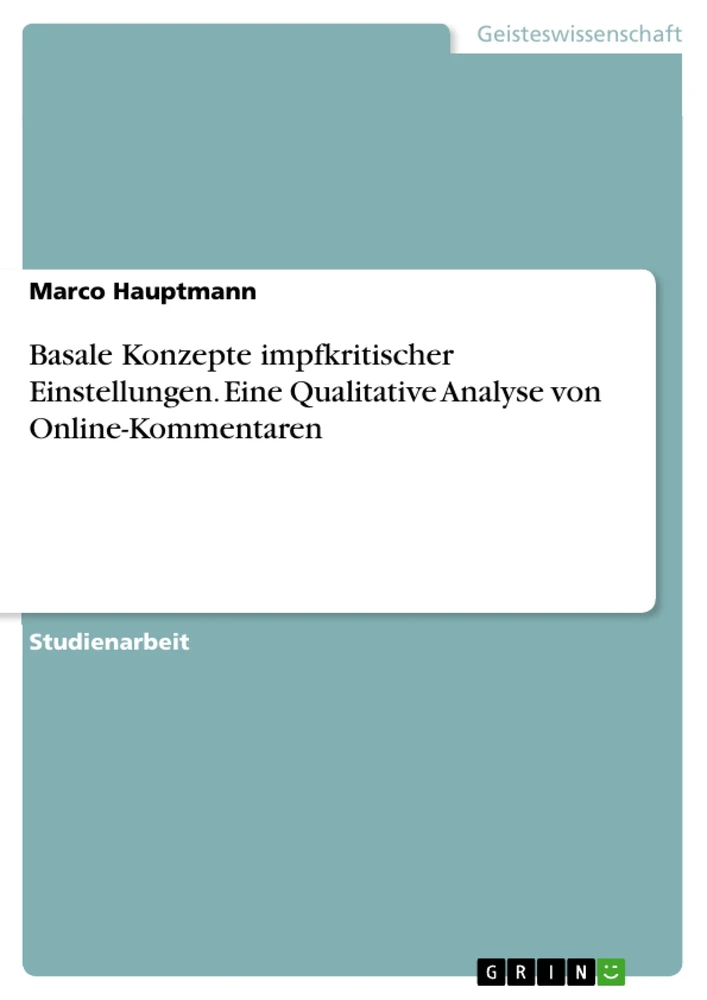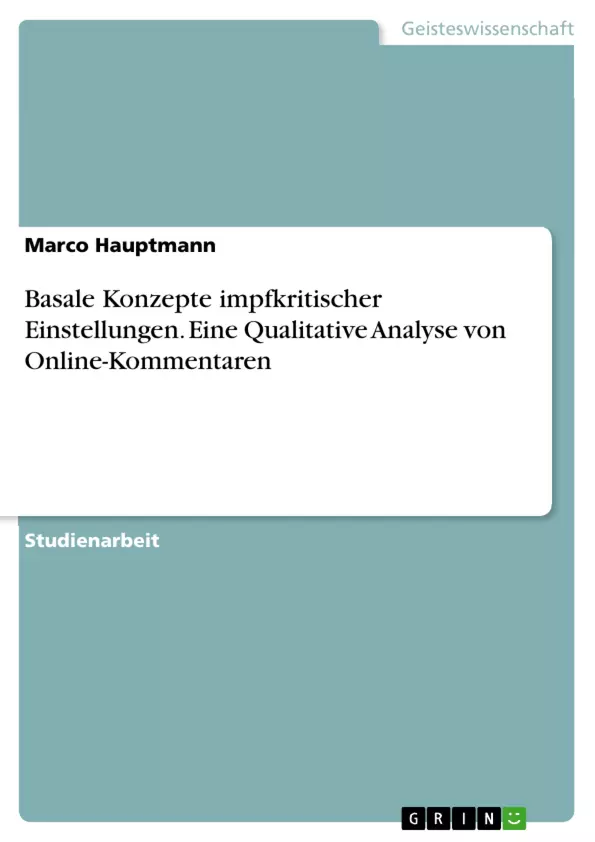Warum lehnen Menschen Impfungen ab? Ein Umstand, der speziell in der jetzigen Weltlage der SARS-CoV-2-Pandemie, zunehmend an Relevanz gewinnt, wo auf der einen Seite Impfungen als essentieller Bestandteil gesehen werden, um der Pandemie Herr zu werden, auf der anderen Seite sich aber reger Widerstand und Zweifel gegen Impfungen hebt. Hierzu wird in Abschnitt 2 zunächst kursorisch darauf eingegangen, was Lakoff unter Prototypen und metaphorischen Konzepten versteht und wie diese das Denken prägen. In den nächsten beiden Abschnitten 3 und 4 werden die zur Analyse herangezogenen Daten und die Methodik der qualitativen Analyse vorgestellt. Im Hauptabschnitt 5 werden zunächst deskriptiv augenfällige Motive, Argumente und Konzepte von Impfkritikern herausgearbeitet und in einem zweiten Schritt diesen zugrundeliegende metaphorische Konzepte und Prototypen differenziert. Abschnitt 6 fasst die Ergebnisse zusammen und gibt einen Ausblick auf weitere Untersuchungsansätze.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Metaphorische Konzepte und Prototypen
3 Daten
4 Methode
5 Analyse
5.1 Diskursmotive
5.2 DeskriptiveArgumenteundKonzepte
5.2.1 Misstrauen - Profitmotiv der Pharmaindustrie
5.2.2 Erfahrungswissen statt Faktenwissen
5.2.3 ImpfungalsGefahr
5.2.4 Selbstständig Denken vs. Hörigkeit
5.2.5 Immunitatsmachismo
5.2.6 Freiheit
5.3 Kausale Konzepte und Prototypen
5.3.1 Kausalitäat
5.3.2 Purismus
5.3.3 Individualismus
6 Schluss
Literatur
Anmerkung
Vorweg einige formale Anmerkungen. Das Schreiben von Wörtern in Großbuchstaben dient zur Markierung von Bildschemata und Metaphern, z.B. ZEIT ist GELD, wobei Zeit metaphorisch als Geld konzeptualisiert wird, siehe Abschnitt 2. Direkte Zitate aus wissenschaftlichen Arbeiten sind mit Anführungszeichen „...“ umschlossen, direkte Zitate aus dem Datenmaterial der Onlinekommentare mit Apostrophen ‘...’. Längere Zitate aus dem Datenmaterial werden durch eine kleinere, kursive Schrift und eingezogenem Absatz kenntlich gemacht. Im Arbeitstext wird kursive Schrift zur Hervorhebung von Begriffen verwendet, Unterstreichungen zur Hervorhebung von bestimmten Textstellen, vor allem in Zitaten aus dem Datenmaterial, zur Stuützung von Interpretationen. Eckige Klammern werden in Zitaten eingesetzt, um Anmerkungen und Ergaünzungen meinerseits hinzufuügen.
1 Einleitung
Wenn wir im Alltag Uber Krankheit sprechen, wenn wir versuchen diesen Begriff mit Bedeutung zu füllen, um ihn uns und anderen verständlich zu machen, bedienen wir uns hüufig der Kriegsmetapher (Sontag, 2013). In dieser Metapher stehen sich zwei Seiten gegenuüber: Die Innen-Seite des eigenen Koürpers und die Außen-Seite einer Umwelt voller Fremdkoürper. Normalerweise herrscht im Koürper Eintracht. Er geht seinen natuürlichen Funktionen nach, ist leistungsfaühig, stark, vital. Koürpergefuühl und Erscheinungsbild entsprechen dem langjaührig angetrauten Gefuühl und Erscheinungsbild. Der eigene Küorper ist, kurz gesagt, wie er sein soll: Gesund. Doch tagtüaglich ist er einer Außenwelt mit all ihren Gesundheitsgefahren und -risiken ausgesetzt, fremdartigen Krankheitserregern wie Bakterien oder Viren. Unsichtbare Agenzien mit dem alleinigen Ziel, den Koürper anzugreifen, zu schaüdigen, sich einzuverleiben. Mit dem alleinigen Ziel Krankheit zu erregen. Im erregten Krankheitszustand wandelt sich der Koürper zum Schlachtfeld. Aus seiner natuürlichen, harmonischen Ruhe gereizt verteidigt er sich gegen die Invasoren mithilfe koürpereigener Abwehrkraüfte, dem Immunsystem. Eine koürpereigene Polizei oder Armee, die im Koürper fuür Recht und Ordnung sorgt, was in diesem Fall heißt: Bekaümpfen, was dem Koürper fremd ist.
Als die World Health Organization 2019 die aus ihrer Sicht 10 grüoßten globalen Gesundheitsrisiken auflistete,1 konnte man viele dieser Gesundheitsrisiken mit der obigen Metapher sinnhaft einordnen. Es gab klassische Feinde des Koürpers in Form von Influenza, Ebola, HIV und Dengue. Heimtuückische Viren, die sich rasant verbreiten und der Koürperabwehr große Problem bereiten koünnen. Resistenzen entwickelnde Bakterien, gegen welche die Waffen des Immunsystems kaum noch Wirkung zeigten. Risiken wie Luftverschmutzung und sonstige widrige Umweltbedingungen, die zwar selten an sich als Krankheitserreger gedeutet werden, aber dafuür als Horte von Krankheitserregern, z.B. verseuchtes Trinkwasser, und als Schwaüchung des Koürpers, der in seiner natuürlichen Funktionsweise auf bestimmte Umweltzustaünde angewiesen ist, z.B. saubere Luft, deren Fehlen wiederum anfaülliger fuür Krankheitserreger macht. Doch gibt es ein gelistetes Risiko, das sich nicht so recht mit diesem Verstüandnis zu vertragen scheint: Die Ablehnung von Impfungen.
Im Gegensatz zu den anderen Risiken gibt es hier keinen Fremdkoürper. Im Gegenteil: Impfablehnung ist eine Einstellung, eine Persüonlichkeitseigenschaft, ein Teil von einem Selbst. Das, was wir bezeichnen, wenn wir vom Ich sprechen. Das, was als Inhalt des Koürp ers eigentlich gerade gegen Krankheiten geschuützt werden soll. Nicht die AußenWelt, nein, die Innen-Welt, das eigene Selbst wird pathogenisiert, wird zur Krankheit.
Das ist ein gänzlich anderes Verständnis von Krankheit. Eines, das keine klaren Grenzen, mit klar verteilten Rollen zwischen Innen-Welt und Außen-Welt zieht. Eines, das Uber das einzelne Individuum hinausgeht und die Interdependenz zwischen Individuen einbezieht. Eines, in dem der Mensch selbst zur Gefahr werden kann. In dem eine Überzeugung einem Virus gleichgesetzt wird, das Menschen infizieren und zu Verhalten verleiten kann, welches uber die individuelle Gesundheit hinaus die Gesundheit einer Gemeinschaft gefahrdet.
Zahlreiche qualitative Studien haben sich mit Impfeinstellungen auseinandergesetzt und versucht herauszuarbeiten, welche Motive und Konzepte Personen verwenden, die Impfungen ablehnen (Impfkritiker) oder befürworten (Impfbefürworter). So z.B. die unter Impfkritikern verbreiteten Neigung Impfungen primar nach dem Profitmotiv von Pharmaunternehmen zu deuten (Attwell et al., 2017), die Rolle von Emotionen wie z.B. Angst vor negativen Impffolgen oder der Einsatz von Spott und Humor zur Etikettierung von Impfkritikern durch Impfbefuirworter (Harvey et al., 2019), der Einfluss kultureller Erwartungsverschiebungen in Richtung individueller Freiheit und Autoritait in persoinlichen Gesundheitsanliegen und Risikoabwaigungen (Ward et al., 2017) etc.
Viele dieser Motive und Konzepte werden uns auch in dieser Analyse begegnen. Das Ziel dieser Arbeit ist es jedoch analytisch eine Ebene tiefer zu gehen und, im Sinne von George Lakoff, basale (metaphorische) Konzepte und Prototypen herauszuarbeiten, welche das Denken und Verstehen von Impfkritikern in Hinblick auf Krankheit, Gesundheit und Immunitait maßgeblich leiten. Nur so laisst sich aufzeigen, welche basalen, im Alltagsdenken verbreiteten, und nicht gesondert Impfkritik vorbehaltener, Konzepte und Prototypen Anschluss fuir impfkritische Einstellungen bieten und unser Verstaindnis hinsichtlich folgender Frage erweitern: Warum lehnen Menschen Impfungen ab? Ein Ümstand, der speziell in der jetzigen Weltlage der SARS-CoV-2-Pandemie, zunehmend an Relevanz gewinnt, wo auf der einen Seite Impfungen als essentieller Bestandteil gesehen werden, um der Pandemie Herr zu werden, auf der anderen Seite sich aber reger Widerstand und Zweifel gegen Impfungen hebt.2
Hierzu wird in Abschnitt 2 zunaichst kursorisch darauf eingegangen, was Lakoff unter Prototypen und metaphorischen Konzepten versteht und wie diese das Denken praigen. In den naichsten beiden Abschnitten 3 und 4 werden die zur Analyse herangezogenen Daten und die Methodik der qualitativen Analyse vorgestellt. Im Hauptabschnitt 5 werden zunaichst deskriptiv augenfiallige Motive, Argumente und Konzepte von Impfkritikern herausgearbeitet und in einem zweiten Schritt diesen zugrundeliegende metaphorische Konzepte und Prototypen differenziert. Abschnitt 6 fasst die Ergebnisse zusammen und gibt einen Ausblick auf weitere Untersuchungsansätze.
2 Metaphorische Konzepte und Prototypen
In der Theorie kognitiver Metaphern, welche von George Lakoff und Mark Johnson begründet wurde, sind Metaphern keine extravaganten, rhetorischen Stilmittel, sondern Kern unserer Kognition, um sich ein sinnhaftes Bild von der Welt zu machen (La- koff und Johnson, 2003).3 Eine basale, prüakonzeptuelle Sinneinheit bilden hierbei BildSchemata als in Wahrnehmungsinteraktionen und Motorprogrammen wiederkehrende, dynamische Muster, die der Erfahrung Kohüarenz und Struktur verleihen“ (Johnson, 1987: XIV; Uü bersetzung des Autors). Ein Beispiel ist das Bild-Schema GEFAü SS, mit deren Hilfe wir die Welt in Innen, Außen und Grenzen strukturieren. Bamberg liegt in Deutschland (LAND ist GEFÄSS), etwas ist in Sicht (SICHTFELD ist GEFÄSS), das Zimmer im zweiten Stock (GEBÄUDE ist GEFÄSS). Im Körper-Geist Dualismus betrachten wir den Koürper als GEFAü SS des Geistes und Uü bergangsgrenze, welche die Innenwelt des Selbst von der materiellen Äußenwelt trennt. Weitere Bild-Schemata sind u.a. VERBINDUNG, TEIL-GÄNZES, URSPRUNG-WEG-ZIEL, OBEN-UNTEN, VER- TIKÄLITÄü T, KRÄFT, KONTÄKT, OBJEKT (Lakoff, 1989: 155ff; Hampe, 2005: 2f).
Durch kontextsensitive Kombination von Bild-Schemata küonnen zunehmend elaborier- tere und abstraktere Konzepte gebildet werden. So ist das Konzept BETRETEN eine Kombination aus den Bild-Schemata OBJEKT (Einheit, die betritt), GEFÄü SS (das Innere, das betreten wird) und URSPRUNG-WEG-ZIEL (Äußen als Ursprung, Pfad zur Uü bertretung der Grenze als Weg, Innen als Ziel) (Langacker, 2008: 32f). Solche Konzepte koünnen wiederum kombiniert werden, um komplexere Konzepte zu erzeugen usw. Ein metaphorisches Konzept, oder kurz Metapher, ist eine Äbbildung zwischen zwei Erfahrungsbereichen, wobei Quell-Domaüne und Ziel-Domaüne unterschieden werden. Die Quell-Domaüne ist ein Erfahrungsbereich aus dem ein, fuür gewüohnlich, sensomotorisch fassbares, konkreteres Konzept auf eine Ziel-Domaüne abgebildet wird, um ein dortiges abstrakteres Konzept durch die Erfahrung aus der Quell-Domaüne verstüandlich zu machen (Lakoff, 1993: 4f).
Ein Beispiel fuür eine Metapher ist ZEIT ist GELD. Das abstrakte Konzept der Zeit wird auf den Erfahrungsbereich des Geldes abgebildet und mit Bedeutung versehen. Dies zeigt sich im Sprachgebrauch z.B. durch Äussagen wie das hat mich viel Zeit gekostet“, „dafür habe ich einiges an Zeit investiert“, „deine Zeit ist aufgebraucht“, „verschwendete Zeit“. Die Ziel-Domane der Zeit zapft die Quell-Domane des Geldes an und bedient sich dessen konzeptueller Fundierung als LIMITIERTE RESSOURCE, WERTVOLLE WARE und damit assoziierte Handlungen. Weitere Beispiele sind u.a. LIEBE ist REISE, DISKUSSION ist KRIEG, GUT ist OBEN, SCHLECHT ist UNTEN, MEHR ist OBEN, WENIGER ist UNTEN, DENKEN ist BEWEGEN, KOMMUNIKATION ist FUHREN, VERSTEHEN ist FOLGEN (Lakoff und Johnson, 2003).
Ein weiterer, zentraler Aspekt menschlicher Kognition ist prototypische Kategorisierung. In Anlehnung an Eleanor Rosch4 werden in der Theorie kognitiver Metaphern, im Gegensatz zu klassischen Theorien, Kategorien nicht als widerspruchsfreie Menge von Entitäten verstanden, die alle bestimmte Eigenschaften teilen, wonach sie per definitionem Mitglied der Kategorie sind. Kategorien sind stattdessen gekennzeichnet durch idealtypische Prototypen, welche eine Kategorie, je nach Kontext und subjektiver Einschatzung, am besten repräsentieren. Mitglieder einer Kategorie werden nicht digital, anhand des notwendigen Vorliegens inharenter Eigenschaften, sondern analog und kontextabhangig, anhand der Familienähnlichkeit zu einem Prototypen bestimmt. Analog heißt hier, dass eine fuzzylogische mehr-oder-weniger-Zuordnung eines Objekts zu einer Kategorie moäglich ist, die sich an der empfundenen Aä hnlichkeit des Objekts zu einem Prototypen der Kategorie, relativ zu bereits kategorisierten oder zu kategorisierenden Objekten und deren empfundenen Aä hnlichkeit zu Prototypen der Kategorie, orientiert (Lakoff, 1990).
Der Prototyp eines Stuhls z.B. duärfte bei vielen dem in Abbildung 1 gleichen: Vier Stuhlbeine, geschlossene Ruäckenlehne, akkurat, kantig, massiv, wenig geschwungen, aus Holz, Funktionalitäat: Sitzen.
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Prototyp Stuhl. KI-Generiert mithilfe von ChatGPT (GPT-4o, 02.07.2025).
Je weiter ein zu kategorisierendes Objekt von diesem Prototypen abweicht, desto unwahrscheinlicher ist es, dass wir es als Stuhl bezeichnen. In Abbildung 2 weicht das Objekt zum Teil erheblich vom Prototypen ab, kann aber immer noch aufgrund vorhandener Kerncharakteristiken des Prototypen (Ruäckenlehne, Holz, Funktionalitaät: Sitzen) als Stuhl identifiziert werden.
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Stuhl mit leichter Abweichung von Prototyp. KI-Generiert mithilfe von ChatGPT (GPT-4o, 02.07.2025).
Abbildung 3: hingegen wird von den meisten Menschen und in den meisten Kontexten wohl kaum noch als Stuhl kategorisiert.5
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3: Stuhl mit starker Abweichung von Prototyp. Installation of Chairs vom chinesischen Künstler Ai Weiwei, 2010.
Prototypen beschränken sich nicht auf konkrete Objekte wie Stühle. Auch abstrakte Konzepte wie Freiheit, Intelligenz oder Gesundheit werden heuristisch anhand von Prototypen gedeutet. So ist z.B. ein Mensch mit Brille, gefuällten Buächerregalen in der Wohnung, gepflegtem Aä ußeren, Universitäatsabschluss etc. fuär viele ein besseres Beispiel fuär einen intelligenten Menschen und damit fuär Intelligenz als z.B. jemand, der Jogginghose träagt, ungepflegt aussieht, stottert etc. Dieses Beispiel laässt erahnen, dass prototypische Kategorisierungen durchaus fragwuärdig sein koännen, da man häaufig auf Basis aäußerer, leicht zugaänglicher Wahrnehmungen weitgreifende Zuordnungen zu komplexen Kategorien vornimmt.
3 Daten
Die Wahl der Stichprobe zur Untersuchung der Forschungsfrage fiel auf zwei Artikel samt Kommentaren des Online-Blogs stadtlandmama.de. Ein Ratgeberblog, der auf Eltern, insbesondere Mütter, als Publikum gerichtet ist und diesen die Möglichkeit bietet sich zu Partnerschafts- und Erziehungsthemen zu informieren und auszutauschen. Der erste Artikel trüagt den Titel Gastbeitrag: Darum lasse ich mein Kind nicht impfen,6 datiert auf den 24.02.2015 mit 104 Kommentaren. Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Gastbeitrag einer Blogleserin, in welchem sie als Mutter von zwei Kindern ihre Erfahrungen mit deren Impfungen teilt, sowie ihre Entscheidung, das zweite Kind nicht impfen zu lassen. Der zweite Artikel ist eine am naüchsten Tag folgende GegenPosition einer Kinderärztin und Mutter mit dem Titel Gastbeitrag einer Kinderärztin: Darum ist es so wichtig, dein Kind zu impfen 7 und 68 Kommentaren.
Hauptargument fuür die Wahl dieser beiden Artikel ist der Umstand, dass Gegenpositionen aufeinandertreffen und argumentiert werden muss, weshalb man auf Impfungen verzichtet oder warum man sie fuür wichtig haült, was einen Großteil der untersuchungsrelevanten Argumente und Konzepte erst zutage füordert. Der Kontrast von impfkritischen zu impfbefuürwortenden Kommentaren erlaubt es zudem jene Argumente und Konzepte herauszufiltern, die impfkritischen Kommentaren eigen sind. Die entsprechende Diver- sitaüt und Differenziertheit in Einstellungen, Motiven und Konzepten macht diese beiden Artikel attraktiver als z.B. impfkritische Kommentare auf Facebook, Twitter und Telegram, wo zwar teils aktiver kommuniziert wird, jedoch in Echokammern, in denen es keine Gegenpositionen gibt und gar nicht erst diskutiert werden muss, weshalb man Impfungen ablehnt. Impfablehnung ist dort vorausgesetztes Hintergrundwissen auf dem jeder Beitrag basiert.8 Obgleich durch diese Stichprobenwahl die Menge impfkritischer Kommentare geringer ausfaüllt, ist sie noch immer groß genug, um fruchtbar analysiert werden zu koünnen. Gleichzeitig sind die Kommentare, die zwischen 2015 und 2019 gepostet wurden, recht aktuell, was sie z.B. von Kommentaren in impfkritischen Impfforen wie z.B. impfschaden.info abhebt, das seine Bluüte in den Jahren 2008 bis 2009 hatte, in dem mittlerweile aber nur noch sporadisch kommentiert wird.
Potentieller Nachteil dieser Stichprobe ist die durch die Blogwahl bedingte Einschraünk- ung der Kommentatoren auf Eltern bzw. Muütter. Dieser Nachteil kann etwas relativiert werden, da man davon ausgehen kann, dass insbesondere Eltern in der Entscheidung, das eigene Kind zu impfen oder nicht, sich intensiv mit dem Thema auseinandersetzen und eine Einstellung bilden. Als Nichteltern ist die Einstellung zu Impfungen vermutlich eher indifferent, weil Impfen nach wie vor hüaufig als Kindersache angesehen wird und viele Erwachsene das Thema fuür sich selbst als abgeschlossen betrachten (Kunze und
Groman, 2019). Dennoch wäre auch von Interesse, welche Argumente und Konzepte die Impfkritik von Nicht-Muttern bzw. Nicht-Eltern prägen, was hier unterbelichtet bleiben muss.
4 Methode
Methodisch orientiert sich die vorliegende Arbeit an der Grounded Theory, im speziellen an der Methode des konstanten Vergleichs. Hierbei dient der Vergleich als zentrale Erkenntnisheuristik. Durch staändiges, dynamisches Kontrastieren des empirischen Materials, theoretisch geleiteten Selektionen des empirischen Materials, Kodes und Kategorien untereinander und dem Vergleich zwischen hypothetisch Moäglichem und theoretisch Naheliegendem, aber Abwesendem, mit dem vorhandenem Material (Was wurde gerade nicht gesagt?) uäb er den gesamten Forschungsverlauf der Arbeit hinweg, sollen latente Strukturen, Prozesse und Zusammenhäange aufgedeckt und in theoretischen Konzepten ausdifferenziert werden (Glaser, 1998: 107ff; Breuer et al., 2019: 272f).
Alle Kommentare, unter die auch die beiden Artikel gezaählt wurden, wurden mithilfe der Software MaxQDA zunaächst individuell betrachtet, analysiert und kommentiert, um einen ersten Uä berblick uäb er Argumente, Konzepte, Prototypen und damit verbundene Hypothesen, ohne vorgeschaltete Selektion zu erlangen. Erst danach wurden alle Kommentare in impfkritische, impfbefuärwortende und einer nicht zuordenbaren Restkategorie unterschieden. Als impfkritisch wurden solche Kommentare eingestuft, die eine deutliche Ablehnung oder starke Vorbehalte gegen Impfungen bekunden. Als impf- befuärwortend solche, die eine deutliche Zustimmung von Impfungen oder Ablehnung von impfkritischen Einstellungen ausdruäcken und Impfungen gegen impfkritische Argumente verteidigen. Tatsaächlich ließen sich die Kommentare meistens problemlos einem der beiden Positionen zuordnen. Impfbefuärworter z.B. weisen sich häaufig ausdruäcklich in ihrem Kommentar als solche aus (‘Ich bin uäbrigens stillende, selbst kochende, tragende und selbstverstäandlich impfbefuärwortende Mama’), äaußern sich kritisch bis abschäatzig uäber Impfkritiker und/oder bedanken sich fuär den zweiten Artikel der Kinderaärztin. Impfkritiker bezeichnen sich selten als solche direkt, stellen sich jedoch haäufig implizit auf diese Seite, indem z.B. Impfkritiker als Gruppe gemuätserregt verteidigt werden (‘Wer sagt denn, dass Impfkritiker ihre Kinder auf Masern-Parties schleppen? Wieder mal ein daämliches Vorurteil, aber da befindest Du Dich ja hier in guter Gesellschaft...’). Parallel lehnen Impfkritiker Impfungen haäufig entschieden ab, aäußern sich abschäatzig gegenuäber Impfbefuärworter und/oder bedanken sich fuär den ersten, impfkritischen Artikel. Letztlich ließen sich so von 174 Kommentaren 47 als impfkritisch und 106 als impfbefuärwortend einordnen.
In einem rekursiven, abduktiven Prozess wurden schließlich die impfkritischen Kommentare erst isoliert betrachtet, um typische, deskriptive Argumente und Konzepte erkennen, sowie in der Erstsichtung entwickelte Hypothesen über Argumente und Konzepte prüfen zu künnen. Die daraus entsprungenen Hypothesen Uber Argumente und Konzepte wurden dann mit den isolierten Kommentaren der Impfbefuürworter abgeglichen, um sicherzustellen, dass diese fuür impfkritische Positionen charakteristisch sind. Dieser Prozess wurde mehrmals, mit stetig differenzierteren Hypothesen und einem zunehmenden Augenmerk hin zu basalen metaphorischen Konzepten und Prototypen, wiederholt, mit dem Ziel eine allmaühlich hinreichende empirische Saüttigung, theoretische Durchdringung, textuelle Performanz und Originalitaüt als Guütekriterien qualitativer Forschung zu erreichen (Struübing et al., 2018).
5 Analyse
Die Analyse unterteilt sich in 3 Abschnitte. In Abschnitt 5.1 werden zunaüchst die wichtigsten Motive des vorliegenden Diskurses beschrieben: Welche Themen und Vorannahmen strukturieren den Diskurs? Abschnitt 5.2 beschreibt zentrale Argumente und Konzepte, die von Impfkritikern verwendet werden. Der dritte und letzte Abschnitt 5.3 analysiert die vorherigen deskriptiven Erkenntnisse kausal in basale metaphorische Konzepte und Prototypen, welche nicht nur das kognitive Grundgeruüst impfkritischer Einstellung bilden, sondern das kognitive Grundgeruüst sinnhafter Realitaütsauslegung. Bei den letzteren beiden Abschnitten sollte beachtet werden, dass nicht alle Impfkritiker die herausgearbeiteten Argumente, Konzepte und Prototypen teilen und wenn sie geteilt werden, nicht in gleicher Weise. Die herausgearbeiteten Argumente, Konzepte und Prototypen sollen vielmehr idealtypisch verstanden werden, als eine Uü berzeichnung von charakteristischen Gesichtspunkten zwecks Kontrastierung und Verstaündnis (Weber, 1922: 191), die eine Aussage uüber Impfkritiker als Kategorie, nicht aber als Personen müoglich macht.
5.1 Diskursmotive
Die wohl wichtigsten Auffaülligkeiten des hiesigen Diskurses sind, dass die Kommentatoren bereits mit der dualistischen Vorannahme in den Diskurs gehen, dass es zwei sich gegenuüberstehende Lager gibt, sich mehrheitlich bereitwillig und ausdruücklich in einem dieser Lager verorten und auf diesen Dualismus in ihren Kommentaren explizit oder implizit zuruückgreifen, wodurch der Diskurs in seiner Grundbeschaffenheit von vornherein dem Motiv sachlicher, kooperativer Wahrheitsfindung entzogen wird und sich hin zu einer Frage der Identitaüt und Zuordnung bewegt. Insofern spielt die unterschwellige bis ausdrückliche positive Attribution der eigenen, aber vor allem, die negative Attribution der Gegenseite eine tragende Rolle im Diskurs, was sich auch darin zeigt, dass selten auf Kommentare der Gegenseite eingegangen wird und z.B. kein Austausch uüber mehrere Kommentare zwischen Kommentatoren unterschiedlicher Lager stattfindet. Es wird uübereinander statt miteinander diskutiert, der persüonliche Standpunkt in einem isolierten Kommentar dargelegt, ohne detailliert auf andere Kommentare und deren Argumente einzugehen oder Diskussionsbereitschaft zu signalisieren. Kommentatoren beider Seiten haben kurzum einen Stereotypen der Gegenseite verinnerlicht, wobei vor allem impfkritische Kommentatoren auch eine stereotypische Vorstellung davon haben wie sie von Impfbefuürwortern gesehen werden. Diese Vorstellungen daruüber wie die andere Seite generell ist und wie man gesehen wird treten in den Kommentaren immer wieder an die Oberflüache.
Aber schließt doch bitte wieder eure Schubladen, Impfgegner wie Impfbefürworter. Wir sind keine dinkelfressenden, jahrelang-stillenden, in-Jutebeutel-gesteckten Esotherikhexen, die ihren Namen tanzen - genauso wenig wie die Impfbefürworter alle ignorante, karrieregeile, nicht-stillende-Alete-reichende, von-den-Medien-manipulierte Dumpfbacken sind.
Das zentrale Thema des Diskurses wird bereits im ersten Satz des impfkritischen Leserartikels vorweggenommen: Verantwortung.
Ich bin vieles. . . aber sicherlich nicht verantwortungslos!
Wer handelt unverantwortlich, wer verantwortlich? Diese Frage durchzieht und strukturiert den Diskurs. Verantwortung wird dabei als Rolle verstanden, der man gerecht werden muss, wobei sich die beiden Seiten vordergruündig darin unterscheiden, welche Rollen das sind. Impfkritiker sehen sich zentriert als Eltern in der Verantwortung ihre Kinder vor müoglichen Schaüden zu bewahren. Impfbefuürworter sehen sich nicht nur als Eltern, sondern ebenfalls als Mitglieder einer Gesellschaft in der Verantwortung. Man duürfe nicht nur an die eigenen Kinder denken, sondern ebenso an andere, die mit einer Krankheit schlechter zurechtkommen küonnten, z.B. weil sie aufgrund von Vorerkrankungen oder ihres Alters (noch) nicht geimpft sind, und durch das eigene, ungeimpfte Kind angesteckt werden koünnten. Impfkritiker orientieren sich demnach in ihrer Impfentscheidung hauptsaüchlich an einer Rolle, die der Eltern des Kindes, waührend Impfbefuürworter darnach streben zwei Rollen in Einklang zu bringen: Eltern und Gesellschaftsmitglied, Kinderwohl und Gemeinwohl.
Es verwundert somit nicht, dass vor allem die Diskussion um die Gefahreneinstufung von Impfungen den Diskurs praügt. Impfbefuürworter sehen in Impfungen kein oder ein statistisch geringes Risiko, das vom Nutzen fuürs eigene Kind in der erworbenen Im- munitaüt und der Gesellschaft als Ganzes in der Vermeidung von Epidemien uüberboten wird. Die Rolle als Eltern und Gesellschaftsmitglied sind komplementaür und beide koünnen aufrechterhalten werden. Impfkritiker sehen in Impfungen ein untragbares Risiko bis hin zu einer erwiesenen, gesundheitlichen Gefahr fuür die eigene Person bzw. fuür das eigene Kind. Die Rolle als Eltern und Gesellschaftsmitglied, von welchem ein Impfschutz erwartet wird, sind konträr und führen zu kognitiver Dissonanz.9 Diese Dissonanz wird mittels zwei Strategien gelost. Zum einen wird sich in der Impfentscheidung vollends auf die Rolle als Eltern bzw. Individuum zuruückgezogen und die Rolle des Gesellschaftsmitglieds als irrational delegitimiert, weil Gesundheit Privatsache sei. Die eigene Gesundheit bzw. die des eigenen Kindes wird hierarchisch uüber das Gemeinwohl bzw. die Gesundheit anderer gestellt.
Wer würde das nicht tun? Erst die anderen, dann erst unser eigenes Leben. So war vielleicht der St. Martin, aber ihr??? Nicht euer Ernst! Wenn euch der Arzt RICHTIG aufklürt und euch über alle Nebenwirkungen einer Impfung informiert, dann riskiert ihr euer Leben füur die Gemeinschaft???
Die zweite Strategie delegitimiert ebenso die Rolle des Gesellschaftsmitglieds in der Impfentscheidung, jedoch auf andere Weise. Der Nutzen von Impfungen fuürs Gemeinwohl wird aberkannt, indem z.B. Impfungen die Wirksamkeit abgesprochen oder das Konzept der Herdenimmunitaüt als Unsinn oder nicht erreichbar verworfen wird. Dadurch kann sich in der Impfentscheidung allein auf die Rolle als Eltern oder Individuum berufen werden, da die Rolle als Gesellschaftsmitglied, aufgrund des mangelnden Nutzens von Impfungen fuürs Gemeinwohl, nicht mehr von Belang ist.
5.2 Deskriptive Argumente und Konzepte
5.2.1 Misstrauen - Profitmotiv der Pharmaindustrie
Und ja, Impfen ist auch bzw. hauptsüachlich ein großes Profitgeschaüft der Pharmaindustrie.
Eine der markantesten Auffaülligkeiten ist das ausgeprüagte Misstrauen gegenuüber Institutionen und Vertretern von Institutionen wie pharmazeutischen Unternehmen, Wissenschaft, Politik und Aü rzten, wobei das meiste Misstrauen mit Abstand der ‘Pharmaindustrie’ entgegengebracht wird. Da diese an Impfungen ‘sehr sehr viel Geld verdient’ werden Handlungsgruünde und Absichten von pharmazeutischen Unternehmen auf ‘wirtschaftliches Interesse’ bzw. ein Profitmotiv reduziert. Die Rede von der ‘Pharmaindustrie’ oder den ‘Pharma-Konzernen’ generalisiert alle pharmazeutischen Unternehmen hinsichtlich des Profitmotivs und impliziert nicht nur Aü hnlichkeit, sondern Zusammengehüorigkeit. Der verwendete Prototyp von Unternehmen ist hier ein politisch eher linksgerichteter, Kapitalismus negativ gesinnter Prototyp: Groß, maüchtig, unpersoünlich, unmenschlich, undurchsichtig, ohne Empathie oder sonstigen Gefuühlen, abgesehen von der Gier nach Profiten, welche den alleinigen Seinsgrund stellen.
Das Misstrauen gegenuüber der ‘Pharmaindustrie’ wird teils auf (Kinder-)Aü rzte uüber- tragen, welche dann als verlaüngerter Arm der Pharmaindustrie gelten und ebenso aus wirtschaftlichem Privatinteresse Impfungen empfehlen, verabreichen und deren Wirkung zusichern.
5.2.2 Erfahrungswissen statt Faktenwissen
Misstrauen gegenüber Institutionen impliziert Misstrauen gegenüber institutionellem Wissen. Und tatsächlich demonstrieren Impfkritiker in vielerlei Hinsicht eine Präferenz und Hoüherwertung von persoünlichem Erfahrungswissen, ‘Bauchgefuühl’ und ‘Intuition’ gegenuüber evidenzbasiertem, wissenschaftlichem Wissen. Dabei dienen (das Zeigen von) Emotionen, persüonliche Anteilnahme und damit assoziierte Authentizitaüt und Ehrlichkeit als Wahrheitsheuristik. Das ‘Schreien’ des Kindes beispielsweise wird mit starken Schmerzen assoziiert. Schmerzen sind etwas Schlechtes, sind zu vermeiden, und da die Impfung als Ursache der Schreie und Schmerzen ausgemacht wird, wird die Impfung selbst emotiv aufgeladen, als etwas Schlechtes, das es zu vermeiden gilt.
Die nächsten Tage und Nächte [nach der Impfung] waren ein einziger Albtraum. Unsere Tochter bäumte sich schreiend aus dem Schlaf heraus auf und war nicht mehr zu beruhigen. Sie schrie und schrie und schrie. . .
Schrilles Schreien wird oft als Nebenwirkung angegeben, aber habt ihr mal äuberlegt, was das zu bedeuten hat??? Was es fäur das Baby bedeutet? Vielleicht heftigste Schmerzen durch diese Nervengifte, die nunmal leider tatsäachlich Inhalt der Impfsubstanzen sind.
Theorie und Praxis ergaünzen sich nicht gegenseitig, sondern stehen diametral zueinander. Das theoretische, praxisferne und kuünstliche Wissen der Wissenschaft hat fuür die eigene, konkrete Lebenssituation damit kaum Relevanz.
Und die starken Frauen aus meiner Familie waren keine. . . wie sagen die freundlichen Kommentatoren hier jutebeuteltragende Kräauterhexen“. Nein, es waren einfach starke weiße Frauen, die ihren Verstand und ihr Herz gleichermaßen benutzen konnten und sich lieber auf Erfahrungswerte und Beobachtung verließen als auf stupide durch Studium gehetzte Theoretiker (natäurlich nicht alle). Sie besaßen zusäatzlich etwas wie eine gesunde, naturgegebene Intuition.
Insofern greifen Impfkritiker im Gegensatz zu Impfbefuürworter in ihrer Argumentation selten auf wissenschaftliches Wissen zuruück. Stattdessen gelten persüonliche Erfahrungen und ‘Geschichten’ als Goldstandard, in denen emotional anhand eigener Erfahrung ein duüsteres Bild von Impfungen gezeichnet wird.
Meine erste Tochter, heute fast 4 Jahre alt, ist nach der zweiten 6-fach Impfung fast gestorben. Wir waren eine Woche im Krankenhaus - ein traumatischer Aufenthalt den ich bis heute kaum überwinden kann. Auch wir haben unserer Kinderäarztin ohne Räuckfragen vertraut und wäurden das wohl bis heute tun, wenn uns nicht so etwas schlimmes widerfahren wäare. Ich bin gläucklich das sich meine Tochter wieder gut erholt hat, aber es haätte auch alles anders laufen koännen.
Auffallend hüaufig wird die Gefuühlskaülte und Nuüchternheit von Aü rzten bzw. deren fehlendes Verstüandnis und Teilen persoünlicher Sorgen thematisiert. Vor dem Hintergrund, dass Emotionen als Wahrheitsheuristik herangezogen werden, ist jedoch verstüandlich, dass fehlende Emotionen bzw. fehlendes Eingehen auf eigene Sorgen Zweifel an Impfungen aufkommen lassen.
Die Aufklaärung beim Kinderarzt hat mich auch noch mehr verunsichert. Mir wurde ein Flyer in die Hand gedruäckt und auf die Nachfrage, nach dem Beipackzettel der Impfung, wurde mit schroff geantwortet, die käonnte ich im Internet nachlesen. Da bekomme ich kein gutes Gefäuhl, mein Kind impfen zu lassen.
Fakten werden so zu einer individuellen, subjektiven Angelegenheit, die jeder für sich, durch eigene Erfahrung unabhängig von anderen, finden muss. Meinung wird damit in den Stand von Wissen erhoben und Wissenschaft selbst zur Meinungs-, Glaubens- oder Uü berzeugungsfrage.
Aber das ist eben meine Geschichte und jeder darf seine eigene Geschichte haben und sich dementsprechend verhalten.
Was hat gebildet sein“ damit zu tun ob man der Wissenschaft glauben schenkt oder nicht?!
5.2.3 Impfung als Gefahr
Im Gegensatz zu ihrer angedachten Funktion als Gesundheitsschutz werten Impfkritiker Impfungen vielmehr als Risiko, Gewaltakt, schüadlich, unzuverlaüssig etc. Ein uüberspan- nendes Charakteristikum von impfkritischen Kommentaren ist, dass Impfungen eine groüßere Gefahr darstellen als die ‘Kinderkrankheiten’ gegen die geimpft wird.
Ich selbst habe mehr Angst vor den Folgen (auch vermutete Spätfolgen wie Allergien zB) von Impfungen als vor den Kinderkrankheiten und deren Folgen.
Durch das Vorliegen von ‘Nervengifte[n]’ wie ‘Quecksilber, Aluminium und Formaldehyd’ werden Impfstoffe z.B. zu Giftstoffen umgedeutet. Spurenmengen dieser Inhaltsstoffe stehen dann metonymisch fuür den gesamten Impfstoff. Aber auch bloßes Misstrauen gegenuüb er Pharmaunternehmen genuügt als Argument, da man nicht mit Sicherheit sagen kann, was wirklich in den Impfungen enthalten ist. Die Angst vor Impfungen gilt dabei vor allem der Angst vor unmittelbaren ‘Impffolgen’, ‘Impfschaüden’, ‘Nebenwirkungen’ ‘wie Schrilles Schreien, Allergien, Neurodermitis, Fieber! , Autismus, To- desfaülle’, sowie unabsehbaren ‘Langzeitfolgen’ aufgrund der giftigen oder unbekannten Inhaltsstoffe. Gerade die Angst vor Langzeitfolgen scheint getrieben vom beschriebenen Unternehmensprototypen, wonach nur der Profit und nicht die Gesundheit des Patienten zaühlt, und Impfungen insofern ohne ausreichende Vertrüaglichkeitspruüfung auf den Markt gebracht werden.
Wenn sich die meisten Menschen gerne als Versuchskaninchen der Pharma zur Verfäugung stellen wollen, gerne. Meine Kinder stehen dafäur nicht mehr zur Verfäugung.
Dass offiziell nur sehr wenige Impffolgen vorliegen wird damit erklüart, dass die meisten Impffolgen nicht gemeldet, verschwiegen oder falsch zugeordnet werden. Mangels hoher offizieller Zahlen wird eine Dunkelziffer angenommen, die im Mantel von Misstrauen, Unsicherheit und/oder eigener Uü berzeugung beliebig wachsen kann, bis zu dem Punkt an dem Impfungen zum primaüren, kausalen Faktor von Krankheiten im Allgemeinen werden.
Wer sagt denn, dass ohne Impfungen ganz viele Menschen krank werden? Vielleicht werden immer mehr Menschen krank, wegen der Impfungen? Alles was eine Wirkung hat, hat eine Nebenwirkung. Was die Schwermetalle in den Impfungen langfristig fuär Schäaden anrichten, kann ja noch gar keiner sagen.
Weitere Attributionen heben die Unzuverlässigkeit und Unwirksamkeit von Impfstoffen hervor. Für deren Unzuverlässigkeit wird vor allem damit argumentiert, dass auch geimpfte Menschen krank werden können. Der Anteil tatsächlicher Impfversager spielt hierbei keine Rolle. Allein das Vorhandensein der Möglichkeit, dass eine Impfung keine Wirkung zeigen kann, genuögt zur Abrede der Zuverlaössigkeit. Unter Missachtung von Wahrscheinlichkeiten wird eine absolute Logik angewandt: Die Moöglichkeit eines Impfschadens, plus die Moöglichkeit einer ausbleibenden Immunisierung fuöhrt zur Schlussfolgerung, dass Impfungen ein unnoötiges Risiko darstellen.
Die Unwirksamkeit von Impfungen wird vor allem mit Alternativerklaörungen propagiert, z.B. dass Impfungen keinen Anteil am starken Ruöckgang von Krankheiten haben, gegen welche geimpft wird, sondern diese durch ‘bessere Umweltfaktoren [von selbst] eingebrochen’ sind. Dies lenkt die Risikoabwöagung noch staörker in eine impfablehnende Schlussfolgerung, denn nun besteht neben der Möoglichkeit eines Impfschadens nicht nur mehr die Moöglichkeit einer ausbleibenden Immunisierung, sondern die Immunisierung bleibt mit Sicherheit aus. Was bleibt ist einzig und allein das Risiko eines Impfschadens.
5.2.4 Selbstständig Denken vs. Hörigkeit
Einer sagt was, und die Schafe laufen gläubig hinterher. .. Und nur weil es Alle machen, oder „Man“ das macht, muss es nicht richtig sein.
Die Vernachlöassigung von Faktenwissen zugunsten Erfahrungswissen offenbarte bereits die semantische Naöhe von Wissen und Meinung impfkritischer Kommentare und Wissenschaft als Uö berzeugungsfrage. Wie die Uö berzeugungen von Impfkritikern und Impf- befuörwortern zustande kommen tendiert dabei zu folgender Sichtweise. Impfkritiker setzen sich mit dem Thema Impfen auseinander, haben reflektiert und abgewogen, sind aufgeklaört und haben sich auf Basis dieser Aufklöarung zum Wohle ihres Kindes gegen Impfungen entschieden. Impfbefuörwoörter dagegen gleichen ‘Schafe[n]’, die ‘nach Plan pieksen [...] ohne Ahnung wofuör’ und aus ihrem Schlaf aufwachen muössten. Impfbefuörwortende Eltern werden nicht als vorsöatzlich böose gedacht, die ihren Kindern schaden wollen,10 aber sie sind ‘Schafe’, ‘dumme Herdentiere’, welche sich eben nicht mit Impfungen auseinandergesetzt, nicht reflektiert und abgewogen haben, sondern Herde und Hirten, also Mehrheitsmeinung und denjenigen Autoritöaten, die sie vorgeben (Pharmanunternehmen, Wissenschaft, Politik), hoörig folgen. Impfbefuörworter befinden sich metaphorisch in einem Schlaf. Sie denken nicht aktiv, sehen nicht mit ihren verschlossenen Augen, sind betaöubt, ohne Bewusstsein, empfangen Gedanken passiv wie Traöume und akzeptieren diese ohne Hinterfragung. Mission mancher Impfkritikern scheint es demnach Impfbefürworter zu wecken, die Augen zu öffnen, um zu verhindern, dass Eltern durch Impfungen fahrlässig ihrem Kind Schaden zufügen. Kurzum, um andere Menschen davon zu uüberzeugen auf die wachende, aufgeklaürte, richtige Seite zu wechseln.
Wacht auf, Leute, echt jetzt!
Eigenstaündiges Denken wird damit gleichgesetzt eine andere Meinung als die Mehrheit zu vertreten. Wer die Mehrheitsmeinung vertritt outet sich als jemand, der sich weder informiert noch aus eigenem Antrieb eine Entscheidung gefaüllt hat, sondern gedankenlos der Mehrheit folgt. Kritik und Ablehnung von Mehrheitswissen wird zu einem positiven Wert an sich, der, statt aus argumentativen Qualitaütskriterien wie logischer Schluüssigkeit oder Unvoreingenommenheit, seinen Wert vielmehr daraus zu schöpfen scheint, Mut zu Offenheit und zum Widerstand zu zeigen, um für die eigene Uü berzeugung, das Richtige, einzustehen.
5.2.5 Immunitätsmachismo
Ich und meine Brüder haben alle Krankheiten durchgemacht und wahren gesünder als alle anderen in der Schule! Als mein Bruder Masern hatte, gabs einfach viel Tee und Bettruhe und nach ein paar Tagen war die Sache erledigt. Nur schade ist das ich mich nicht angesteckt habe, obwohl meine Mutter mich immer wieder zu ihm schickte.
Emily Martin (1994: 236) verwendet den Begriff Immunitüatsmachismo“ fuür das machohafte Prahlen mit der eigenen Immunitaüt, ein Verhalten, das vor allem Impfkritikern eigen scheint. Gesundheit wird hier stilisiert zur individuellen Persoünlichkeitseigen- schaft, die als Stüarkebeweis substanziell zur eigenen Identitaüt beitrüagt und herangezogen wird, um eine Entscheidung gegen Impfungen zu rechtfertigen. Denn waührend geimpfte Kinder hüaufig krank und schwaüchlich seien, ist man selbst oder das eigene Kind trotz bzw. wegen der fehlenden Impfungen gesuünder als diese.
Diese Einstellung zeichnet sich durch starke Generalisierung aus (‘gesünder als alle anderen’), durch eine Konzeption von Gesundheit als individuelle, autonome, durch eigenes Handeln determinierbare Eigenschaft und nicht z.B. als Zustand einer Gemeinschaft, ferner durch die Uü berzeugung, dass die eigene Wahrnehmung zur Beurteilung der Gesundheit anderer genuügt und durch die Linearisierung individueller Gesundheit, die es ermoüglicht die eigene Gesundheit mit der Gesundheit anderer Individuen hierarchisch zu vergleichen.
Interessant ist die dieser Einstellung innewohnende Wertumkehr von Impfung und Krankheit. Krankheit wird positiv gewertet als Müoglichkeit, die eigene Gesundheit bzw. das eigene Immunsystem auf den Pruüfstand zu stellen und zu staürken. Krankheit ruückt hier in die metaphorische Naühe eines Krafttrainings wie z.B. beim Bodybuildung zur Erbauung des eigenen Koürpers. Das Immunsystem muss trainiert werden und Krankheiten sind gut und wichtig, um das Immunsystem reifen und staürker werden zu lassen.
Die eigene Starke besteht schließlich darin Krankheiten ohne schulmedizinische Hilfe standzuhalten. Die Impfung dagegen wird negativ gewertet. Sie ist ein künstlicher Eingriff, der verhindert, dass das Immunsystem im natürlichen Kontakt mit Krankheiten gestärkt wird, oder das Immunsystem sogar aktiv schwacht.
Jetzt habe ich mich als Erwachsene (aus Blödsinn und weil ichs mir einreden liess) impfen lassen und seit dem ist mein Imunsystem völlig im eimer und ich habe Ads. Vielen Dank an die so tolle moderne Medizin!
Ist die konventionelle Deutung die der Impfung als Schutz (positiv) gegen schaüdliche Krankheiten (negativ) werden hier die Pole vertauscht. Krankheiten schuützen, indem sie das Immunsystem aufbauen und staürken, waührend es die Impfungen sind, die Schaden anrichten.
5.2.6 Freiheit
In einer freien Gesellschaft möochte ich allein entscheiden, ob ich mich ,bzw. mein Kind impfen lasse. Zwangsimpfungen sind ein falscher, geföahrlicher Weg. Offenbar hat Deutschland nichts dazugelernt. Jeder sollte das Recht haben NEIN zu sagen, ohne von der breiten Masse belehrt“ zu werden Wer sich bzw. sein Kind durchimpfen lassen moöchte sollte es tun. Wer sich dagegen entscheidet; aus welchen Gröunden auch immer, sollte toleriert werden und nicht mit panikmachenden fadenscheinigen Argumenten belehrt oder gar bestraft werden.
Wie in Abschnitt 5.1 beschrieben betrachten Impfkritiker die Impfentscheidung als eine persoünliche Entscheidung. Impfungen sind Privatsache, die der Gemeinschaft gegenuüber nicht gerechtfertigt werden muüssen und die Entscheidung fuür oder gegen Impfungen ist Ausdruck individueller Freiheit.11 Impfzwang ist als Einschnitt in die individuelle Freiheit ein Instrument buürgerlicher Bevormundung und Kontrolle. Aber auch die Ablehnung der impfkritischen Position durch Impfbefuürworter im Diskurs wird haüufig schon als Intoleranz, Diskriminierung und Einschnitt in Meinungsfreiheit wahrgenommen. Der in Abschnitt 5.2.4 angesprochene Mut zum Widerstand im Aü ußern der impfkritischen Uü berzeugung ist somit auch ein symbolisches Eintreten fuür individuelle Freiheit, gegen die Unterdruückung von Meinungen.
5.3 Kausale Konzepte und Prototypen
5.3.1 Kausalität
Die Zurechnung von Zustaünden auf eine Ursache, z.B. die Zurechnung von Schreien auf eine Impfung, setzt ein Konzept von Kausalitüat voraus. Dieses Konzept bestimmt, welche URSACHE-WIRKUNG-Beziehungen wir aus den durch Wahrnehmung und Vorwissen zugaünglichen Informationen konstruieren. Impfkritiker verwenden hierbei auffallend haüufig ein Kausalitaütskonzept, das sehr nahe an dem von Lakoff beschriebenem Prototypen liegt. Diesen Prototypen bezeichnet Lakoff als Direkte Manipulation, der folgende Eigenschaften aufweist (Lakoff und Johnson, 2003: 140ff; Lakoff, 1990: 54f):
• Es gibt einen Agenten, der aktiv etwas tut (Ursache)
• Es gibt einen Patienten, der in einen neuen, wahrnehmbaren, physischen Zustand wechselt (Wirkung)
• Es gibt einen Agenten und einen Patienten ^ einfaktorielle Kausalität
• Direkter Kontakt von Agent (Ursache) und Patient (Wirkung) ^ lokale und zeitliche Korrelation
• Das Tun des Agenten geht dem Wandel im Patienten zeitlich voraus
• Es findet ein Energietransfer von Agent (aktiv) auf Patient (passiv) statt
• Der Agent ist ein Mensch
• Das Tun des Agenten ist absichtsvoll und folgt einem Plan ^ Agent handelt willentlich, hat ein Ziel und kontrolliert sein Tun
• Der Agent tragt die Hauptverantwortung fär sein Tun und dem Wandel im Patienten ^ Schuld
• Der Agent nutzt seine Hande, seinen Körper oder ein Instrument ^ Motorprogramm
• Der Agent uberwacht den Wandel im Patienten
Der Arzt ist der menschliche Agent, der mittels dem Instrument der Spritze den passiven Patienten, z.B. das Kind, impft. Der Akt der Impfung ist dabei der saliente, direkte Kontakt zwischen Agent und Patient, wobei dem Patienten Wirkstoffe aus der Spritze injiziert werden (Energietransfer). Die Wahrnehmung von Aä nderungen im Kind folgen zeitlich der Impfung und werden aufgrund enger zeitlicher Korrelation als ‘eindeutige’ Kausalbeziehung gedeutet.
Bevor ich geboren wurde, hat meine Mutter einen Sohn bekommen, am Tag seiner ersten Impfung ist er im Alter von 4 Monaten verstorben. Und selbst dieser eindeutige Zusammenhang wurde nicht als impfschaden anerkannt.
Aber selbst ohne enge zeitliche Korrelation kann ein Zustand einer Impfung zugeschrieben werden. Mit dem beschriebenen direkten Kontakt zwischen Agent und Patient besteht ein in der Erinnerung verfuägbares Erlebnis, welches dem prototypischen Kausalkonzept entspricht und sich somit im Besonderen fuär Kausalzurechnungen von wahrgenommenen Folgezustaänden anbietet. Da Impfungen kein Routineerlebnis sind, wie z.B. Zaähneputzen, sondern sich vom Alltag abheben, und man besonders als Eltern durch den Eingriff am Kind emotional involviert ist, zeichnen sich Impftermine durch eine hohe heuristische Verfügbarkeit in der Erinnerung aus.12 Diese Verfügbarkeit ist umso höher, je negativer die Voreinstellung gegenüber dem Impfen ist, da jede der Impfung folgende, wahrgenommene, negative Zustandsänderung zur Bestätigung der Voreinstellung bevorzugt der Impfung zugerechnet wird.
Ferner konfligieren Impfungen mit dem Kausalitöatsprototypen in der Hinsicht, dass er eine Wirkung bzw. eine Zustandsaönderung auf einen direkten Kontakt vorsieht. Impfungen jedoch zeichnen sich gerade dadurch aus, dass sie als praöventive Maßnahme eine Wirkung, naömlich die des Krankwerdens, unterbinden.13 Selbst falls eine direkte, wahrnehmbare Reaktion des Patienten auf die Impfung ausbleibt, z.B. schmerzhaftes Schreien, ist man mit einem prototypischen Kausalkonzept darauf sensibilisiert nach Wirkungen Ausschau zu halten, die diesem direkten Kontakt zugeordnet werden koönnen bzw. einen Schuldigen zu suchen, der die Verantwortung fuör diese Wirkung uöbernehmen muss. Dies erhöoht die Wahrscheinlichkeit, dass der Impfung folgende, wahrnehmbare Zustandswechsel, wobei vor allem negative Zustandswechsel die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, der Impfung zugeordnet werden. Dennoch nimmt die Wahrscheinlichkeit all dieser Zuordnungen mit der zeitlichen Distanz zwischen Impfung und wahrgenommener Wirkung ab, da dadurch dem Kausalitaötsprototypen immer weniger entsprochen wird und die Verfuögbarkeit der Impfung in der Erinnerung nachlaösst.
Weiterhin konzeptualisieren Impfkritiker, dem Prototypen entsprechend, Kausalitaöt oftmals einfaktoriell. Die Impfung wird zur alleinigen Ursache fuör negative Zustandsaönd- erungen des Patienten ernannt, anstelle eines multifaktoriellen Ursachenverhaöltnisses, in dem die Impfung z.B. als ein kausaler Baustein in einem komplexen Zusammenspiel aus Impfung, koörperlichen Zustand zum Zeitpunkt der Impfung, Genetik, Umwelt, Entwicklungsstand und weiteren, der Impfung folgenden, Einfluössen gesehen werden koönnte.
Der Fokus auf Menschen als kausale Agenten im Kausalkonzepts von Impfkritikern zeigt sich vor allem dadurch, dass Absichten und Plöane des Agenten fester Bestandteil des Erklaörungsschemas sind. Hinter jeder Wirkung steckt eine Absicht und attribuierte Impfschaöden sind keine Ausnahme. Das prominenteste Motiv ist das bereits beschriebene Profitmotiv der ‘Pharmaindustrie’, aber auch Motive wie vorsöatzliche Vergiftung oder Kontrolle klingen implizit an. Gleichzeitig werden emotional heftige und abwehrende Reaktionen der Gegenseite auf die eigene Position als Nachweis zur Richtigkeit der eigenen Position gesehen, was wiederum den starken Einbezug von Menschen und ihnen unterstellte Absichten und Handlungsgruönde im kausalen Konzept aufzeigt.
Und ich frage mich auch, warum Ihr eigentlich so aggressiv seid wenn Ihr doch glaubt das Richtige zu tun mit den Impfungen an denen die Pharmaindustrie sehr sehr viel Geld verdient?
Das Kausalitätsprototyp genügt jedoch nicht, um impfkritische Einstellungen zu erklären. Auch impfbefurwortende Kommentatoren nutzen ein Kausalkonzept, das diesem Prototypen nicht vollkommen entgegengesetzt steht, sondern lediglich in gewissen Teilen, je nach Kommentator mal mehr, mal weniger, von diesem Prototypen abweicht. Z.B. durch den Einbezug von Multifaktorialitüat, unmenschlicher Agenten, dem Hinterfragen zeitlicher Korrelationen, der Verwendung von Statistik, welche uüber die konkrete Situation des direkten Kontakts hinausgeht etc. Aber vor allem erlaubt dieser Prototyp auch andere Kausalzurechnungen. Warum wird die Impfung als Schuldiger ausgemacht und z.B. nicht der individuelle Arzt, dem unterstellt werden koünnte unsachgemaüß zu impfen oder gar einen falschen Stoff zu verabreichen? Warum werden vordergruündig der ‘Pharmaindustrie’ unlautere Absichten unterstellt und nicht dem Arzt? Weitere Konzepte scheinen vonnoüten, um eine impfkritische Einstellung hervorzubringen.
5.3.2 Purismus
Der Begriff Purismus wird vor allem in der Sprachwissenschaft und Kunst verwendet und bezeichnet ein uübersteigertes Reinheitsbestreben, eine Sprache bzw. Stilrichtung frei von fremden Einfluüssen, z.B. Fremdwüortern, zu halten. Aus Sicht der Theorie kognitiver Metaphern ist Purismus die Nutzung des INNEN-AUSSEN Bildschemas, wobei INNEN als natuürliche, reine,14 zu konservierende Seite positiv und AUSSEN als kuünstlicher, korrumpierender, abzuwehrender Einfluss negativ markiert wird. Das sollte gedanklich zuruück zur Einleitung dieser Arbeit versetzen, in der Gesundheit gemeinhin üahnlich konzipiert wird, als INNEN und AUSSEN, wobei der Koürper als GEFAü SS die Grenze zwischen INNEN und AUSSEN bildet. Die Extremform eines gesundheitlichen Purismus üaußert sich im uübersteigerten Bestreben den Küorper frei von süamtlichen Fremdeinfluüssen zu halten, z.B. durch eine Ausrichtung des gesamten Lebens auf Hygiene, durch Reinigungs- und Waschzwüange, Putzfimmel, stüandiges Desinfizieren etc.
Der gesundheitliche Purismus von Impfkritikern ist allerdings eine Sonderform, die sich durch die Leitmetaphern NATUü RLICH ist REIN und GESUND ist NATUü RLICH auszeichnet. Letzterer Metapher nach wird dasjenige heuristisch als gut und gesund- heitsfürdernd bewertet, was der eigenen Konzeption von natürlich entspricht und kom- plementaür dasjenige als schlecht und gesundheitsschaüdlich bewertet, was als unnatuürlich bzw. kuünstlich wahrgenommen wird. Als natüurlich scheint dasjenige bewertet zu werden, bei welchem Natur als primaürer Schoüpfer und Verursacher gedacht wird, was also aus sich heraus entsteht, keines menschlichen Einflusses und keiner menschlichen Absicht bedarf, also frei bzw. rein von menschlichem Einfluss ist. Der Mensch kann zwar zur Naturschüopfung unterstuützende Beihilfe leisten, in Form einer harmonischen, symbiotischen Naturbeziehung, er ist jedoch nicht Gott dieser Schöpfung. Diese Metapher beleuchtet weitere Merkmale impfkritischer Einstellungen.
In den Augen von Impfkritikern ist eine Impfung ein menschlicher und damit künstlicher Akt. Die Inhaltsstoffe einer Impfung kommen in der Natur nicht vor, sondern werden in Laboren chemisch erzeugt. Der Akt der Impfung ist ein kunstlicher, bei dem das von Menschenhand konstruierte Instrument der Spritze die naturliche INNEN-AUSSEN- Grenze des Korpers durch einen Einstich gewaltsam uberschreitet und einen Einfluss auf die natürliche Funktionsweise des Immunsystems ausubt. Die Schopfer dieser Impfungen vertreten künstliche, der Natur zuwiderlaufende Absichten wie Profitgier, was mit der Ausbeutung von Mensch und Natur assoziiert ist. Das macht auch verstaündlich weswegen Krankheiten positiver bewertet werden koünnen als Impfungen, denn insbesondere die bekannten Kinderkrankheiten sind natürlich, sie haben keinen menschlichen Schoüpfer. Anstatt sie zu vermeiden soll eine symbiotische Beziehung mit ihnen eingegangen werden, in der sie eine wichtige Funktion erfuüllen, naümlich die Entwicklung des Immunsystem im direkten Kontakt mit dem natuürlichen Erreger. Ein richtiger Umgang mit Krankheiten ist demnach ein symbiotischer Umgang, in dem auf Sauberkeit und Hygiene geachtet, das Immunsystem des Kindes durch Kontakt mit dem Immunsystems der Mutter durch das Stillen und mit natuürlichen Erregern aufgebaut, natuürliche Koürperreaktionen wie Fiebern nicht unterdruückt und zur Not zu tradierten Hausmitteln gegriffen wird. Auch die Behauptung Krankheiten seien durch natuürliche Umweltfaktoren, von sich aus ohne Einfluss von Impfungen, zuruückgegangen, wird in der Hinsicht verstaündlich. All dem unterliegt die Vorstellung einer gutartigen Natur mit der eine partnerschaftliche, symbiotische Beziehung eingegangen und die von kuünstlichen, menschlichen Einfluüssen freigehalten werden muss.
Diese Vorstellung plausibilisiert auch den Vorzug von Emotionen und Lebenserfahrungen gegenuüber Logik und Wissenschaft. Emotionen z.B. werden haüufig als etwas natüurliches betrachtet, sie entspringen Geist und Koürper von sich aus, als unbüandige Kraüfte der Natur ohne menschliche Kontrolle und Einflussnahme. Entsprechend scheint eine positive Wertung und Verwendung von Emotionen, Intuition und Bauchgefuühl nur folgerichtig. Logik, Theorie und Argumente dagegen sind kuünstlich, menschgeschaffen, gefuühllos und von Absichten getrieben, schließlich soll mit einem Argument fuür etwas eingetreten werden. Sie liegen in der Dualitüat Natüurlich vs. Unnatuürlich damit eher am unnatuürlichen, negativ bewerteten Pol.
Etwas, was vollkommen rein ist, ist umso schneller verunreinigt und somit besonders schutzbeduürftig. Das koünnte ferner mit erklaüren, warum Impfkritiker so hüaufig die Fragi- litaüt, Verletzlichkeit und Schutzbeduürftigkeit ihrer Kinder betonen. Ein neu geborenes Kind ist nicht nur klein und schwach, sondern zudem (noch) vollkommen natuürlich, vollkommen rein, ohne menschlichen Einfluss.15 Diese Reinheit des Kindes aufrechtzuerhalten bedarf besonderer Anstrengung der Eltern und impliziert eine verstärkte Risikoabwägung von menschlichen Fremdeinflüssen, z.B. durch Fertignahrung oder eben Impfungen.
5.3.3 Individualismus
Individualismus kann grob als Werte- oder Gedankensystem verstanden werden, welches das Individuum in den Mittelpunkt der Betrachtung stellt (Wood, 1972: 6). Im Detail zeichnet sich Individualismus durch drei Dimensionen aus (Realo et al., 2002: 167f):
1. Autonomie: Das Individuum definiert sich als autonomer, unabhangiger Agent und priorisiert die eigenen Ziele und Entscheidungen über denen anderer.
2. Selbstverantwortung: Das Individuum sieht Handlungen und deren Konsequenzen als persoünliche Verantwortung, hat Vertrauen in die eigenen Fertigkeiten und sieht sich als kausal wirksamer Agent.
3. Einzigartigkeit: Das Individuum definiert sich in Abgrenzung von anderen durch besondere, persüonliche Eigenschaften.
Dass sich Menschen als Individuen, und somit mithilfe einer GEFAü SS-Metapher verstehen, wonach der Küorper als GEFAü SS das geistige Selbst (INNEN) von einer materiellen Außenwelt (AUSSEN) trennt, ist, insbesondere in westlichen und kapitalistischen Gesellschaften, nicht ungewoühnlich. Impfkritiker weisen jedoch eine erstaunliche Deckung mit den obigen Dimensionen auf.
So ist unter Impfkritikern die Betonung von Autonomie und der Anspruch Entscheidungen alleine, unabhaüngig von anderen zu treffen, allgegenwüartig. Impfkritiker sehen im Kontrast zu Impfbefuürwortern Impfen als Privatsache, als persoünliche Verantwortung, wonach zu aller erst die Konsequenzen fuür einen Selbst bzw. das eigene Kind argumentatives Gewicht haben, nicht die Konsequenzen fuür Andere. Die Argumentation ist derart fokussiert auf das eigene Selbst als Individuum, dass zwar die Außenwelt als Gefahr fur das eigene Selbst oder das eigene Kind muhelos konzipiert wird (AUSSEN ^ INNEN), der umgekehrte kausale Weg jedoch, dass man Selbst oder das eigene Kind, z.B. durch fehlende Impfungen, eine Gefahr für Andere darstellen könnte (INNEN ^ AUSSEN), wird entweder nicht wahrgenommen, verleugnet oder kleingeredet.16
Gesundheit wird zur individuellen Persöonlichkeitseigenschaft, die man als kausal wirksamer Agent durch hygienisches Handeln, richtige Ernaöhrung etc. unabhaöngig von anderen beeinflussen oder gar kontrollieren kann. Zelebriert wird die Aktivität des Individuums eigens zu denken, eigens zu entscheiden, eigens zu handeln. Verpoönt wird die Passivität des Individuums, die Übernahme fremder Meinungen, das Nachmachen, das Folgen anderer, Aktivitaöt anderer passiv uöber sich ergehen zu lassen. Insofern ist nur schluössig, dass auch Impfungen, welche man passiv, ohne eigene Kontrolle,17 durch einen anderen, aktiven Agenten uöber sich ergehen lassen muss, aus individualistischer Sicht vorneweg in Misskredit stehen. Ünd erst recht, falls der Nutzen von Impfungen fuör einen Selbst bzw. fuör das eigene Kind angezweifelt wird.
Als Ausuöbung von Aktivitaöt und Widerstand gegen Passivitaöt wird Kritik zum Wert an sich. Anders zu denken als die Mehrheit, anderer Meinung zu sein als die Mehrheit und anders zu handeln als die Mehrheit ist an und fuör sich erstrebenswert, umso mehr da es die Einzigartigkeit des eigenen Selbst untermauert. Eigene, persoönliche, aktive Erfahrungen sind folglich auch hoöherwertiger als fremdes Wissen, das man nicht selbst erdacht und fremde Erfahrungen, die man nicht selbst vollzogen hat. Freiheit wird zum zentralen Aspekt individualistischer Identitöat, wobei Freiheit (puristisch) als frei von fremden Einfluössen verstanden wird.
Die Vorstellung der Einzigartigkeit des Individuums bietet Anschluss an das, oftmals in homoöopathischen und anthroposophischen Kreisen gegen Impfungen vorgetragene Argument, das jeder Mensch und somit jeder menschliche Organismus einzigartig ist und diese Einzigartigkeit soweit geht, dass auch bei Impfungen individuell entschieden werden muss, ob sie sinnvoll sind oder nicht, ob sie zum eigenen Organismus passen oder nicht (Mittring-Junghans et al., 2021).18 Schließlich kann es nicht sein, dass ‘ein und derselbe Impfstoff bei Millionen von unterschiedlichen Menschen gleich wirken soll.’
Diese individualistische Denkweise wird ebenso herangezogen, um die Außenwelt zu konkretisieren und verstaöndlich zu machen. So werden Kollektive, Institutionen wie z.B. Wissenschaft oder pharmazeutische Unternehmen, ebenfalls als kausal wirksame Agenten mit Absichten und Zielen verstanden und Impfungen dahingehend abgewogen, welche Ziele besagte Kollektive mit ihnen erreichen wollen, wobei als Ziel der individuelle Nutzen im Vordergrund steht. Da vor allem der eigenen Erfahrung vertraut wird, wird jedoch die im direkten Kontakt fassbare und erfahrbare Person des Arztes tendenziell vertrauenswürdiger eingestuft als die unbekannten, fremden, distanzierten Agenten hinter Institutionen.
In vielerlei Hinsicht überschneidet und ergänzt der Individualismus die vorangegangenen Konzepte der prototypischen Kausalität und des Purismus. Diese drei Konzepte sind hochgradig kompatibel, was ihre gleichzeitige, kognitive Auspraägung so wahrscheinlich macht. Und sie erklaären im Zusammenschluss Beobachtungen, die sie alleine nur schwer erkläaren käonnten. Zusammengenommen fuägt sich das Bild einer gefäahrlichen Außenwelt, in der sich das Individuum eigenverantwortlich durch aktive Entscheidungen und Handlungen stetig der Einfluässe und Absichten anderer Agenten erwehren muss, um sich in seiner Reinheit erhalten zu käonnen. Wer sich als umfassend kausal wirksamer Agent betrachtet, der allein fuär sich selbst, aber eben auch, fuär sich selbst allein verantwortlich ist, unterliegt einem stetigen Entscheidungszwang und der Unsicherheit stets die richtige, verantwortbare Entscheidung zu treffen, insbesondere wenn die Wahl darin besteht, sich der gefaährlichen Außenwelt auszusetzen oder nicht. Und genau diese Unsicherheit zieht sich wie ein roter Faden durch impfkritische Kommentare, eine Unsicherheit ob der Frage, sich oder sein Kind der Außenwelt zu oäffnen und damit deren potentiellen Gefahren zugaänglich zu machen oder abzuschirmen und eine vermeintliche Reinheit des Individuums zu wahren.
6 Schluss
Auf der Suche nach Konzepten, Argumenten und Motiven, welche impfkritischen Einstellungen unterliegen, wurden wir trotz der uäberschaubaren Stichprobe an Kommentaren mit reichhaltigen Funden belohnt. Viele der in anderen Untersuchungen aufgezeigten Konzepte konnten auch hier nachgewiesen werden, z.B. die dominante Auslegung der Handlungen und Absichten pharmazeutischer Unternehmen nach dem Profitmotiv (Attwell et al., 2017), die Verharmlosung von Kinderkrankheiten (Kruäger und Kruäger, 2015) oder deren positive Wertung als Reifeprozess immunologischer Entwicklung, in welchen Impfungen stoärend eingreifen (Mittring-Junghans et al., 2021) und Vorstellungen von Selbstverantwortung, Freiheit, Autonomie und persoänlicher Kontrolle hinsichtlich Gesundheit (Semle und Raab, 2021; Ward et al., 2017). Konkret wurden sechs augenfäallige Argumente und Konzepte herausgearbeitet:
1. Das Profitmotiv pharmazeutischer Unternehmen und Misstrauen in deren Absichten und Handlungen.
2. Die Präferenz von persönlichem Erfahrungswissen und Emotionen als Wahrheitsheuristik gegenüber fremden, logischen Faktenwissen, Expertenwissen und wissenschaftlicher Erkenntnis.
3. Die negative Wertung von Impfungen als eigentliche Gefahr verglichen mit (Kinder- )Krankheiten.
4. Die Bedeutsamkeit einer eigenen, freien, autonomen Meinung, sowie selbststaünd- igen Denkens und die Kritik an der Mehrheitsmeinung als Wert an sich.
5. Gesundheit als mit Staürke assoziierte, individuelle Persüonlichkeitseigenschaft. Die Aufwertung von Krankheiten als Training des Immunsystems und dem Standhalten von Krankheiten ohne schulmedizinische Hilfe als Stüarkebeweis.
6. Die Entscheidung (fuür oder) gegen Impfungen als Ausdruck individueller Freiheit.
Hauptanliegen dieser Arbeit war es jedoch basale Konzepte und kognitive Prototypen auszumachen, welche die oben genannten Konzepte von Impfkritikern konstituieren. Hierbei konnten drei wiederkehrende Konzepte bzw. Prototypen ausdifferenziert werden:
1. Prototypische Kausalitaüt: Ein Konzept von Kausalitüat, welches als Direkte Manipulation von Vorstellungen zeitlich-lokaler Korrelation, direktem Kontakt und menschlicher Agenten als strategisch vorgehende Verursacher geprüagt ist.
2. Purismus: Die Konzeption einer reinen, natuürlichen, schuützenswerten Innenseite vs. einer gefüahrlichen, kuünstlichen, korrumpierenden Außenseite. Gesund ist demnach was natuürlich und rein ist (Koürper, Geist, Natur), ungesund, was diese Natuürlichkeit und Reinheit zu verletzen droht (Menschlicher Einfluss).
3. Individualismus: Ein gedanklicher und argumentativer Fokus auf das (eigene) Individuum bzw. das eigene Kind und die hohe Stellung von Autonomie, Selbstverantwortung und Einzigartigkeit in der eigenen Identitaüt.
Die Herausarbeitung dieser basalen Konzepte erüoffnet zwei klare Vorteile. Zum einen ein tieferes Verstüandnis von impfkritischen Einstellungen, was neue Ansüatze zur Erhüohung der Impfbereitschaft bieten kann. Z.B. ein verstüarkter Fokus in Schullehrplüanen hin zu systemischen Kausaldenken. Oder die Entwicklung von Impfungen zur Selbstanwendung (Aktivitüat statt Passivitüat) mit Mitteln, die weniger gut als gewaltsame Grenzuüberschreitung konzeptualisiert werden koünnen (z.B. der Impfdrops oder das Impfnasenspray statt der Spritze). Zum anderen neue Erklaürungsansaütze fuür das Verstehen raütselhafter Zusammenhaünge. So erstaunt die Heterogenitüat der Protestteilnehmer gegen die Corona-Auflagen der Bundesregierung, wo Anhänger unterschiedlichster und teils gegensätzlicher Einstellungen zusammen marschieren, politisch links und rechts gerichtete, Impfkritiker, Regierungskritiker, Freiheitsrechtler, Reichsbürger, Arzte etc.19 Überschneidungen lassen sich aber durch die analysierten basalen Konzepte und damit in der grundlegenden Deutung von Realitat finden. Das Purismuskonzept kann z.B. politisch linksgerichtete, impfkritische und politisch rechtsgerichtete Personen verbinden. So konzeptualisieren rechtsgerichtete Einstellungen z.B. das eigene Land und die eigene Kultur haufig als reine, naturliche und schutzenswerte Innenseite, die gegen verunreinigende Einflusse einer andersartigen Außenseite verteidigt werden musste. Weitere Anschlusspunkte bietet ein ausgeprägter Individualismus, wenn unabhangig von anderen Einstellungen ein hoher identitärer Fokus auf Autonomie, Selbstverantwortung und Einzigartigkeit liegt, welche durch den Staat bzw. den Auflagen beschnitten werden. Besonders wenn diese Auflagen mit dem Verstäandnis prototypischer Kausalitaät als absichtsvolle Handlungen zum eigenen Nutzen gedeutet werden. Denn was Menschen emotional eint sind weniger kognitive Outputs in Form geteilter Argumente oder Handlungsweisen, sondern diesen zugrundeliegende, geteilte Vorstellungen daruäber wie die Welt ist und wie sie sein sollte, was sich mithilfe von metaphorischen Konzepten und Prototypen ergruändet wird.
Literatur
Attwell, K., Leask, J., Meyer, S. B., Rokkas, P., & Ward, P. (2017). Vaccine Rejecting Parents’ Engagement With Expert Systems That Inform Vaccination Programs. Journal of Bioethical Inquiry, 14 (1), 65-76. https://doi.org/10.1007/s11673- 016-9756-7
Breuer, F., Dieris, B., & Muckel, P. (2019). Reflexive Grounded Theory. Eine Einführung in die Forschungspraxis. Wiesbaden: Springer VS.
Festinger, L. (1978). Theorie der kognitiven Dissonanz. Bern, Stuttgart & Wien: Huber.
Glaser, B. G. (1998). Doing Grounded Theory: Issues and Discussions. Mill Valley, CA: Sociology Press.
Hampe, B. (2005). Image Schemas in Cognitive Linguistics: Introduction. In B. Hampe & J. Grady (Hrsg.), From Perception to Meaning. Image Schemas in Cognitive Linguistics (S. 1-14). Berlin: Mouton de Gruyter. https: //doi.org/10. 1515 / 9783110197532.0.1
Harvey, A. M., Thompson, S., Lac, A., & Coolidge, F. L. (2019). Fear and Derision: A Quantitative Content Analysis of Provaccine and Antivaccine Internet Memes. Health Education & Behavior, 46 (6), 1012-1023. https : //doi .org/ 10 . 1177 / 1090198119866886
Johnson, M. (1987). The Body in the Mind. Chicago: The University of Chicago Press.
Krüger, K., & Krüger, J. O. (2015). „Sich selber den Kopf zerbrechen“ - Eine qualitative Studie zu elterlicher Impfskepsis. ZFA - Zeitschrift für Allgemeinmedizin, 91 (3), 106-110. https://doi.org/10.3238/zfa.2015.0106-0110
Kunze, U., & Groman, E. (2019). Impfen ist nicht nur Kindersache! Wiener Medizinische Wochenschrift, 169 (9-10), 203-214. https://doi.org/10.1007/s10354-017- 0598-7
Lakoff, G. (1989). Some Empirical Results about the Nature of Concepts. Mind & Language, 4 (1-2), 103-129. https://doi.org/10.1111/j.1468-0017.1989.tb00244.x
Lakoff, G. (1990). Women, Fire and Dangerous Things. What Categories Reveal About the Mind. Chicago & London: University of Chicago Press.
Lakoff, G. (1993). The Contemporary Theory of Metaphor. In A. Ortony (Hrsg.), Metaphor and Thought (S. 202-251). Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/cbo9781139173865.013
Lakoff, G., & Johnson, M. (2003). Metaphors We Live by. Chicago & London: University of Chicago Press.
Langacker, R. (2008). Cognitive Grammar: A Basic Introduction. New York: Oxford University Press.
Martin, E. (1994). Flexible Bodies: Tracking Immunity in American Culture From the Days of Polio to the Age of Aids. Boston: Beacon Press.
Mittring-Junghans, N., Holmberg, C., Witt, C. M., & Teut, M. (2021). Thoughts, Beliefs and Concepts Concerning Infectious Childhood Diseases of Physicians Practicing Homeopathic, Anthroposophic and Conventional Medicine - A Qualitative Study. BMC Complementary Medicine and Therapies, 21 (1). https : //doi.org/10.1186/s12906-021-03216-2
Realo, A., Koido, K., Ceulemans, E., & Allik, J. (2002). Three Components of Individualism. European Journal of Personality, 16 (3), 163-184. https://doi.org/10. 1002/per.437
Semle, R., & Raab, M. (2021). ”Da kann doch kein Mensch gesund bleiben”. Gesundheitsbezogene Verschwoürungstheorien in subjektiven Theorien uüb er Gesundheit und Krankheit - eine Untersuchung mit der Heidelberger Struktur- Lege-Technik. Forum: Qualitative Social Research, 22 (1). https://doi.org/10. 17169/FQS-22.1.3534
Sontag, S. (2013). Illness as Metaphor and AIDS and its Metaphors. New York: Picador.
Strubing, J., Hirschauer, S., Ayaß, R., Krähnke, U., & Scheffer, T. (2018). Gütekriterien qualitativer Sozialforschung. Ein Diskussionsanstoß. Zeitschrift für Soziologie, 47 (2), 83-100. https://doi.org/10.1515/zfsoz-2018-1006
Tversky, A., & Kahneman, D. (1974). Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases. Science, 185 (4157), 1124-1131. https://doi.org/10. 1126 / science. 185. 4157.1124
Ward, P. R., Attwell, K., Meyer, S. B., Rokkas, P., & Leask, J. (2017). Risk, Responsibility and Negative Responses: A Qualitative Study of Parental Trust in Childhood Vaccinations. Journal of Risk Research, 21 (9), 1117-1130. https: //doi.org/10.1080/13669877.2017.1391318
Weber, M. (1922). Gesammelte Aufsüatze zur Wissenschaftslehre. Tuäbingen: Verlag von J.B.C. Mohr (Paul Siebeck).
Wood, E. M. (1972). Mind and Politics: An Approach to the Meaning of Liberal and Socialist Individualism. Berkeley, Los Angeles & London: University of California Press.
[...]
1 https://www.who.int/news-room/spotlight/ten-threats-to-global-health-in-2019 (Zugriff: 17.03.2021)
2 So will sich nach einer Befragung des Instituts für Demoskopie Allensbach vom Januar 2021 knapp 20% der deutschen Bevölkerung nicht gegen SARS-CoV-2 impfen lassen, weitere 20% sind unentschlossen. Siehe FAZ https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/allensbach-umfrage-viele- deutsche-zweifeln-an-der-impfstrategie-17167579.html (Zugriff: 28.03.2021).
3 Der folgende Abschnitt ist zu einem großen Teil einer meiner früheren Seminararbeiten entnommen, die bei Wunsch vorgelegt werden kann.
4 Für eine UJbersicht siehe (Lakoff, 1990: 39ff).
5 Link zu Abbildung 3: http://the-creative-business.com/de/chairs-in-art-from-velazquez-to-ai- weiwei - © Public Domain (Zugriff: 02.07.2025)
6 Link zu Artikel 1: https://www.stadtlandmama.de/content/gastbeitrag-darum-lasse-ich-mein-kind- nicht-impfen (Zugriff: 17.03.2021).
7 Link zu Artikel 2: https://www.stadtlandmama.de/content/gastbeitrag-einer-kinderaerztin-darum- ist-es-so-wichtig-dein-kind-zu-impfen (Zugriff: 17.03.2021).
8 Besonders Telegram sticht als stark genutztes Online-Medium hervor. Die Telegram-Gruppe Freie Impfentscheidungen gegen Zwangsmaßnahmen z.B. hat 12291 Abonnenten (Stand: 17.03.2021 8:47), eine Zahl, die allein verglichen mit Anfang Februar um etwa 2000 zunahm. Knapp alle 20 Minuten wird hier ein Beitrag gepostet, häufig ohne nächtliche Unterbrechung.
9 Im Sinne von Leon Festinger, wonach kognitive Elemente zueinander in einem als unangenehm empfundenen Widerspruch stehen können, den Menschen z.B. durch Umdeutungen versuchen aufzulösen (Festinger, 1978).
10 Tatsächlich ist das eigene Kinderwohl ein gemeinsames Interesse impfkritischer und impfbefürwortenden Eltern, was eine, für derart emotionale und polarisierte Diskurse seltene, Diskussionsgrundlage bietet.
11 Ausdruck wirklicher Freiheit scheint jedoch nur die Entscheidung gegen Impfungen, siehe Abschnitt 5.2.4.
12 Zur Verfügbarkeitsheuristik siehe (Tversky und Kahneman, 1974).
13 Gesundheit gilt als aufrechtzuerhaltender Normalzustand und nicht als herbeizuführende Wirkung. Wirkungsstatus haben gemeinhin nur unerwuünschte Abweichungen vom Gesundheitszustand und Ruückfuührungen eines Krankheitszustands in den Gesundheitszustands.
14 Purismus leitet sich vom lateinischen purus ab, was rein bedeutet.
15 Wobei Reinheit ohnehin häufig mit Schwächlichkeit, Zartheit und Schönheit assoziiert wird, z.B. bei Jungfrauen, die meisten Darstellungen von Prinzessinnen in Märchen sind hierfür gute Beispiele. Jungfraäulichkeit an sich ist im puristischen Sinne ein damenhafter, erstrebenswerter, weil reiner Zustand, den es vor menschlichem Einfluss zu schuätzen gilt. Mit dem Jungfernblut als symbolstarke Erfahrung von Unreinheit und verletzender Grenzuäberschreitung.
16 Hier spielt sicherlich auch das Purismuskonzept eine Rolle, welches einerseits die Innenseite als exklusiv schutzbedürftig einer gefährlichen Außenseite gegenüberstellt und andererseits die Vorstellung in weite Ferne rückt, die Innenseite künnte umgekehrt der Außenseite schaden, denn die Innenseite ist ihrer Konzeption nach rein und gut, ohne büose Absicht.
17 Die einzige Form von Kontrolle ist hier die Entscheidung fuür oder gegen die Impfung, wobei die Entscheidung gegen die Impfung die eigene Kontrolle am sichtbarsten hervorhebt.
18 Nicht alle homüoopathischen oder anthroposophischen Mediziner lehnen Impfungen strikt ab, stehen diesen aber weit hüaufiger kritisch gegenuüber als konventionelle Mediziner. Es macht den Anschein als werde die Einzigartigkeit und Vielfalt menschlicher Persoünlichkeit analogisch auf den biologischen Organismus des Menschen uübertragen. In der Behandlung stehen Individualitaüt, Freiheit, Mitspracherecht und Wohlgefuühl des Patienten üahnlich einer Konsumentenbeziehung weit mehr im Vordergrund als bei konventionellen Behandlungen.
19 Deutschlandfunk Artikel Wer marschiert da zusammen?: https://www.deutschlandfunk.de/corona- demonstrationen-wer-marschiert-da-zusammen-100.html (Zugriff: 28.03.2021)
- Quote paper
- Marco Hauptmann (Author), 2021, Basale Konzepte impfkritischer Einstellungen. Eine Qualitative Analyse von Online-Kommentaren, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1597581