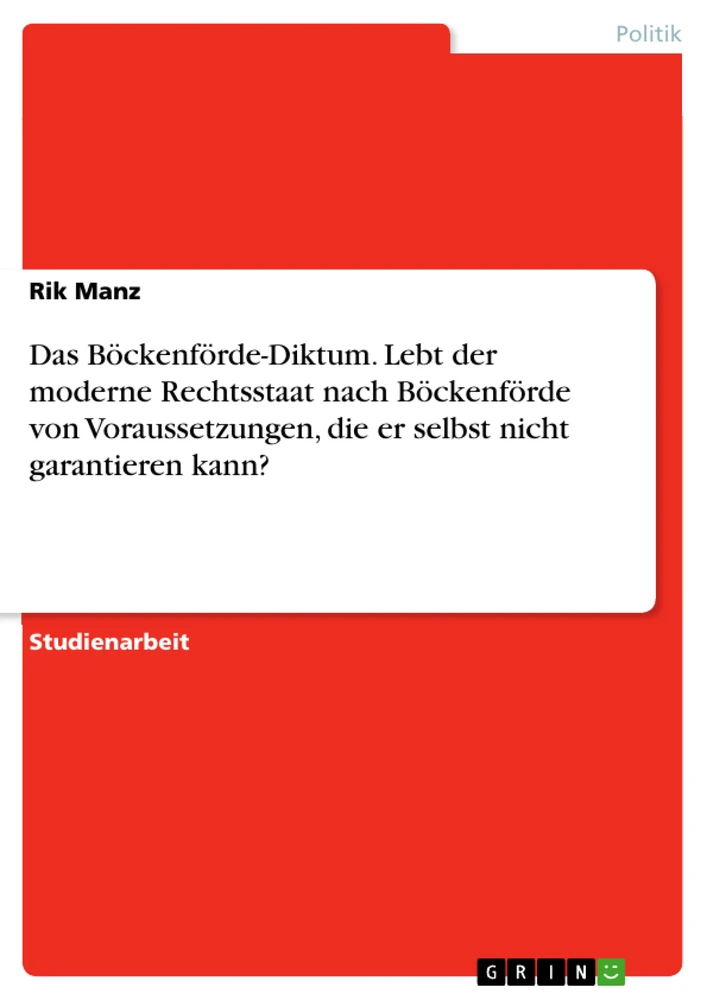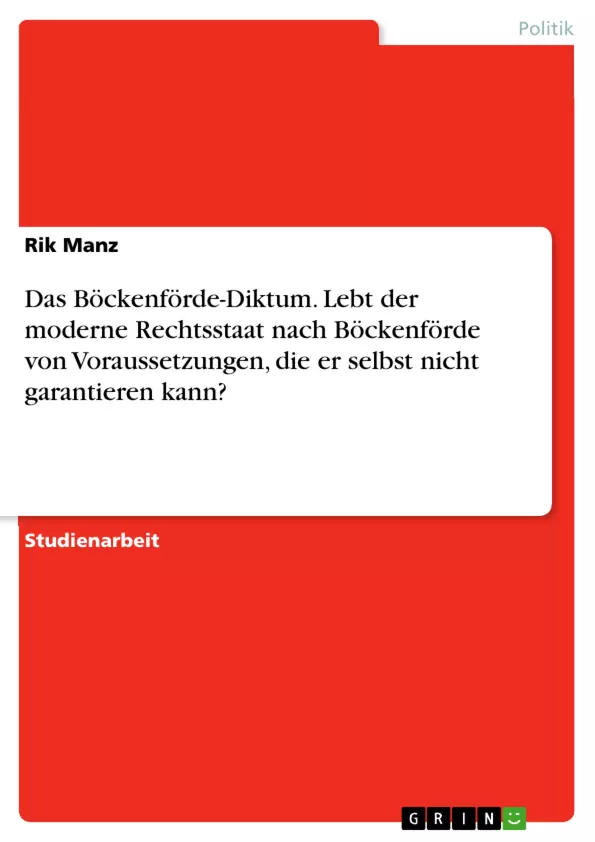In der Wissenschaft bezeichnet man ein Diktum als einen Ausspruch, welcher von großer Bedeutsamkeit ist. Das Diktum "Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann." von Ernst-Wolfgang Böckenförde wurde im Laufe der letzten Jahrzehnte immer wieder aufgenommen und diskutiert. Es verschaffte dem späteren Richter am Bundesverfassungsgericht eine weitreichende Bekanntheit und ist die wohl häufigste zitierte Textpassage seiner Veröffentlichungen. Böckenförde selbst fand in einem Vortrag, welchen er am 26. Oktober 2006 in der Carl-Friedrich-von-Siemens-Stiftung hielt, abschließende Worte und verwies erneut auf die Aktualität des Diktums.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 1.1 Leitfrage der Arbeit
- 1.2 Verfahrensweise der Arbeit
- 2. Das Böckenförde-Diktum
- 2.1 Inhalt
- 2.1.1 Bindende Kräfte des Staates
- 2.1.2 Das große Wagnis des Staates
- 2.1.3 Bindende Kräfte durch Zwang
- 2.1.4 Der Staat als Erfüllungsgarant eudämonistischer Lebenserwartungen
- 2.1.5 Verweis auf Hegel
- 2.1.6 Glaube als Chance der Freiheit
- 3. Theoretisches Grundkonzept
- 3.1 Entstehung des Staates nach Böckenförde
- 3.1.1 Verfassungsgeschichtliche Aspekte
- 3.1.2 Der Staat als Einheit
- 3.1.2.1 Friedenseinheit
- 3.1.2.2 Entscheidungseinheit
- 3.1.2.3 Machteinheit
- 3.2 Dimensionen des Freiheitsbegriffes
- 3.2.1 Äußere Freiheit
- 3.2.2 Inhaltliche Freiheit
- 3.3 Schützende und stützende Funktion des Staates
- 4. Fazit und abschließende Bemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Ernst-Wolfgang Böckenfördes Diktum „Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann.“ Ziel ist es, das sogenannte Böckenförde-Dilemma zu verstehen und zu analysieren, welche Voraussetzungen Böckenförde für den freiheitlichen, säkularisierten Staat sieht und welche Funktionen er dem modernen Rechtsstaat zuschreibt. Die Arbeit beleuchtet den Einfluss des christlichen Glaubens auf die Stabilität des Staates und die Herausforderungen, die aus der Säkularisierung resultieren.
- Das Böckenförde-Diktum und seine Bedeutung für den modernen Rechtsstaat
- Die bindenden Kräfte des Staates und die Rolle des christlichen Glaubens
- Das „große Wagnis“ des säkularisierten Staates und die Frage nach alternativen bindenden Kräften
- Die Dimensionen des Freiheitsbegriffs bei Böckenförde
- Die schützenden und stützenden Funktionen des Staates im Kontext von Freiheit und Säkularisierung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Dieses einführende Kapitel stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Gültigkeit des Böckenförde-Diktats im modernen Rechtsstaat. Es skizziert die Vorgehensweise der Arbeit, die sich auf eine detaillierte Analyse ausgewählter Textstellen Böckenfördes konzentriert, um das Böckenförde-Dilemma zu verstehen. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem Verständnis von "Voraussetzungen" des freiheitlichen, säkularisierten Staates und den von Böckenförde zugeschriebenen Funktionen des modernen Rechtsstaates, insbesondere im Kontext des schwindenden Einflusses des Christentums in der Bundesrepublik Deutschland.
2. Das Böckenförde-Diktum: Dieses Kapitel analysiert das Böckenförde-Diktum im Detail. Es untersucht die verwendeten Formulierungen und die dahinterliegenden Prinzipien und theoretischen Konzepte. Die Analyse konzentriert sich auf die bindenden Kräfte des Staates, die Bedeutung eines einheitlichen Ethos und die Rolle des christlichen Glaubens. Weiterhin wird das „große Wagnis“ des modernen Staates beleuchtet, das darin besteht, Freiheitlichkeit zu erhalten, obwohl der Staat die dafür notwendigen Voraussetzungen nicht selbst garantieren kann. Die Möglichkeiten und Grenzen staatlichen Zwangs zur Sicherung dieser Voraussetzungen werden diskutiert. Schließlich wird der Staat als Erfüllungsgarant eudämonistischer Lebenserwartungen untersucht und die möglichen Schwachstellen dieses Ansatzes beleuchtet.
3. Theoretisches Grundkonzept: Dieses Kapitel erörtert verschiedene Konzepte Böckenfördes, die für das Verständnis seines Diktats unerlässlich sind. Es behandelt die Entstehung des Staates nach Böckenförde, insbesondere die verfassungsgeschichtlichen Aspekte und die Rolle des christlichen Glaubens. Die Analyse der vom Staat gebildeten Einheiten (Friedens-, Entscheidungs- und Machteinheit) sowie eine Auseinandersetzung mit dem Freiheitsbegriff (äußere und inhaltliche Freiheit) und den schützenden und stützenden Funktionen des Staates runden das Kapitel ab. Die Frage, inwieweit der Staat richtungsweisend handeln darf, ohne das Staatsziel Freiheit zu gefährden, steht im Mittelpunkt der Überlegungen.
Schlüsselwörter
Böckenförde-Diktum, Säkularisierung, freiheitlicher Staat, bindende Kräfte, christlicher Glaube, Ethos, großes Wagnis, Freiheit, Staatsfunktionen, Rechtsstaat, Homogenität der Gesellschaft, moralische Substanz.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt des Inhaltsverzeichnisses?
Das Inhaltsverzeichnis gliedert sich in vier Hauptpunkte: Einführung, Das Böckenförde-Diktum, Theoretisches Grundkonzept, und Fazit und abschließende Bemerkungen. Die Einführung umfasst die Leitfrage und Verfahrensweise der Arbeit. Das Böckenförde-Diktum behandelt den Inhalt des Diktums, einschließlich der bindenden Kräfte des Staates, das große Wagnis des Staates, bindende Kräfte durch Zwang, der Staat als Erfüllungsgarant eudämonistischer Lebenserwartungen, den Verweis auf Hegel und den Glauben als Chance der Freiheit. Das theoretische Grundkonzept beinhaltet die Entstehung des Staates nach Böckenförde (mit verfassungsgeschichtlichen Aspekten und der Staat als Einheit mit Friedens-, Entscheidungs- und Machteinheit), die Dimensionen des Freiheitsbegriffes (äußere und inhaltliche Freiheit), sowie die schützende und stützende Funktion des Staates.
Was sind die Zielsetzung und Themenschwerpunkte der Arbeit?
Die Arbeit untersucht Ernst-Wolfgang Böckenfördes Diktum und zielt darauf ab, das Böckenförde-Dilemma zu verstehen und zu analysieren, welche Voraussetzungen Böckenförde für den freiheitlichen, säkularisierten Staat sieht und welche Funktionen er dem modernen Rechtsstaat zuschreibt. Sie beleuchtet den Einfluss des christlichen Glaubens auf die Stabilität des Staates und die Herausforderungen, die aus der Säkularisierung resultieren. Die Themenschwerpunkte umfassen das Böckenförde-Diktum und seine Bedeutung, die bindenden Kräfte des Staates und die Rolle des christlichen Glaubens, das "große Wagnis" des säkularisierten Staates, die Dimensionen des Freiheitsbegriffs bei Böckenförde, sowie die schützenden und stützenden Funktionen des Staates.
Was behandelt das Kapitel "Einführung"?
Das einführende Kapitel stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Gültigkeit des Böckenförde-Diktats im modernen Rechtsstaat. Es skizziert die Vorgehensweise der Arbeit, die sich auf eine detaillierte Analyse ausgewählter Textstellen Böckenfördes konzentriert, um das Böckenförde-Dilemma zu verstehen. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem Verständnis von "Voraussetzungen" des freiheitlichen, säkularisierten Staates und den von Böckenförde zugeschriebenen Funktionen des modernen Rechtsstaates, insbesondere im Kontext des schwindenden Einflusses des Christentums in der Bundesrepublik Deutschland.
Was wird im Kapitel "Das Böckenförde-Diktum" analysiert?
Dieses Kapitel analysiert das Böckenförde-Diktum im Detail. Es untersucht die verwendeten Formulierungen und die dahinterliegenden Prinzipien und theoretischen Konzepte. Die Analyse konzentriert sich auf die bindenden Kräfte des Staates, die Bedeutung eines einheitlichen Ethos und die Rolle des christlichen Glaubens. Weiterhin wird das „große Wagnis“ des modernen Staates beleuchtet, das darin besteht, Freiheitlichkeit zu erhalten, obwohl der Staat die dafür notwendigen Voraussetzungen nicht selbst garantieren kann. Die Möglichkeiten und Grenzen staatlichen Zwangs zur Sicherung dieser Voraussetzungen werden diskutiert. Schließlich wird der Staat als Erfüllungsgarant eudämonistischer Lebenserwartungen untersucht und die möglichen Schwachstellen dieses Ansatzes beleuchtet.
Was wird im Kapitel "Theoretisches Grundkonzept" erörtert?
Dieses Kapitel erörtert verschiedene Konzepte Böckenfördes, die für das Verständnis seines Diktats unerlässlich sind. Es behandelt die Entstehung des Staates nach Böckenförde, insbesondere die verfassungsgeschichtlichen Aspekte und die Rolle des christlichen Glaubens. Die Analyse der vom Staat gebildeten Einheiten (Friedens-, Entscheidungs- und Machteinheit) sowie eine Auseinandersetzung mit dem Freiheitsbegriff (äußere und inhaltliche Freiheit) und den schützenden und stützenden Funktionen des Staates runden das Kapitel ab. Die Frage, inwieweit der Staat richtungsweisend handeln darf, ohne das Staatsziel Freiheit zu gefährden, steht im Mittelpunkt der Überlegungen.
Welche Schlüsselwörter werden in der Arbeit verwendet?
Die Schlüsselwörter sind: Böckenförde-Diktum, Säkularisierung, freiheitlicher Staat, bindende Kräfte, christlicher Glaube, Ethos, großes Wagnis, Freiheit, Staatsfunktionen, Rechtsstaat, Homogenität der Gesellschaft, moralische Substanz.
- Arbeit zitieren
- Rik Manz (Autor:in), 2019, Das Böckenförde-Diktum. Lebt der moderne Rechtsstaat nach Böckenförde von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1597635