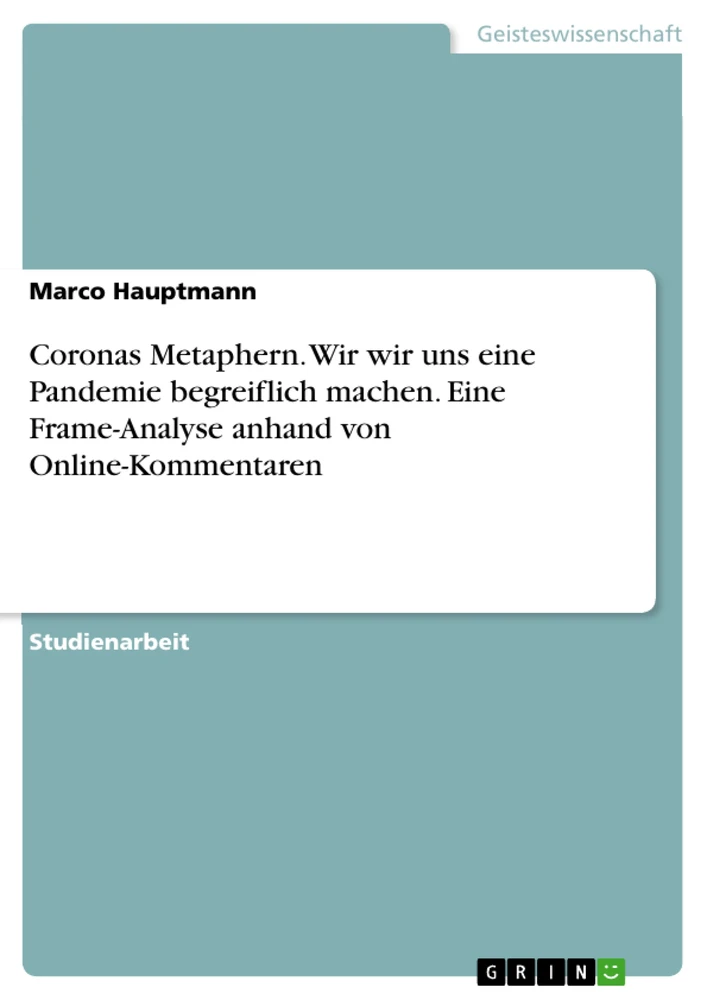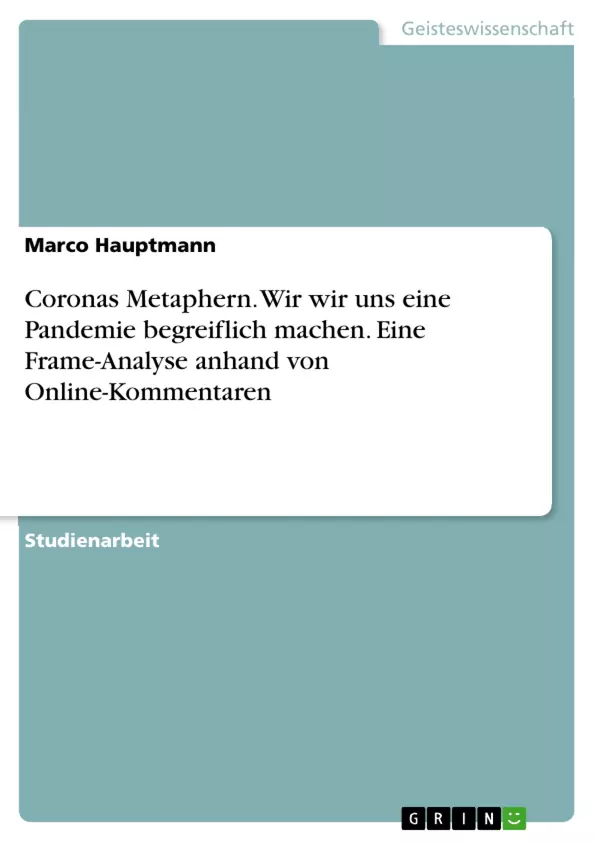Ziel dieser Arbeit ist es anhand von Onlinekommentaren Unterschiede in Metaphern, Erklärungen, Argumenten, Denkweisen und Interessen in der deutschen Bevölkerung zwischen denjenigen, welche die verhängten Maßnahmen befürworten und beibehalten wollen und denjenigen, welche diese Maßnahmen ablehnen und deren Aufhebung fordern, explorativ herauszuarbeiten.
Um dieser semantischen Analyse gerecht zu werden wird unter Bezug auf die kognitive Semantik in einem theoretischen Teil zunächst aufgearbeitet, was unter Bedeutung verstanden wird. In Sektion 2.1 werden hierzu für die kognitive Semantik grundlegende Gedanken gesetzt. Auf dieser Basis wird die kognitive Semantik in Sektion 2.2 in ihren Grundzügen vorgestellt. Im darauf folgenden praktischen Teil wird am Fallbeispiel eines Online-Artikels Kommentare von Befürwortern und Gegnern der Maßnahmen analysiert. Die verwendete Stichprobe und Methoden der Frameanalyse und konstanten Vergleichs werden in Sektion 3 und 4 erläutert. Sektion 5 geht kurz auf den Artikel und dessen Frames ein, bevor in Sektion 6 und 7 sieben aus den Kommentaren herausgearbeitete Denktypen von Befürwortern und Gegner der Maßnahmen präzisiert werden. Sektion 8 schließt mit einer Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung 1
2 Theorie 2
2.1 Grundlagen
2.2 KognitiveSemantikundkonzeptuelleMetaphern
2.3 Schlussfolgerung
3 Daten
4 Methode
5 Artikel als Frame
6 Befürworter der Maßnahmen
6.1 Der Angstgeleitete
6.2 Der Gesellschaftskritiker
6.3 Der Pragmatiker
7 Gegner der Maßnahmen
7.1 DerRechtsverletzte
7.2 DerRestaurator
7.3 Der Regierungskritiker
7.4 DerLeugner
8 Schlussdiskussion
Literatur
1 Einleitung
Wie fragil ,Normalität’ doch ist wird einem selten klarer als dieser Tage. Als im November 2019 in der chinesischen Provinzstadt Wuhan dem neuartigen Coronavirus SARS- CoV-2 vermutlich von einem Wildtiermarkt aus der Sprung auf den Menschen gelingt, war noch nicht abzusehen, welche einschneidenden Konsequenzen dies für die globalisierte Welt haben würde. Einige Monate spater war man auf unliebsame Weise klüger. Der Vernetztheit der modernen Welt geschuldet trugen Tourismus, Produktionsketten und sonstige erdumspannende Kontakte das Virus, das zu der Lungenkrankheit Covid- 19 mit Krankheitsverlaufen variabler Schwere führt, in die Welt hinaus. Herrschte lange Zeit Optimismus die Ausbreitung des Virus kontrollieren und eine Pandemie abwenden zu koünnen, mussten mehr und mehr Staaten Ende Februar, Anfang Müarz eingestehen, dass Infektionsketten nicht mehr nachverfolgbar waren und man jeweils auf Epidemien zusteuerte. Am 12. Maürz erklaürt die Weltgesundheitsorganisation die Ausbreitung von Covid-19 zur Pandemie. Am selben Tag ruft die deutsche Bundesregierung die Bevoülkerung auf Kontakte weitgehend zu vermeiden. Ein Aufruf, der schließlich am 22. Maürz zu einem ahndbaren Versammlungsverbot verschaürft wird und das soziale Leben fuür viele in ungekannter Weise einschraünkte. Zum Stand des 26.04.2020 sind weltweit annaühernd 3 Mio. Krankheitsfaülle gemeldet mit mehr als 200.000 Toten, wovon 156.000 Meldungen und 5.900 Tote auf Deutschland entfallen.1
Das haüufig nur Coronavirus“ oder schlicht Corona“ genannte Virus hat nicht nur das üoffentliche und wirtschaftliche Leben im Griff, sondern auch die Kommunikation der Gesellschaft vereinnahmt. Am 17. Maürz sendete die Tagesschau erstmals nur Nachrichten zu Corona. Saümtliche Nachrichtenmagazine und -webseiten richteten Ressorts speziell fuür Corona ein und aktualisieren seit Wochen in online Live-Tickern relevante Geschehnisse rund ums Virus. Spiegel online verüoffentlichte seit Januar uüber 3000 Artikel zu Corona, im Schnitt 30 Artikel pro Tag. Hatten die ersten Artikel Anfang Januar auf Spiegel online noch Kommentarzahlen im einstelligen Bereich, werden seit Maürz unter Artikeln zu Corona regelmaüßig mehr als 500 Nutzerkommentare geschrieben. Der Corona-Liveticker von Focus online kann, Stand 26.04.2020, 8500 Kommentare vorweisen, Tendenz steigend. Statistische Webseiten, welche das aktuelle Geschehen in Zahlen und Grafiken abbilden, verbuchen astronomischen Traffic.2 Es ist schwer eine Ecke des Internet zu finden oder ein alltaügliches Gespraüch zu fuühren, in der oder dem Corona keine Erwüahnung findet oder nicht impliziert ist. Aufgrund des unmittelbaren und starken Einflusses auf das Leben der Menschen scheint die komplette Kommunikation des Gesellschaftssystems auf dieses Thema umgestellt.
Corona ist in kürzester Zeit fester Bestandteil der Lebenswelt geworden bzw. hat als Krise der Lebenswelt diese umstrukturiert. Alltagsroutinen sind gebrochen, Wünschenswertes unter Strafe gestellt. Individualistische Denkweisen und Handlungsziele sollen kollektivistischen weichen. Ein globales Krisenexperiment, ein Bruch der sozialen Wirklichkeit. Soziologisch interessant ist wie Menschen mit diesem Bruch umgehen. Ignoranz wird zunehmend schwieriger, wer in Handlungsgewohnheiten verharrt muss mit Sanktionen rechnen, wer kommunizieren will, muss damit rechnen uüb er Corona kommunizieren zu muüssen. Man muss sich mit der Situation auseinandersetzen, muss Verhaltensüanderungen uüb ernehmen oder bewusst ablehnen, muss sich kommunikativ verorten, eine Meinung bilden und damit rechnen auf andere Meinungen zu treffen. Eine Konfliktlinie verlaüuft dabei entlang der Einstellung zu den am 22. Maürz verhaüngten Maßnahmen, die eine Schließung jeglicher Betriebe in denen koürperliche Nüahe unabdingbar“ ist, sowie strenge Kontaktbeschrüankungen verordneten.3 Ziel dieser Arbeit ist es anhand von Onlinekommentaren Unterschiede in Metaphern, Erklaürungen, Argumenten, Denkweisen und Interessen in der deutschen Bevoülkerung zwischen denjenigen, welche diese Maßnahmen befuürworten und beibehalten wollen und denjenigen, welche diese Maßnahmen ablehnen und deren Aufhebung fordern, explorativ herauszuarbeiten.
Um dieser semantischen Analyse gerecht zu werden wird unter Bezug auf die kognitive Semantik in einem theoretischen Teil zunüachst aufgearbeitet, was unter Bedeutung verstanden wird. In Sektion 2.1 werden hierzu fuür die kognitive Semantik grundlegende Gedanken gesetzt. Auf dieser Basis wird die kognitive Semantik in Sektion 2.2 in ihren Grundzuügen vorgestellt. Im darauf folgenden praktischen Teil wird am Fallbeispiel eines Online-Artikels Kommentare von Befuürwortern und Gegnern der Maßnahmen analysiert. Die verwendete Stichprobe und Methoden der Frameanalyse und konstanten Vergleichs werden in Sektion 3 und 4 erlaüutert. Sektion 5 geht kurz auf den Artikel und dessen Frames ein, bevor in Sektion 6 und 7 sieben aus den Kommentaren herausgearbeitete Denktypen von Befuürwortern und Gegner der Maßnahmen prüazisiert werden. Sektion 8 schließt mit einer Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse.
2 Theorie
2.1 Grundlagen
Bedeutung kann nicht fuür sich stehen. Bedeutung benoütigt einen Beobachter und ein Substrat, das der Beobachter nach eigenlogischen Selektionsmechanismen mit Bedeutung versieht (Leydesdorff, 2011: 2ff). Als Ausgangspunkt bietet sich insofern Luh- manns Unterscheidung von System (Beobachter) und Umwelt (Substrat) an (Luhmann, 1991: 25). Diese Unterscheidung greift jedoch zu kurz, da sie den Beobachter als dessen eigenes Substrat in der Selbstbeobachtung unterschlagt. Dem begegnet Luhmann im Begriff der Welt. Welt ist die Einheit der Unterscheidung von System und Umwelt als geschlossene Gesamtheit aller möglichen Sinnverweise eines Systems (Luhmann, 1991: 105ff). Sinn scheint Luhmann jedoch sozialen und psychischen Systemen vorbehalten zu sein (Luhmann, 1991: 92). Um sich nicht auf zwei Systemarten einzuschraönken soll Welt hier als geschlossene Gesamtheit aller möoglichen Relationen eines Systems, mit sich und seiner Umwelt, definiert sein. Die Gesamtheit aller möoglichen Relationen kann man folglich als Wirklichkeit bezeichnen. Ein System relationiert sich uöber gesonderte Kanaöle, z.B. Sinnesorgane, mit der Wirklichkeit und kreiert so seine Welt.
Diese Welt bietet eine endlose Zahl potentieller Differenzen. Uö ber seine Kanöale selektiert ein System bestimmte Differenzen und bildet diese intern ab (Bateson, 1987: 321). Ein System erzeugt auf Basis externer Differenzen interne Differenzen. Es erzeugt einen Systemzustand auf Basis eines Weltzustands. Diese Abbildung von Differenzen, die Abbildung von Welt innerhalb ein Systems, auf welche Systemoperationen operieren, ist Wahrnehmung als eigenlogische Systemoperation mit der inhaörenten Leitselektion Gleich/Verschieden. Welt bietet eine Vielzahl von Differenzen, welche davon aber tatsaöchlich als different und welche als gleich wahrgenommen werden, obliegt der Eigenlogik, also Selektions- und Operationsweise, des Systems.
Information ist die Wahrnehmung einer Differenz oder anders ausgedruöckt: Information ist eine fuör die Operationsweise des Systems aufbereitete Differenz der Welt. A difference [of the world] which makes a difference [within the system]“ (Bateson, 1987: 229). Wahrnehmung versorgt das Systems mit Differenzen als Information und macht es dadurch reagibel auf selektierte Weltzustöande. Komplexitöat steigernd kann die Leitselektion Gleich/Verschieden auf Information angewandt werden, um Differenzen zu differenzieren (Bateson, 1987: 324). Die visuelle Differenz Hell/Dunkel wird unterschieden von der auditiven Differenz Laut/Leise und beide wiederum von der thermozeptischen Differenz Kalt/Warm. Je mehr ein System unterscheiden kann, auch rekursiv als Unterscheidung von Unterscheidungen usw., desto mehr Operationsmoöglichkeiten kann es als Reaktion auf Unterschiedenes ausbilden. Ob alle Operationsmöoglichkeiten ausgebildet werden ist eine andere Frage, aber wahrgenommene Differenzen sind eine notwendige Voraussetzung fuör Differenzen im Systemverhalten. Was gleich wahrgenommen wird kann nicht systematisch unterschiedlich behandelt werden.
Informationen werden zu komplexeren Differenzen integriert. Der Sehsinn z.B. ist ein Integral aus von Kanaölen (Zapfen, Stöabchen) abgebildeten Differenzen, wie Hell/Dunkel, Rot/Nicht-Rot, Blau/Nicht-Blau, Gruön/Nicht-Gruön (Meister und Tessier-Lavigne, 2013), die integriert werden, um Horizontale-Orientierung/Keine-Horizontale-Orientierung, Vertikaler-Strich/Kein-Vertikaler-Strich, Vordergrund/Hintergrund etc. zu differenzieren (Gilbert, 2013) usw. bis schließlich Objekte differenziert werden.
Der Sprung von Information zu Bedeutung ist parallel zum Sprung von Wahrnehmung zu Erfahrung. Erfahrung kann als integrierte Wahrnehmung aller verfügbarer Kanäle bezeichnet werden. Erfahrung ist das sich im Zuge ständig neuer Informationen ständig wandelnde Endprodukt aller, innerhalb eines eigenlogischen, integrativen Zeitfensters (Herzog et al., 2016), verarbeiteter Information wie Sehen, Hören, Tasten, Schmecken, Riechen, Kinösthetik etc. und Information interner Differenzen wie Angenehm/Unangenehm. Aufmerksamkeit als Differenz Relevant/Irrelevant selektiert wiederum aus der Erfahrung dasjenige, an das je nach Zielausrichtung des Systems (Wuönsche, Hoffnungen, Verlangen, Interessen etc.) Systemoperationen angeschlossen werden sollen. Solche Distinktionseinheiten, die innerhalb von Erfahrung als Einheit von Nicht-Einheit oder als Figur von Grund (Arnheim, 2000: 223ff) unterschieden werden koönnen, sind Gestalten. Eine Gestalt ist eine Erfahrungseinheit. Dasjenige, was im Gesamtbild der Erfahrung als eigenstaöndiges Ganzes erfahren werden kann (Arnheim, 2000). Basale Gestalten wie der Kreis sind insofern Grundkategorien von Erfahrung.
Erfahrung wird inkorporiert. Strukturen, die Information erzeugen und weiterleiten, auf deren Basis wiederholte oder intensive Systemoperationen selektiert werden, werden verstaörkt. Strukturen, die den Aktivitaötswettbewerb verlieren, die fruöh in der Verarbeitung z.B. durch laterale Hemmung inhibiert werden, oder irrelevante‘ Information erzeugen, z.B. ein schlechtes Argument, an das kein Verhalten angeschlossen wird, werden nicht verstaörkt und bilden sich zuruöck (Hebb, 2002); Desimone und Duncan, 1995; Lakoff, 2014). Je fruöher Information in der Verarbeitung gehemmt bzw. irrele- vant‘ wird, desto seltener werden diese Information erzeugende Strukturen und deren Nachfolgestrukturen in Anspruch genommen, desto seltener in Netzwerke eingebunden, desto seltener einen Beitrag zu Erfahrung leisten.
Eine zentrale Einsicht ist nun, dass Sprache systemintern keinen Sonderstatus hat. Die bedeutungstragendenden Woörter einer Sprache koönnen abstrakt, gar eine eigene Rea- litaötssphaöre belegend erscheinen. In der internen Verarbeitung des Menschen jedoch werden Woörter nicht anders behandelt als andere Informationen. Woörter sind visuelle Information als differenzierbares Zeichen, auditorische Information als differenzierbarer Laut und motorische Information als differenzierbares, Laut erzeugendes motorisches Skript, zeitlich korreliert mit anderen visuellen, auditorischen, kinöasthetischen, evalua- tiven etc. Informationen, die integriert eine Erfahrung bilden.
Tritt ein bestimmter Laut mit einem bestimmten Zeichen wiederholt zusammen auf, werden zum einen die diese Information erzeugenden Strukturen verstaörkt und zum anderen Verbindungen zwischen jenen Strukturen, die Laut und Zeichen differenzieren, gebildet, sodass Aktivität der einen Struktur Einfluss auf die Aktivität der anderen Struktur nimmt. Es entsteht ein Netzwerk gemeinsamer Aktivität (Hebb, 2002). Tritt Aktivität in diesem Netzwerk, das ein Wort bildet, wiederholt zusammen mit Aktivitat anderer Strukturen auf, erweitert sich dieses Netzwerk um die jeweiligen Informationen, die diese Strukturen erzeugt haben. So wird fuär ein Wort codierende visuelle und auditive Information mit Information allerlei Modalitaäten, die z.B. eine Handlungserfahrung codieren (Hobeln: olfaktorische Information des Holzgeruchs, motorische Information der Hobelbewegung, auditive Information des schleifenden Hobelgeraäusches usw.), assoziiert. Man hat schließlich Informationen, die ein Wort abbilden, assoziiert mit Informationen, die ein Ereignis abbilden, welche ein Netzwerk bilden und je nach Schwellenmenge an Information, die noätig ist, dieses Netzwerk aktivieren, werden die restlichen Informationen des Netzwerks aktiviert und eine Erfahrung evoziert.
Die Bedeutung eines Wortes ist damit die Erfahrung, die es als Differenz in der Umwelt eines Häorenden oder Lesenden und wahrgenommen als Information evoziert. Die Aktivierung von neuronalen Netzwerken, die diese Erfahrung codieren. Bedeutung ist relational, ein Zusammenspiel assoziierter Information säamtlicher Modalitaäten. Das Wort Tisch ‘ aktiviert ein assoziiertes Netzwerk neuronaler Strukturen aus visuellen, auditiven, motorischen etc. Informationen, wobei es diejenigen Teile des Netzwerks zu- verlaässig aktiviert, die durch regelmaäßige Nutzung am stäarksten ausgepräagt sind und die geringste Aktivierung benoätigen. Z.B. die visuellen Aspekte eines Tisches, die immer wieder wahrgenommen werden, wenn etwas als Tisch bezeichnet wird, die prototypische Gestalt eines Tisches mit Tischplatte und vier Tischbeinen. Strukturen, die idiosyn- kratische Details abbilden, werden jedoch nicht zuverlaässig aktiviert, es sei denn, man hat wiederholte oder intensive Erfahrungen mit einem besonderen Tisch, sodass z.B. Gravuren eines Tisches zuverlaässig evoziert werden, den mal selbst geschreinert hat.
Woärter käonnen als visuelle, auditive und motorische Information auch schlicht mit anderen Woärtern assoziiert sein, die wiederum visuelle, auditive und motorische Information sind, z.B. in wissenschaftlichen Definitionen, wobei eine gute Definition durchaus uäb er Sprache hinausgehende Erfahrungen evozieren sollte. Es gibt aber systemintern keinen qualitativen Unterschied der visuellen Information des Wortes zur visuellen Information des Tisches. Sie weisen unterschiedliche visuelle Eigenschaften auf, sind mit unterschiedlichen Informationen anderer Modalitäaten assoziiert, aber in der systeminternen Verarbeitung werden sie als Information gleich behandelt. Man nehme z.B. das Wort Freiheit‘ , das fuär die meisten Menschen keine sprachliche Erfahrung einer Definition, aber auch keine visuelle Erfahrung eines konkreten Gegenstands evoziert. Stattdessen evoziert dieses Wort vornehmlich Gefuähle (Bewertungen) wie angenehme Sorgenlosigkeit und damit korrelierte Erfahrung, z.B. die Erfahrung eines einsamen Spaziergangs im Wald, die Erfahrung eines in der Luft fliegenden Vogels etc. Diese evozierten Erfahrungen sind es, in denen dann die jeweilige Bedeutung von Freiheit liegt.
,Entzaubert’ man Worte als visuelle, auditive und motorische Information konnte man entgegnen, dass man ihnen damit einer gewissen Wertigkeit, einer sprachlichen Realität beraubt. Ganz im Gegenteil kann man jedoch die erfahrene Realitat von Wörtern und Sprache, ihre Eindringlichkeit nun besser nachvollziehen. Worte können einen realen, objektiven Charakter annehmen, gerade weil sie systemintern nicht anders behandelt werden als der Rest der Realitaöt wie z.B. konkrete Objekte. Objekte werden zwar generell als realer erfahren, weil sie mehr Information, mehr neuronale Struktur fuör sich beanspruchen koönnen. Worte werden nicht geschmeckt, nicht gerochen und von den meisten Menschen auch nicht ertastet. Allerdings koönnen Worte durchaus einen sehr ausgepröagten Realitaötscharakter annehmen, falls sie mit intensiven Erfahrungen assoziiert sind.
Kommunikation kann nun nicht mehr als unmittelbares Senden von Bedeutungen betrachtet werden. Kommunikation ist das bewusste Platzieren von Differenzen in der wahrnehmbaren Umwelt eines Gespraöchspartners, z.B. durch die motorische Anregung von Schallwellen. Diese externen Differenzen werden vom Gespraöchspartner eigenlogisch als interne Differenzen auf vorhandene Strukturen abgebildet (vlg. Peschl, 1990). Interpretation ist dann die Evokation von Erfahrung, codiert als Aktivitaöt neuronaler Strukturen. Wenn Ego das Wort Freiheit‘ nutzt, dass sie mit Erfahrungen wie Spaziergaöngen in der Natur, frischer Luft, Abwesenheit von Waönden als Hindernissen etc. assoziiert, in Alter das Wort Freiheit aber Erfahrung eines angenehmen, selbst- gewaöhlten Zustands wie Computerspielen evoziert, wird Ego Alter mit diesem Wort vergebens dazu bewegen koönnen mal an die frische Luft zu gehen. Ego kann mit weiteren Worten versuchen andere neuronale Strukturen in Alter zu aktivieren und damit andere Erfahrungen zu evozieren, oder Alter kann, falls gewollt, in einem Denkprozess die Pfade des aktivierten neuronalen Netzwerks abwandern‘ , um interne Variation zu erzeugen und andere Erfahrungen zu evozieren, aber Ego kann nicht einfach seine Bedeutung Alter aufzwingen, falls Alter nicht die zum Nachvollziehen noötigen Strukturen aufgebaut oder aktiviert hat. Verstaöndigung setzt Erfahrungsgleichheit voraus.
2.2 Kognitive Semantik und konzeptuelle Metaphern
Kognitive Semantik ist ein Teilgebiet der kognitiven Linguistik, die sich damit auseinandersetzt wie Sprache mentale Konzepte und deren Inhalt organisiert. Nach der kognitiven Linguistik ist die Bedeutung eines Konzepts dessen konzeptueller Inhalt, welcher nicht auf eine eigene, semantisch wortwöortliche Sphaöre der Sprache gegruöndet ist, sondern söamtliche Information der Wahrnehmung, Affekte etc. und Beziehungen mit anderen Konzepten bzw. deren konzeptuellen Inhalt umfasst. Kognitive Linguistik grenzt sich damit von allgemeiner Linguistik ab, deren formal-strukturelle Spracheinteilung in morphologische, syntaktische und lexikalische Strukturen und allein innerhalb dieser konstruierten Strukturen angesiedelten Erklärungsweise als ungenügend betrachtet wird. Stattdessen wird ein Ansatz verfolgt, der in der Organisation von Sprache und Bedeutung die gesamte Erfahrung miteinbezieht (Talmy, 2000: 1ff).
Als Begruünder der kognitiven Semantik gelten George Lakoff und Mark Johnson (2003) mit ihrer Theorie konzeptueller Metaphern (CMT). Waührend lange Zeit angenommen wurde, dass Metaphern lediglich Stilmittel sind, eine Randerscheinung der Sprache innerhalb der Nische literarischer Kuünste, kommen Lakoff und Johnson in ihren Untersuchungen der englischen Sprache zum Schluss, dass Metaphern eine zentrale Rolle in der Bildung von Konzepten, Bedeutung, Denkweisen und Wissen in Alltag und Wissenschaft spielen und in Kommunikation allgegenwaürtig sind (Lakoff, 1993).
Als basale Elemente von Konzepten betrachtet CMT sogenannte Bild-Schemata (Image Schemas). Johnson definiert Bild-Schemata als in Wahrnehmungsinteraktionen und Motorprogrammen wiederkehrende, dynamische Muster, die der Erfahrung Kohaürenz und Struktur verleihen“ (Johnson, 1987: XIV; Uü bersetzung des Autors), ferner als [...] abstrakte Struktur eines Bildes, welche eine riesige Anzahl verschiedener Erfahrungen verbindet, die auf denselben wiederkehrenden Strukturen aufbauen“ (Johnson, 1987: 2; Uü bersetzung des Autors). Wesentliche Eigenschaften von Bild-Schemata sind (Hampe, 2005: 1ff):
• Sie sind an sich bedeutende, präkonzeptuelle Strukturen, die durch kürperliche Interaktion mit der Welt entstehen.
• Sie sind hoch schematische Gestalten, welche Information aus sümtlichen Moda- litaüten integrieren.
• Sie sind kontinuierliche, analoge Muster.
• Sie sind intern strukturiert, aus wenigen Elementen zusammengesetzt und flexibel je nach Kontext transformierbar.
Bild-Schemata kann man sich als semantische Gestalten vorstellen, als kleinstnoütige Mengen an Information, die in ihrer Einheit als bedeutendes Ganzes erfahren wird. Ein Beispiel wüare das Schema GEFAü SS, anhand dessen wir die Welt in Innen, Außen und Grenzen strukturieren. Bamberg liegt in Deutschland (LAND ist GEFASS), etwas ist in Sicht (SICHTFELD ist GEFÄSS), das Zimmer im zweiten Stock (GEBÄUDE ist GEFAü SS) usw. Weitere Bild-Schemata sind u.a. VERBINDUNG, TEIL-GANZES, URSPRUNG-WEG-ZIEL, OBEN-UNTEN, VERTIKALITAü T, KRAFT, KONTAKT und OBJEKT (Lakoff, 1989: 155ff; Hampe, 2005: 2f).
Durch Kombination von Bild-Schemata und Assoziation mit zusätzlicher Information können zunehmend elaboriertere und abstraktere Konzepte gebildet werden. So ist das Konzept BETRETEN eine Kombination aus den Bild-Schemata OBJEKT (Einheit, die betritt), GEFÄSS (das Innere, das betreten wird) und URSPRUNG-WEGZIEL (Außen als Ursprung, Pfad zur Übertretung der Grenze als Weg, Innen ist Ziel) (Langacker, 2008: 32f). Solche Konzepte konnen wiederum kombiniert werden, um komplexere Konzepte zu erzeugen usw. Diese Ebenen der Komplexitat zu trennen hat zu einigem Begriffschaos geführt. Kövecses (2017) unternimmt den Versuch dieses Chaos zu bandigen und schlügt ein 4-Ebenen-Modell zunehmend spezifischer werdender konzeptueller Struktur vor, das aus Bild-Schemata, Domaünen (Domains), Frames und Mentalen Rüaumen (Mental Spaces) besteht. Domaünen sind Konzeptualisierungen von Erfahrungsbereichen, die durch wiederkehrend assoziierten Bild-Schemata abgesteckt werden, z.B. die Konzepte von ZEIT und RAUM (Langacker, 2008: 44). Frames sind Spezifizierungen innerhalb und Kombinationen von Domüanen, wie z.B. KOü RPER, waührend Mentale Raüume in situativen Diskursen konstruierte, noch spezifischere, aus mehreren Frames kombinierte Konzepte darstellen (Koüvecses, 2017: 325f).
Da Konzepte in der Aktivierung neuronaler Strukturen codiert sind (Lakoff, 2014) und diese Strukturen sich durch eine unvorstellbar hohe, nicht-hierarchische Interaktivitaüt auszeichnen, scheint eine saubere Trennung von Ebenen allerdings vergebliche Muühe. Solche Kategorisierungen sind nuützlich als voruüb ergehende Werkzeuge zur gedanklichen Ordnung, aber sollten nicht allzu ernst genommen werden, bevor man genaueres uüb er die neuronale Verarbeitung von Konzepten sagen kann. Sinnvoll scheint lediglich die Beibehaltung von Bild-Schemata als semantische Gestalten. Domaünen als aktivierte neuronale Netzwerke, welche die Grenzen der Interpretation festlegen, also abgrenzen unter Zugriff welcher Bild-Schemata und Erfahrungen in der Situation gedeutet wird. Sowie Basis-Level Konzepte (Berlin et al., 1974) als prototypische, effiziente, stark inkorporierte und somit abrufbereite Konzepte wie z.B. Tisch‘ , auf die ein Großteil von Erfahrung und alltaüglicher Kommunikation aufbaut (Lakoff, 1989: 106ff). Ansonsten scheint es vorerst sinniger bei Prüazisionsbedarf auf das idealtypische Spektrum Sche- matizitaüt-Spezifitüat von Langacker (2008: 55ff) zuruückzugreifen, anstatt zu versuchen Konzeptebenen trennscharf zu kategorisieren.
Was bezeichnet nun der Theorie der CMT namensgebende Begriff der Metapher‘ ? Küovecses (2016: 2; Uübersetzung des Autors) definiert Metapher als systematische Menge von Korrespondenzen zwischen zwei Domüanen der Erfahrung.“ Eine Metapher ist eine Abbildung zwischen zwei Erfahrungsbereichen, wobei Quell-Domaüne und Ziel- Domaüne unterschieden werden. Die Quell-Domaüne ist ein Erfahrungsbereich aus dem ein, fuür gewüohnlich sensomotorisch verankertes, konkreteres Konzept auf eine Ziel- Domaüne abgebildet wird, um ein dortiges abstrakteres Konzept durch die Erfahrung aus der Quell-Domüane verstaündlich zu machen (Lakoff, 1993: 4f). Ein Beispiel fuür eine Metapher wäre ZEIT ist GELD. Das Bild-schematische, abstrakte Konzept der Zeit wird auf den Erfahrungsbereich des Geldes abgebildet und somit konkretisiert. Dies zeigt sich im Sprachgebrauch durch Aussagen wie „das hat mich viel Zeit gekostet“, „dafür habe ich einiges an Zeit investiert“, „deine Zeit ist aufgebraucht“, „dadurch habe ich Zeit gespart“, „verschwendete Zeit“ usw. Die Ziel-Domane der Zeit zapft die Quell-Domüane des Geldes an und bedient sich dessen konzeptueller Fundierung als LIMITIERTE RESSOURCE, WERTVOLLE WARE und damit assoziierte Handlungen. Weitere Beispiele sind u.a. LIEBE ist REISE, DISKUSSION ist KRIEG, GUT ist OBEN, SCHLECHT ist UNTEN, MEHR ist OBEN, WENIGER ist UNTEN (Lakoff und Johnson, 2003), DENKEN ist BEWEGEN, KOMMUNIKATION ist FUü HREN, und VERSTEHEN ist FOLGEN (Lakoff, 2014).
CMT betrachtet Konzepte als neuronale Netzwerke, welche Erfahrungen, codiert in neuronalen Knoten verschiedener Bereiche des Gehirns, miteinander verbinden (2014: 5ff). Verbindungen entstehen nach dem Hebb’schen Prinzip (Hebb, 2002), wonach Neuronen, die zusammen feuern, Verbindungen bilden. Neuronen zweier neuronaler Knoten werden erregt, feuern, erregen damit ihre Nachbarneuronen, die wiederum ihre Nachbarn anregen usw. So entsteht bei ausreichender Aktivierung eine Kaskade neuronaler Aktivitaüt. Wird diese Kaskade lang genug aufrechterhalten, treffen die ausgeloüsten Kaskaden der beiden Knoten auf dem kuürzesten Weg aufeinander und es entsteht ein Netzwerk, indem an den Grenzpunkten der Kaskaden zwischen den jeweiligen Neuronen exzitatorische Synapsen ausgebildet werden. Diese Synapsenbildung ist bidirektional, aber asymmetrisch, d.h. Axonendigungen des Neurons von Kaskade 1 verbinden sich mit Dendriten des Neurons von Kaskade 2 zu einer Synapse und umgekehrt. Dies bildet nach Lakoff die Grundlage fuür die Asymmetrie von Ziel- und Quell-Domaünen, da z.B. LIEBE als REISE konzeptualisiert wird, seltener aber eine REISE als LIEBE. Die Synapsen des Neurons, welches in dieser asymmetrischen Verbindung zuerst feuert werden gestaürkt, waührend die Synapsen des zeitlichen Verlierers schwüacher werden. Die Quell-Domaüne wird dadurch entschieden, wessen Aktivitaüt eines Knotens regelmaüßig als erster an der synaptischen Schnittstelle, welche die beiden Knoten zum Netzwerk verbindet, ankommt. Sind solche Netzwerke erst mal etabliert bildet das Gehirn nicht beliebig neue Verbindungen, sondern Information wird aus üokonomischen Gruünden auf vorhandene Strukturen im Sinne eines Best-Fits‘ abgebildet. Nur falls Motivation gegeben ist, z.B. wenn der Best-Fit gegebener Information nicht in der Lage ist ein wichtiges Problem zu lüosen, wird eine Reorganisation etablierter Netzwerke und die Ausbildung neuer Netzwerke fazilitiert (Lakoff, 2014: 8, 11).
Inkonsistenzen entstehen demnach wenn Netzwerke und Knoten aktiviert werden, die sich gegenseitig hemmen statt erregen, was die Erfahrung evoziert, dass zwei Ideen, Konzepte, Gegenstaünde etc. nicht zusammenpassen“ , da ihre codierende, neuronale Aktivitüat im Wettbewerb steht. Der Eindruck von Aü hnlichkeit und Zusammengehörigkeit ergibt sich aus der topologisch überlappenden Aktivierung neuronaler Netzwerke, was höufig damit zusammenhängt, dass die jeweilige Information (z.B. ein codiertes Wort) im selben Netzwerk liegt. Resonanz wird schließlich erzeugt, wenn Netzwerke aktiviert werden, die sich nicht hemmen, sondern erregen und folglich Verbindungen untereinander aufbauen. Resonanz ist damit, anknuöpfend an Lakoffs Argumentation, Voraussetzung fuör die Bildung von Metaphern.
Zu guter Letzt soll noch der Begriffs des Frames definiert werden. Als Bezeichnung einer Komplexitöatsebene von Konzepten wurde dieser bereits ausgeschlossen. Wir wollen stattdessen Wood et al. (2018) folgen, welche Frames in der Umwelt eines Subjekts als Schemata aktivierende, oöffentliche, situative und materielle Kultur verorten. Ein Frame ist demnach eine bewusst platzierte Differenz in der Umwelt eines Subjekts, die bestimmte Erfahrungen und damit Bedeutung evoziert. Die Abbildung interner Differenzen auf externe Differenzen. Ein Framemodell ist eine Erwartung daruöber, welche platzierten Differenzen welche Bedeutungen evozieren, kann unterschiedlich differenziert sein (platzierte Differenz kann in unterschiedlichen Menschen unterschiedliche Bedeutungen evozieren. Differenzen muössen auf spezielle Weise differenziert werden, z.B. angemessener Haöndedruck bei Handschlag) und dient als Leitlinie fuör Framing. Framing ist nichts Ungewoöhnliches. Jedes mal, wenn wir kommunizieren, framen wir selbstverstöandlich mit Worten, sodass sie im Gegenuöber eine bestimmte Bedeutung und Reaktion evozieren. Framing ist aber auch schon das bloße Anlaöcheln eines Ge- genuöb ers, um in ihm eine bestimmte Bedeutung zu evozieren, naömlich, dass man als angenehm und sympathisch erfahren wird, was von einem kulturellen Framemodell geleitet wird, nöamlich der Erwartung, dass Löacheln eine solche Bedeutung in anderen evoziert. Framing ist damit allgegenwöartig, allerdings nicht so allgegenwaörtig wie Frames, denn nicht jeder Frame muss bewusst platziert sein. Das Laöcheln z.B. kann als Gewohnheit einem unbewusst aufs Gesicht gezeichnet sein oder sich aufdraöngen, wenn man z.B. einen guten Witz hoört. In diesem Falle ist das Löacheln nicht bewusst platziert, kann aber dennoch als Frame wirken, falls es beobachtet wird und jener Beobachter diese Differenzen (Laöcheln) systemintern verarbeiten und abbilden kann.
2.3 Schlussfolgerung
Aus diesen theoretischen Vorgedanken lassen sich fuör die Analyse von Onlinekommentaren relevante Annahmen ableiten. Zum einen sind Kommentare bewusst platzierte Differenzen in der Umwelt, die auf interne Differenzen des Platzierenden schließen lassen. Kommentare köonnen Bedeutung evozieren, weil sie aufbauend auf eigener Erfahrung mit Bedeutung verfasst wurden. Verwendete Konzepte, Woörter und Metaphern mit Ursprung in Erfahrung codierenden, neuronalen Netzwerken erlauben somit Ruöckschluösse auf konkrete interne Differenzen. Erfahrungswelten, die wir als Weltbilder, Denkweisen, Einstellungen, Meinungen etc. aus den platzierten Differenzen extrahieren können.
Zum anderen muss der Analytiker stets bedenken, dass er diese platzierten Differenzen selbst nur als eigene, evozierte Erfahrungen deuten kann, die er dem Kommentator zuschreibt. Der Analytiker steht entsprechend in der Pflicht nicht voreilig die initiale, evozierte Bedeutung zuzuschreiben, sondern aktiv nach anderen, moöglichen Bedeutungen zu suchen und im Abgleich mit dem gesamten verfuögbaren Material eines Kommentators die plausibelste Deutung vorzunehmen. Die Zuverlöassigkeit der Interpretation steigt mit der Menge an verfasstem Material eines Kommentators.
Auch muss bedacht werden, dass eine Kommentarspalte unter einem Artikel ein eigenes, semantisches Oö kosystem ist, in dem wahrgenommene Frames des Artikels und anderer Kommentare bestimmte Domaönen der Kommentatoren hemmen, andere aktivieren und somit die platzierbaren Differenzen des Kommentators beeinflussen. Darauf wird in Sektion 5 genauer eingegangen. Die Analyse einer einzigen Kommentarspalte kann also nur als selektive Exploration vorhandener Weltbilder, Meinungen, Einstellungen etc., die innerhalb dieses semantischen Oö kosystems in den Kommentatoren aktiviert wurden, und von stark inkorporierten Konzepten, die weitestgehend kontextunabhaöngig und zuverlaössig aktiviert werden, dienen und nicht als erschoöpfende, ganzheitliche Erfassung eines Kommentators, geschweige denn aller Weltbilder und Einstellungen einer Population.
3 Daten
Als Sample fuör die Untersuchung der Forschungsfrage dienen die Kommentare des Artikel Kontaktsperre: Wie es jetzt weitergehen kann“ von Florian Hams, veroöffentlicht am 14.04.2020 auf t-online.de.4 Dieser Artikel bietet sich aus einigen Gruönden an. Zum einen rangiert T-Online laut SimilarWeb auf Platz 9 der meistbesuchten Seiten in Deutschland und ist damit die in Deutschland bestbesuchte Webseite, welche Nachrichten anbietet, mit knapp 200 Mio. Besuchen im Möarz 2020.5 T-Online.de berichtet dabei extensiv uöber Corona, so verzeichnet t-online.de im Zeitraum vom 01.04.2020 bis 14.04.2020 41000 Suchtreffer, wenn man den Suchbegriff Corona‘ googelt. Verglichen mit anderen Nachrichtenwebseiten tritt dieser Begriff auf t-online.de damit sehr höaufig auf.6 Zum anderen bietet dieser Artikel die Moöglichkeit zu kommentieren, etwas, was immer weniger Webseiten auf Grund von Bruöchen der Netiquette anbieten. Diese Moöglichkeit wurde von den Nutzern ausgiebig in Anspruch genommen, sodass hier auf eine Stichprobe von 855 Kommentaren zurückgegriffen werden kann. Ein weiterer Vorteil ist die Heterogenität der Kommentare. T-online.de hat im Gegensatz zu Welt.de (wirtschaftsorientiert, konservativ), focus.de (konservativ) Zeit.de (links) etc. keine offene, politische Linie, versammelt ausgehend von Formulierungsniveau und Themenvielfalt Menschen verschiedenster Einstellungen und Bildungsschichten und grenzt sich damit wiederum positiv von Kommentaren auf Webseiten wie spiegel.de (hauptsachlich höheres Bildungsniveau) oder auf YouTube-Kanalen von Nachrichtenseiten, z.B. der Tagesschau, (hauptsachlich geringeres Niveau und geringe Diskussionsbereitschaft) ab. Zu guter Letzt spielt in den Kommentaren thematisch vor allem eine am 13.04.2020 von der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina veröffentlichte, kontroverse, weil zu einer allmahlich Lockerung der Beschrankungen ratenden, Stellungnahme7 eine Rolle, welche im Artikel als Diskussionsgrundlage verlinkt wird. Diese Diskussion fördert unter den Nutzern sehr deutlich die unterschiedlichen Einstellungen zu den bisherigen Beschrankungen zutage und erlaubt öberhaupt erst die Untersuchung der gestellten Forschungsfrage.
4 Methode
Da Kommentare untersucht werden, die Differenzen in der Umwelt anderer Leser platzieren, um bestimmte Bedeutungen in diesen zu evozieren und somit als Frame wirken, kann in der Untersuchung dieser Differenzen von einer Frameanalyse gesprochen werden. Untersucht werden bestimmte Differenzen, sogenannte Frame-Elemente wie Metaphern, Schlagwoörter, historische Beispiele, beschriebene Bilder, Themen, Auslegungsmuster, Vernunftmittel bzw. Erklaörungsweisen, Appelle, Grafiken, Statistiken etc., welche im Zusammenhang Einstellungen, Denkweisen und Weltbilder von Akteuren sichtbar machen (van Gorp, 2010: 91f). Kommentare haben dabei den Vorteil, dass man nicht zeitlich zu einer Antwort gedraöngt ist wie z.B. in einer Face-to- Face-Kommunikation. Zudem kann man nicht oder nur rudimentaör auf anderweitige Differenzen zuruöckgreifen, z.B. Mimik oder Gestik per Emojis, und muss Bedeutung anhand praözise formulierter Worte evozieren. Differenzen koönnen und muössen bewusster platziert werden, um bestimmte Bedeutungen zu evozieren, was eine zuverlöassigere Auslegung erlaubt. Ein Nachteil ist jedoch, dass praözise Formulierung von Worten und Evokation von Bedeutung geuöbt sein muss. Nicht jeder ist gleichsam im Stande Kommentare so zu framen wie er beabsichtigt, was bei jenen Ruöckschluösse auf Einstellung, Denkweisen etc. erschwert. Außerdem fallen gerade durch den aufgezwungenen Verzicht von Mimik, Gestik, Tonhoöhe etc. bestimmte Bedeutungen weg, die nicht oder nur schwer allein durch Schrift evoziert werden köonnen.
Methodisch orientiert sich die vorliegende Arbeit an der Grounded Theory (Glaser, 1978; Glaser, 1998; Breuer et al., 2019), im speziellen an der Methode des konstanten Vergleichs. Hierbei dient der Vergleich als zentrale Erkenntnisheuristik. Durch ständiges, dynamisches Kontrastieren des empirischen Materials, theoretisch geleiteten Selektionen des empirischen Materials, Kodes und Kategorien untereinander und dem Vergleichen von hypothetisch Moäglichem und theoretisch Naheliegendem, aber Abwesendem, mit vorhandenem Material (Was wurde gerade nicht gesagt?) uäber den gesamten Forschungsverlauf der Arbeit hinweg, sollen latente Strukturen, Prozesse und Zusammenhaänge, welche das empirische Material indiziert, aufgedeckt und in theoretischen Konzepten ausdifferenziert werden (Glaser, 1998: 107ff; Breuer et al., 2019: 272f).
Konkret wurde sich zunaächst mit dem Feld vertraut gemacht. Kommentare, Artikel, Videos, Bilder, Memes, Songs etc. aus mehreren Quellen,8 die von Corona handeln, rezipiert, um einen ersten Uä berblick uäber auftretende Frame-Elemente zu gewinnen (Breuer et al., 2019: 255). Ersichtlich wurde eine Konfliktlinie entlang derer, welche die am 22. Maärz verhäangten Maßnahmen befuärworten und jener, welche diese Maßnahmen ablehnen. Aus den in Sektion 3 angegebenen Gruände wurde ein t-online.de Artikel samt Kommentaren selektiert, um diese beiden Gruppen zu analysieren. Hierbei wurden zunaächst in offener Kodierung alle 855 Kommentare Wort fuär Wort analysiert, um zu sehen, welche Themen, Schlagworte, Meinungen, Erklaärungsweisen etc. im Sample enthalten sind. Darauf folgte die erste selektive Kodierung, welche die Kommentierenden in Befuärworter und Gegner der Maßnahmen einteilte. Ohne Kenntnis der Kommentatoren wurden alle Kommentare der befuärwortenden Gruppe zugeordnet, welche sich wortwoärtlich und klar fuär eine Beibehaltung oder Verschaärfung der Maßnahmen aussprechen. Als Beispiel:
[...]Leute wann endlich bekommt der Verstand des Menschen wieder die Oberhand? Es sind jetzt genug Informationen zu diesem Virus verfügbar und letztendlich haben wir auch am heutigen Tage keine Impfstoffe und keine Therapien für den Menschen. Daher gibt es eigentlich nur eines: Verlängerung der Kontaktsperre; Verlüangerung der Ausgangsbeschrüankung!!! [...]
Selbiges wurde mit ablehnenden Kommentaren durchgefuährt. Anschließend wurden alle weiteren Kommentare derjenigen Kommentatoren, von denen ein oder mehrere Kommentare als befuärwortend kodiert wurden, zu der Gruppe der Befuärworter hinzugefuägt, dasselbige mit den ablehnenden Kommentaren. Dies erlaubte eine erste Konsistenz- pruäfung. Kommentare von Kommentatoren, die beiden Gruppen zugeordnet wurden, also als befuärwortend und ablehnend codierte Kommentare schrieben, wurden ausgesondert. Dies war auf dieser Ebene der Selektion bei keinem Kommentator der Fall, in Kommentaren geäaußerte, klare Meinungen waren uäber alle anderen Kommentare der Kommentatoren hinweg konsistent. Eine weitere Selektion fuährte dasselbe Verfahren mit Kommentaren und Kommentatoren durch, die ihre Meinung zu den Maßnahmen nicht wortwörtlich, aber implizit äußerten, z.B. durch Lob für das Handeln der Regierung (Befürwortung) oder vorgeworfenes Versagen der Regierung (Ablehnung), Absprache des Verstands anderer, die Maßnahmen missachten (Befuürwortung), Zustimmung klarer Meinungen anderer (Befuürwortung, Ablehnung), aber auch schwierigere Faülle wie der Folgende, in dem einfuührend die Maßnahmen als richtig bezeichnet werden, der aufgrund der unterstrichenen Aspekte und Deutungen in den eckigen Klammern dennoch als ablehnend kodiert wurde:
Egal wie man zum Virus steht, es muss etwas getan werden um langsam wieder das öffentliche Leben und die Wietschaft hoch zufahren. Der Shutdown war wahrscheinlich [Zweifel] richtig. Aber jetzt immer nur zu sagen ” wir müssen Gedult haben”, ist mal wieder so typisch für Frau Merkel, sie versucht mal wieder ein Problem auszusitzten [Abwertung politische Person bzw. Regierung]. Das wird aber diesmal nicht funktionieren bzw. es wird katastrophale Folgen füur jeden einzelnen von uns [Betonung Wichtigkeit Maßnahmen aufzuheben] haben.[...]
Auch hier wurden wieder alle Kommentare der Kommentaren zu den jeweiligen Gruppen hinzugefuügt und nun erwies sich die Konsistenzpruüfung als aüußerst hilfreich, da es zu einigen Gruppenuüberschneidungen kam. Alle Kommentare von Kommentatoren, die der Konsistenzpruüfung nicht standhielten oder nicht zugeordnet werden konnten, wurden aus der Untersuchung entfernt. Dieser Selektionsprozess hinterließ eine Stichprobe von 243 befuürwortenden Kommentaren von 46 Kommentatoren und 211 ablehnenden Kommentaren von 27 Kommentatoren, auf die diese Untersuchung fußt. Diese Vergleichsprozesse wurden auf und zwischen den beiden Gruppen wiederholt, um Muster in Argumentationen, Erklaürungsweisen, Denkweisen, Metaphern, Interessen etc. und damit zusammenhaüngende Typen innerhalb der Gruppen herauszuarbeiten.
5 Artikel als Frame
Bevor die Kommentare analysiert werden soll kurz die Semantik des Artikels aufge- schluüsselt werden, da man davon ausgehen kann, dass dieser von den meisten Kommentatoren gelesen wurde und damit als Frame Einfluss auf Inhalt der Kommentare nahm. Mit der Uü berschrift Kontaktsperre: Wie es jetzt weitergehen kann“ wird gleich zu Beginn der Fokus auf die verhaüngten Maßnahmen und der Zukunft gelegt. Der Artikel lüasst sich dann grob in zwei Haülften unterteilen.
Die erste Haülfte beschüaftigt sich mit den Handlungsempfehlungen der Leopoldina und legt den Grundstein der Diskussion in den Kommentaren. Hier werden eine Vielzahl von Frames platziert, die bestimmte Domüanen aktivieren. Einige wichtige sind:
• Der Begriff „Professoren“ statt Wissenschaftler, im besonderen in Bezug auf die Wissenschaftler der Leopoldina ^ Wissenschaftler der Leopoldina als belehrende, elterliche Autoritüaten.
• „Denn ihre Expertise erhebt die Professoren keinesfalls in hehre Sphären der Objektivität, frei von Meinung und weltlicher Fehlbarkeit“ z Fehlbarkeit von Experten.
• „Die (Öffnung von Geschäften, Restaurants und Behörden stellen die Experten in Aussicht, den Start des Schulbetriebs sobald wie irgend möglich. Dienstreisen, Urlaubsreisen: Demnaöchst alles wieder drin. Kultur- und Sportveranstaltungen? Geht klar“ z Assoziation Leopoldina mit uöberhasteten, gedankenlosen Lockerungen.
• „Risiken und Nebenwirkungen der deutschlandweiten Radikalkur“ z Maßnahmen als Medizin mit riskanten Nebenwirkungen (Nebenwirkungen koönnen schlimmer sein als Krankheit).
• „Gebot der Verhaltnismaßigkeit dörfe nicht einem seuchenpolizeilichen Imperativ geopfert werden“ z Polizeitstaat und unverhaöltnismaößige Maßnahmen.
• „Gelegentlich stellt sich bei der Lekture [Dokument Leopoldina] der Eindruck ein, als höatten die Autoren hier und da die Bodenhaftung verloren“ z Lockerungs- vorschlaöge unrealistisch.
• „Umfassende staatliche Maßnahmen sollen selbstandige Einzelkampfer ebenso wie große Konzerne vor dem Bankrott bewahren und den gesamtwirtschaftlichen Kollaps verhindern“ z Gefahr fuör Wirtschaft.
• „Trotzdem fragt man sich unwillkörlich, ob die Damen und Herren Professoren eigentlich schon mal eine real existierende Horde Grundschuöler erlebt haben“ z Realitöats- bzw. Praxisferne von Wissenschaftlern.
• „Die Unterdriickung von Covid-19-Ausbröchen sofort beim ersten Anzeichen wird in Suödkorea und Taiwan erfolgreich praktiziert [Nachverfolgung Infektionsketten und Isolation] [...] Die Leopoldina-Professoren hingegen wönschen sich [...] zeitnahe Lockerungen und sind bereit, [...] Ansteckungen in Kauf zu nehmen [...]“ z Stellungnahme Autor: Unterdruöckung von Virus als beste Option aus gesundheitlicher Sicht. Leopoldina gegen beste Option. Zeichnung einer Konfliktlinie.
• „Das erlaubt eine schnellere Lockerung för die Ungeduldigen, erfordert im Gegenzug aber permanente Einschrankungen uber die gesamte Dauer der Epidemie. Monatelang, vielleicht jahrelang. Es fordert mehr Opfer. Und es betritt Neuland, was die Risiken dieses Weges nur schwer kalkulierbar macht.“ z Negative Bewertung von Lockerungen.
In der zweiten Höalfte aöußerst sich der Autor zu zentralen politischen Akteuren in der Corona-Krise“ (Jens Spahn, Armin Laschet, Markus Soöder, Olaf Scholz und Angela Merkel). Auch hier werden einige Frames platziert, wie z.B. Politik als Theater, und vor allem ironische, abwertende, zum Teil Kompetenz absprechende, Bewertungen der Politiker vorgenommen. Die Frames der zweiten Hälfte sind für die vorliegende Untersuchung weniger relevant, aber finden durchaus hohe Resonanz in den Kommentaren.
Man müss eingestehen, dass der Artikel ohne Absicht objektiver Berichterstattüng geschrieben würde, Stellüng bezieht ünd entsprechend als üngeeignet betrachtet werden könnte, da er mit eigenen Wertungen Meinungen von Lesern beeinflussen konnte. Allerdings übernehmen Menschen nicht einfach so Wertungen anderer (Biocca, 1988). Kommunikation aktiviert Domaönen eigener Erfahrung und wahrgenommene Wertungen anderer werden innerhalb dieser Domaönen mit eigenen Wertungen verglichen, was zu Resonanz (Zustimmung) oder Inkonsistenz (Ablehnung, Reaktanz) fuöhrt. Wichtiger als die Wertung des Autors ist also, dass er verschiedenste Frames platziert, welche verschiedenste Domaönen aktivieren, die eine Konfliktlinie zeichnen, entlang derer sich Befuörworter und Ablehnende der Maßnahmen verorten koönnen, was die Basis unserer Untersuchung bildet. Auch wenn der Autor dem gesamtwirtschaftlichen Kollaps“ eine geringere Bedeutung zumisst und Maßnahmen, die diesem entgegenwirken sollen, negativ assoziiert, so aktiviert er mit der Erwaöhnung eines Wirtschaftskollaps eine Domaöne im Leser und damit die Moöglichkeit dieses Bild und dessen Assoziationen in ein Urteil mit einzubeziehen. Der Artikel eröoffnet eine Arena fuör Befuörworter und Ablehnende der Maßnahmen, in denen der distanzierte Zuschauer betrachten kann, welche Bedeutungen durch den Artikel evoziert werden, was Resonanz findet und uöbernommen wird, was Inkonsistenz erzeugt und auf Widerstand stoößt und welche kontraören Erklöarungsmuster, Metaphern und Denkweisen sich auf welcher Seite zusammenfinden.
6 Befürworter der Maßnahmen
Die Gruppe der Befuörworter ist heterogen, dennoch lassen sich aus den Kommentaren drei Denktypen mit distinktiven Motiven, Argumenten, Einstellungen und Absichten herauslesen: ein angstgeleiteter Typ, ein gesellschaftskritischer Typ und ein pragmatischer Typ. Diese duörfen jedoch nur als Idealtypen verstanden werden, als einseitige Steigerung eines oder einiger Gesichtspunkte und durch Zusammenschluss [...] hier mehr, dort weniger, stellenweise gar nicht vorhandener Einzelerscheinungen, die sich jenen einseitig herausgehobenen Gesichtspunkten fuögen, zu einem in sich einheitlichen Gedankenbilde“ (Weber, 1922: 191). Idealtypen sind selbst keine empirischen Phaönomene, sondern dienen als relativer Bezugsrahmen zur Kategorisierung, Vergleichung und Kontrastierung empirischer Phaönomene. Insofern gibt es keine eins-zu-eins Abbildungen zwischen diesen Typen und den Kommentatoren, sondern Mischformen aus diesen drei Typen und idiosynkratischen Merkmalen, die jedoch einzelnen Typen im wesentlichen sehr nahe kommen koönnen.
6.1 Der Angstgeleitete
Da gibt es die, die sich an die Regeln halten 80% und die Anderen.Da wird Ostern einfach mal die Oma, Opa Kind besucht und danach die enge befreundete Familie immer nur 2 Personen , das aber 6 mal. Alle Treppenhäuser werden infiziert und der Besuch macht dann das gleiche.Sind locker 50 Personen , die sich einfach mal kurz umarmt haben.Und jeder meint , er habe die Kontaktsperre eingehalten.Es waren ja immer nur 2 Personen.Leute bleibt bitte so lange zu Hause, bis das endlich vorbei ist.Wir Risikoleute haben einfach Angst.
Für den angstgeleiteten Typen ist „Corona“ eine Angelegenheit von Leben und Tod. Höchste Priorität hat der gesundheitliche Schutz der Risikogruppe, zu denen sich viele dieses Typs selbst zaühlen. Durch die eigene Betroffenheit kommuniziert dieser Typ emotional, z.B. durch den ausgiebigen Gebrauch an Ausrufezeichen und der Zeichnung katastrophierender, sprachlicher Bilder, durch welche dessen Angst verbreitet werden soll, damit der Ernst der Lage“ begriffen wird. Entsprechend werden Lockerungen strikt abgelehnt, die einzige Option sind die Beibehaltung oder gar Verschaürfung der Maßnahmen, um schlimmere Konsequenzen zu verhindern.
[...] Jetzt mäussen wir standhaft bleiben, die Maßnahmen um 4 Wochen verläangern und wir haben eine echte Chance auf die Zukunft. machen wir das nicht, dann werden wir auf Jahre hinaus Konsequenzen tragen die weitaus schlimmer sein werden. [...]
Zahlen und Statistiken wie Todesraten werden dramatisch inszeniert, auf kritische Situationen im Ausland verwiesen ( italienische Verhaültnisse“ , Massensterben in unseren Nachbarlüandern und Global“ ) und emotionale, auf Empathie abzielende, sprachliche Bilder gezeichnet, in denen das Leben gefüahrdeter Personen auf dem Spiel steht, und mit Lockerungen von Maßnahmen assoziiert, um diese in Verruf zu bringen.
300.000 Menschen in Deutschland haben Diabetes Typ 1. Davon sind mehr als 30.000 Kinder und Jugendliche unter 19 Jahren. 6,7 Millionen Menschen in Deutschland an Diabetes mellitus. In Deutschlandsind rund 492.000 Krebserkrankungen diagnostiziert worden. Etwa 697.000 menschen mit Herzerkrankungen gibt es in Deutschland. In Deutschland erkranken etwa 10 bis 15% der Kinder und etwa 5-7% der Erwachsenen an Asthma - das sind rund 8 Millionen Menschen. Vor allem Kinder sind betroffen - Asthma bronchiale ist die häaufigste chronische Erkrankung im Kindesalter . Na wer moächte noch schnelle Lockerungen ???????? das sind alles Hochrisiko Patienten !!!! Darf man sie aus wirtschaftlichen Interessen opfern???? Ich meine NEIN
die maßnahmen zu fräuh aufheben,ist im grunde wie ”russisches roulette”,allerdings mit mehr als einer kugel in der trommel..
„Die Anderen“, die „die Gefahr nicht erkennen wollen“ und sich nicht an die Maßnahmen halten, setzen das Leben von Risikopersonen bewusst aufs Spiel, handeln egoistisch, verantwortungslos, moralisch verwerflich und werden damit zur eigentlichen Gefahr.
[...] Mir unbegreiflich,dass einige immer meinen,die Regeln sind nur fäur andere Leute gemacht. Gerade durch solche lullu denkenden Menschen,wird der Virus immer wieder da sein,wenn man glaubt,es ist bald vorbei. Mich macht soviel Unverstand und Egoismus manchmal doch wäutend. So kann das alles doch nicht funktionieren. Solche Menschen sind eine Gefahr fäur Risiko-Menschen mit Vorerkrankungen.
Hier schwellt ein Alt vs. Jung Konflikt, denn diese Gefahr geht diesem Typ nach vor allem von jungen Menschen aus, die annehmen sie waüren immun“ und sich nicht um das Virus scheren.
[...] diese junge mediale Generation besitzt nicht die geringste Disziplin um nur mal 6 Wochen die Fuäße still zu halten. Sie sind zu dumm , die Eltern eingeschlossen. [...] Was kapieren diese jungen
Menschen eigentlich nicht? 16 Jährige feiern mit 35 Personen eine Geburtstagsparty eigens von den Eltern organisiert. Ehrlich , ich wärde die einsperren !!!! Es geht um Menschenleben Ihr Deppen !!!
Zentrales Bedürfnis dieses Typs ist die Vermeidung von Unsicherheit, das Sehnen nach Stabilität und Kontrolle. Verbreitete Schlagworte sind „Disziplin“, „Ruhe“, „Vorsicht“, Geduld“ und die Warnung vor Leichtsinn“ . Grenzen sollen dicht“ gemacht werden, Isolation, Abstand [sind] sind das einzige wirksame Mittel gegen den Virus“ , bis es ein tatsaüchliches Gegenmittel oder einen Impfstoff gibt. Man ist geneigt bei diesem Typen von einer Aussitz-Mentalitüat sprechen, die mit Passivitaüt und teils Fatalismus einhergeht ( Standhaft bleiben, Entwicklung abwarten. [...] Alles andere haben wir nicht mehr in der Hand, dessen bin ich mir sicher.“). Die Abwesenheit der Kontrolle durch ein Gegenmittel kann nur mit Kontrolle durch Wissen kompensiert werden. Man muüsse testen,testen,testen“ , moüglichst alle, denn in Ermangelung genauen Wissens uüb er das ganze Ausmaß“ seien Lockerungen Irrsinn“ .
ja aber das ist doch der Irrsinn in Zahlen , wir wissen nichts und wollen wirklich lockern ?
Verwendet werden Metaphern wie CORONA ist eine NATURGEWALT und CORONA ist eine PERSON. So warnt dieser Typ vor den nüachsten Wellen“ . Das Virus ist demnach eine Flutwelle, die unkontrollierbar, kraftvoll und unausweichlich auf einen zurollt. Lockerungen sind ein Tanz auf dem Vulkan“ , Orte von denen aus sich das Virus verbreitet „Infektionshotspots“ oder „Infektionsherde“, die für ein „Maximalaufflammen“ der Epidemie sorgen koünnen. Metaphern, welche das Virus mit Feuer assoziieren und die davon ausgehende und schwer einzudaümmende Gefahr in den Vordergrund stellen. Als Person „wütet“ „der“ Virus oder hat etwas ,,Fiese[s]“.
6.2 Der Gesellschaftskritiker
Nun erkennen die Bäurger was sie alles aufgeschwatzt bekommen und eigentlich nicht brauchen, und auf was wir jedes Jahr immer etwas mehr verzichten, und jetzt wieder in greifbare Näahe räuckt, saubere Luft mit klarem Himmel.
Aü hnlich dem angstgeleiteten Typ stellt der Gesellschaftskritiker die Gesundheit uüber die Wirtschaft, jedoch weniger aus Angst um die eigene Gesundheit oder der Gesundheit anderer, sondern als Wertekontrast zur Kritik an bestehenden Verhaültnissen und oükonomischen Denkausrichtungen. Die Pandemie bringt die Fehlentwicklungen der Gesellschaft ans Tageslicht, angefuührt von Globalisierung und Neoliberalismus“ .
Die Corona Epidemie hat etwas zuwege gebracht, was zuvor undenkbar war. Ein Beispiel: Mittlerweile setzt sich die Erkenntnis durch, dass die Globalisierung eine Sackgasse bzw. die Entwicklung in die falsche Richtung ist. Und es wir offen gesagt! Vorher undenkbar, weil äokonomische Blasphemie. Pläotzlich stellt man fest, dass lange Lieferketten hinderlich sind. Pläotzlich stellt man fest, dass just-in-time- Produktion nachteilig ist, weil kein Vorrat vorhanden. Das sind offensichtliche Nachteile. Ein wesentlich gravierenderer Nachteil: Globalisierung und Neoliberalismus sozialisieren die Verluste und die Kosten, waährend die Gewinne kapitalisiert werden. Mit anderen Worten, alle bezahlen, wenige verdienen. Dann pläotzlich stellt man fest, die Armen werden immer aärmer, die Reichen immer reicher. Konnte ja keiner ahnen.
In diesem Typen schwellt der Konflikt zwischen Konzernen“, Manager[n]“ und dem „Radikal Freien Markt“ auf der einen und dem „Bürger“, „Vorarbeiter“, „Steuerzahler“ bzw. der „Bevölkerung“ auf der anderen Seite. Zusammengefasst der Konflikt zwischen einer profitierenden, wirtschaftlichen Elite und dem ausgelieferten kleinen Mann‘ , ein Konflikt, in dem aufgrund der Machtasymmetrie bisher [...] immer das Geld“ bzw. die Wirtschaft gesiegt“ hat, welche mit der wirtschaftlichen Elite und rein profitorientierten Praktiken gleichgesetzt werden.
Die Pandemie ist entsprechend eine Chance. Eine Chance Ausbeutung“ , Profitgeilheit“ und Konsumwahnsinn“ zu unterbinden, eine Chance zu erkennen, dass man auf das ganze Tam Tam“ verzichten kann, eine Chance zu mehr Naturverbundenheit, eine Chance zu mehr Solidaritaüt, menschlicher [zu] werden und aufeinander zu[zu]gehen“ , kurz: eine Chance mit dem ganzen Mist auf zu hüoren und sich neu zu erfinden.“ Fuür den Gesellschaftskritiker tritt die vom Virus ausgehende gesundheitliche Gefahr in den Hintergrund, es wird gaünzlich anders bewertet. Nicht das Virus ist die Krankheit, sondern die Gesellschaft ist die Krankheit und eigentliche Gefahr. Virus und Pandemie sind das Gegenmittel, um die kranke Gesellschaft zu heilen.
[...] Meine Befürchtung ist nur, dass sobald die Erkrankungswelle überstanden ist, keinerlei Gedanken mehr daran verschwendet werden. Weiter im Wahn der ”Geiz ist Geil”-Mentalitüt; weiter im gegenseitigen Uü bertrumpfen mit Anschaffungen; Urlaubsreisen. Weiter im Geprotze um das tollste Auto diese Gesellschaft hat ein Problem, welches sich sicherlich nicht durch eine Pandemie beheben lüasst. Allein der tagtüagliche Wahnsinn um Einküaufe ist bemerkenswert All jene, die fuür Lo ckerungen der Maßnahmen plaüdieren stemmen sich gegen die Heilung der Gesellschaft und sind damit Teil von Interessenverbaünden, Lobbyisten und Wirtschaft“ , die aus reinem Profitdenken handeln.
Im Ergebnis der Leopoldina-Grüoßen ist vor allem eins festzustellen: es arbeiten dort nicht nur medizinische Experten, sondern zum Großteil Menschen die der Wirtschaft verbunden sind. Ihre Meinung darf bei der politischen Entscheidung sicher beruücksichtigt werden, sie ist aber unwichtig im Hinblick auf die Gesundheit der Menschen. Fast küonnte man glauben, die Wirtschaft üangstigt sich davor, dass die Menschen bemerken, dass man die Hüalfte dessen was gekauft und konsumiert wird gar nicht braucht. Füur Dinge die man nicht braucht, muss man aber am lüangsten arbeiten. Die Mehrheit der Büurger ist üubrigens gegen eine früuhzeitige Lockerung der Maßnahmen und damit mal wieder vernüunftiger als Politiker und Berater. [...]
Dominante Metapher ist WIRTSCHAFT als PERSON, welche ruchlos und profitorientiert agiert und sich davor aüngstigt“ , dass die Pandemie zu einem Umdenken fuührt. Die Wirtschaft selbst oder ihre Interessentrüager scharren mit den Hufen“ oder Fuüßen“ , was diese mit ungeduldigen Tieren [impliziter Abspruch der Menschlichkeit] bzw. im Detail mit Scheuklappen tragenden Rennpferden assoziiert, die nicht abwarten koünnen wieder ins Rennen um Profite einzusteigen.
6.3 Der Pragmatiker
Fuür manche hat die Corona-Krise auch was gutes. Menschen mit Platzangst und Angst vor Menschen- massen,küonnen mal ruhig durchatmen und und entspannt einkaufen oder einen kleinen einsamen Spatziergang machen. Güonnt den Menschen das doch und ihr habt auch was gutes getan. Darum,schüon zu Hause bleiben.
Wie der angstgeleitete Typ appelliert der pragmatische Typ für die Einhaltung der „Regeln“, er hat jedoch kein persünliches oder ideologisches Motiv wie der angstgeleitete oder der gesellschaftskritische Typ. Vielmehr wird im pragmatischen Typen die Einhaltung der Regeln zu einer Art Selbstzweck, wobei Regeln eingehalten werden sollen, damit Regeln und Beschraünkungen nicht laünger dauern als noütig. Will der angstgeleitete Typ seine Gesundheit schuützen und der gesellschaftskritische Typ die Transformation der Gesellschaft, ist das Ziel des pragmatischen Typen ein angemessener Aus- und Umgang mit der Situation zur Ruückkehr in die Normalitaüt.“ Zu diesem Zwecke duürfen Maßnahmen nicht zu fruüh gelockert werden, damit bisherige Regelbefolgungen nicht vergebens waren und eine Ruückkehr nicht hinausgezoügert oder gar verunmoüglicht wird.
Die Forscher meinen nun,die Regeln sollten noch wenigstens 3 Wochen eingehalten werden, damit man das Ganze noch besser in den Griff bekommt. Sonst drohen noch längere und weitgreifendere Regelungen,mäglich äber Jahre. Also reist euch doch mal zusammen und versucht nach den Regeln zu leben. Die Sturheit mancher macht immer alles zu nichte. Es kann doch nicht so schwer sein, noch eine Weile auf das ganze Tam Tam zu verzichten. Komisch,all die Stubenhocker wollen nun unbedingt draussen kuscheln und sonst was. Macht es euch anders gemäutlich und schoän,geht alles!
Der pragmatische Typ ist bestrebt sich so gut es geht mit den Regeln zu arrangieren, die als noütig angesehen werden, um eine baldige Ruückkehr in die Normalitüat zu garantieren. Um diese Einsicht zu teilen, konnotiert der Pragmatiker die Situation moüglichst positiv, ruft zur Solidaritüat auf und hebt Vorteile und Rationalitaüt der Regeln, Beschrüankungen und Lage hervor, um diese in den Augen anderer akzeptabler zu machen und so zur Einhaltung zu bewegen.
Dieser Typ ist üaußerst aktiv darin, Falschmeldungen, Verschwoürungstheorien und sonstige Behauptungen, die aufwiegelnd wirken und die Einhaltungsbereitschaft der Regeln unterlaufen koünnten, zu begegnen und richtigzustellen bzw. zu entschaürfen.
Du liebe Zeit! Wenn jemand einen Herzinfarkt hat, wird er behandelt. Wenn jemand sich das Bein bricht, wird er behandelt - und genau deshalb hat man z u s äatzlicheKapazitäaten geschaffen und nicht die vorhandenen den Corona-Patienten vorbehalten. Mäusst Ihr in einer problematischen Zeit unbedingt noch Oäl ins Feuer gießen, nur weil einige von Euch gerne sehen, wie es brennt - und daraus Weltuntergangsszenarien generieren wollen? Sucht Euch doch bitte ein Hobby, um Eure offenbar äuberschäussige Energie irgendwie zu kanalisieren - vielleicht einfach soziale Hilfe? - aber lasst doch bitte die Finger von der Tastatur, wenn Ihr nur Eure destruktiven Meinungen von Euch geben koännt.
Ebenfalls zeichnet diesen Typen das Alleinstellungsmerkmal aus, der Regierung und Politik ein gutes Zeugnis auszustellen und, besonders im Vergleich mit anderen Laündern, Lob auszusprechen.
Die Leopoldina ist nicht ”irgend jemand”, sondern eine sehr angesehene Institution mit sehr angesehenen Forschern. Insofern haben ihre Hinweise Gewicht und Bedeutung - väollig unabhäangig davon, was die Regierung im Anschluss an ihre Diskussion davon entscheidet und umsetzt. Neben deren Empfehlungen spielen ja vor allem die Virologen, bzw. das RKI und auch die Uä berlegungen des Ethik-Rates eine zentrale Rolle. Insgesamt ist die deutsche Regierung mit diesem fachlichen ”Untebau” sehr gut aufgestellt und entscheidet offenbar klug - das zeigt eindrucksvoll der Verlauf der Infektion im Vergleich zu den anderen europäaischen Staaten und den USA. Und es bleibt zu hoffen, dass man sich auch zukäunftig nicht von der wohlfeilen Frage nach dem ”wann” moäglicher Erleichterungen leiten läasst, sondern ausschliesslich nach ihrer Verantwortbarkeit.
Dies unterscheidet den pragmatischen Typus vom angstgeleiteten und gesellschaftskritischen Typen, die als Befuürworter der Maßnahmen der Regierung und Politik denkbar günstiger gestimmt sein sollten. Für den gesellschaftskritischen Typen ist die Politik allerdings Kopffigur der kranken Gesellschaft und Unterstützer der Wirtschaft und findet damit kein Lob. Und den Stabilitaüt anstrebenden, angstgeleiteten Typen verünsichert die fehlende gemeinsame Politik der Bundeslüander, sowie die Meinungsverschiedenheiten der Experten“ , sodass neben vereinzeltem Lob selbst der angstgeleitete Typ mehrheitlich Kritik aüußert. Eines der Beispiele ausgepraügter Heterogenitaüt innerhalb der Gruppe der Befuürworter.
7 Gegner der Maßnahmen
Fuür Gegner der Maßnahmen lassen sich vier Denktypen heraus differenzieren: ein rechtsverletzter Typ, ein restaurativer Typ, ein regierungskritischer Typ und ein leugnender Typ. Noch mehr als fuür die Typen der Befuürworter gilt die idealtypische Natur dieser Typen, denn insbesondere zwischen den ersten drei Typen gibt es starke Uü berschneidungen.
7.1 Der Rechtsverletzte
Mit der Corona- Panik- Verbreitung hat eine ganze Nation akzeptiert, dass viele Grundrechte ausgesetzt wurden. Jetzt gilt es für uns Bürger, die Grundrechte Stück für Stück wieder zurück zu kümpfen. Es darf nicht zur Komplett-Uberwachung aller Bürger im Namen der ’’Sicherheit” kommen. Wobei ich daran meine Zweifel habe, dass alle Büurger sich dafüur einsetzen werden. Denn wie Teilnahmslos die vielen Buürger alle Grundrechte niedergelegt haben, dass war schon mehr als erstaunlich.
Fuür den rechtsverletzten Typ spielt das Virus an sich keine Rolle, die Lage wird allein anhand der vorgenommenen Maßnahmen bewertet und diese als massiver, un- rechtmaüßiger Eingriff in freiheitliche[...] Rechte“, Privatsphaüre“ und Grundrechte“ abgelehnt. Er sieht einen Machtmissbrauch der Politik und ein vorrangiges Interesse am [A]uskosten“ von Macht und Uü berwachung, von welcher befuürchtet wird, dass sie uüber die Krise hinaus andauern wird ( Die Politik hat sich hier einen Freibrief zur Uü berwachung von uns ausgestellt“).
Wenn man jetzt liest, ”die neue Normalitüat”, dann kann man doch davon ausgehen, das wir ab sofort nur noch üuberwacht werden. China lüasst grüussen. Wir als Büurger sollten aufpassen das man uns nicht zuviele Rechte aufgrund der Krise nimmt. Auch wenn die Voraussetzungen anders sind, Weimar sollte eine Warnung sein Befuürworter sprechen von den Maßnahmen uüberwiegend als Regeln“ und konnotieren diese damit positiv als noütige und sinnvolle Vorgaben.9 Der rechtsverletzte Typ dagegen spricht nicht von Regeln, sondern konnotiert die Maßnahmen weitaus negativer als uüberzogen“ , undurchdacht“ , pauschal“ , blinder Aktionismus“ , Beschraünkungen“ , Freiheitsbeschraünkung“ , Zwang“ , Gaüngelung“ , Bevormundung“ , Totale Verbote“ und „Grundgesetzverletzungen“, welche sich viele „Bürger“ „kommentarlos aufdiktieren“ ließen. Vergleiche werden gezogen zu China, der Weimarer Republik und dem Nationalsozialismus. Fur den rechtsverletzten Typen sind die Maßnahmen ein sinnloses Diktat, das ausschließlich Möglichkeiten nimmt. Ein Anzeichen für und Schritt in Richtung faschistischer Regimes.
Denn im Gegensatz zum angstgeleiteten Typen sieht der rechtsverletzte Typ den Buörger als verantwortungsvoll und keiner weitreichenden Vorgaben beduörfend. Der Buörger koönne selbst denken und fuör sich entscheiden, höalt sich ohnehin seit eh und je an hygienischen Regeln“ und benoötige entsprechend keine pauschalen Ratschlöage.“ Den Maßnahmen wird damit jede Notwendigkeit abgesprochen.
[...] Dass die allermeisten Menschen selber verantwortliche Entscheidungen treffen können und wollen, wird schlichtweg ignoriert, weil man die Macht der Bevormundung scheinbar voll auskosten will. Wer noch mehr Einschränkungen haben will, kann das ja für sich entscheiden und auch ausführen!
Ist es denn nicht möglich, den Bürgern etwas mehr Selbstverantwortung zuzutrauen. Warum kann z.B. ein kleiner Buchladen nicht üoffnen. Als ob sich da 100derte von Menschen drüangeln. Auflagen wie z.B. max. soviel Personen, Mundschutz...wer sich nicht dran hüalt macht seinen Laden wieder zu.Bekleidungsgeschüafte genauso...Jeder der verkaufen müochte wird sich hüuten die Regeln zu brechen. Traut den Büurgern mehr Selbstverantwortung zu. Totale Verbote werden nichts nüutzen auf die Dauer. Wir haben hier im Ort kleine Laüden wo ich bei besuchen noch nie mehr als 3 Personen gesehen habe. Die haben es schon schwer genug. Gebt Ihnen einfach die Müoglichkeit es wenigstens zu probieren die Regeln durchzusetzen. Andererseits habe ich immer mehr das Gefuühl, dass der Deutsche buürger eine klare Vorgabe braucht..jemanden der füur ihn denkt und der ihn lenkt.Eine starke Füuhrung. Nur nicht selber mal Verantwortung üubernehmen Metaphorisch werden Rechte als begehrte OBJEKTE behandelt, die einem genommen oder kassier[t]“ werden koönnen und umkaömpft sind oder als PERSON, die verletzt werden kann ( Grundgesetzverletzungen“).
7.2 Der Restaurator
Bei alledemwird viel zu wenig Rüucksicht auf die Wirtschaft genommen. Gerade der Teil der Gesellschaft, dem wir unsere Wohlfahrt zu verdanken haben - ausgerechnet die Wirtschaft wird in der Coronakrise mutwillig zerstüort. Soforthilfen, so hoch die Summen dem Laien auch scheinen müogen - sind nur Tropfen auf den heißen Stein und helfen bei weitem nicht allen. Vor allem jenen vielen Kleinunternehmern nicht, die keine dicken Finanzpolster besitzen, weil sie schon die letzten Jahre von der Politik stiefmüutterlich behandelt wurden und ums Uüberleben küampften. Ich spreche vom Mittelstand, dem Leistungstrüager unserer Gesellschaft und unseres Wohlstandes, nicht von steuertricksenden Heuschrecken-Konzernen. Der Mittelstand wird zugrunde gehen, wenn nicht bald gelockert wird. Und dann beginnen die Probleme erst, die wir heute noch gar nicht erahnen. Ohne Steuereinnahmen kein Sozialsstaat. Ohne diesen kein sozialer Frieden u irgendwann üuberhaupt kein Staat mehr.
Das Interesse des restaurativen Typen liegt in der umgehenden Wiederherstellung und -aufnahme des sozialen und speziell wirtschaftlichen Lebens, solange dies noch moöglich ist. Sein Denken ist dabei von einer monetaören, öokonomisch-rationalen Logik gepraögt, wobei ohne Wirtschaft“ und Arbeit“ keine Gesellschaft möoglich ist. Die derzeitigen Maßnahmen seien eine mutwillige Zerstoörung der Wirtschaft und damit der Gesellschaft, da ohne Arbeit schlicht nichts löauft.“ Soziale Unterstuötzung und die Leistung des Gesundheitssystem beduörfen Geld, das erwirtschaftet werden muß.“ Mit den Maßnahmen steht jedoch der Kollaps“ der Wirtschaft bevor, der die eigentliche Gefahr darstellt, weil dieser töodlicher als das Virus sei. Aö hnlich dem angstgeleiteten Typen bemächtigt sich der restaurative Typ dramatischen Zahlen und emotional intensiven, gedanklichen Bildern, um seiner Meinung Nachdruck zu verleihen und stellt schreckliche Folgen“ in Aussicht. Allerdings nicht bei Abkehr von den Maßnahmen, sondern deren Beibehaltung. Dann stehe die wirtschaftliche Apokalypse, deutlich schlimmer als nach dem zweiten Weltkrieg“ und der Zusammenbruch des Weltwirtschaftssys- tem[s]“bevor. Die jetzigen Maßnahmen sind „kollektive[r] Selbstmord“, fuhren Menschen an den „Rand ihrer psychischen Belastbarkeit“ und zu „hauslicher Gewalt bei Familien oder exzessiver Alkoholkonsum und/oder Depressionen bis hin zum Suizid.“
Vielleicht haben Sie ja recht , allerdings schätzen Wirtschaftsökonomen die Lage jetzt schon schlimmer ein als nach dem zweiten Weltkrieg . Sie erwarten deutlich mehr Tote durch den Crash der Wirtschaft als durch Corona und die Talfahrt soll noch mindestens bis Mitte 2021 weitergehen . Das wird dann Hungersnoöte und Flöuchtlingswellen verursachen die wir uns nie höatten vorstellen köonnen . Dann werden wir eher öuber Millionen Tote als öuber 150 tsd reden .
Der restaurative Typ ladt durch solche Vergleiche die gesamte Gefahr der jetzigen Situation auf den Zusammenbruch der Wirtschaft, wahrend das Virus selbst kaum und wenn, dann verharmlosend oder rational behandelt wird, als eine Gegebenheit mit der man leben muss.
Den Wissenschaftlern, die hier allen Ernstes meinen, wir koönnten uns nur retten, wenn wir den Viren zeitlebens aus dem Weg gehen, kann ich nur raten, sich in das hinterste Mauseloch zu verkriechen!
Wenn wir nicht lernen, mit dem Virus zu leben oder es zu öuberleben, wird nur einer öuberleben: das Virus. Fuör solche ”Ratschlöage” brauchen die zig Semester, und trotzdem hat fast jeder eine andere Meinung und entsprechende Vorschlöage! Die letzte Grippewelle (2018) hatte in Deutschland noch eine wesentlich gröoßere Dimension (25100 Tote alleine in Deutschland), weil die Hersteller des Impfstoffes auf das falsche ”Pferd” gesetzt haben. Eine Panik gab 's damals allerdings nicht. Viele Krankheiten haben wir schon besiegt, auch ohne uns zu verkriechen! (oder gerade deshalb!)
Im Gegensatz zu den Befürwortern der Maßnahmen, welche den lockernden Handlungsempfehlungen der Leopoldina größtenteils ablehnend gegenüberstehen, sieht der restaurative diese als alternativlos“ und sollten sofort“ umgesetzt werden.
Die Handlungsempfehlungen von Leopoldina sind zielföuhrend und sollte zöugig umgesetzt werden ( damit meine ich sofort )Mein Hausarzt , dem ich seit Jahren vertraue , sagt : Corona ist echt böose aber wir köonnen das Leben nicht einstellen dann vernichten wir unser Gesundheitssystem das wir dringend brauchen . Und : Social Distanz ? Was soll das sein , wöurde im Endeffekt ja recht zöugig zum Aussterben der Menschheit föuhren . Wir sollten die Geföahrdeten schöutzen und nicht kollektiv Selbstmord begehen , wie wir es gerade versuchen .
Metaphorisch wird die Wirtschaft als GEBAü UDE, MASCHINE oder PERSON kon- zeptualisiert. Als Gebaüude kann die Wirtschaft zusammenbrechen. Als Maschine kann die Wirtschaft funktionieren[...]“ , kaputt“ gehen, Fahrt aufnehmen“ und abgewuürgt werden. Es gilt die Wirtschaft wieder hochzufahren und einen Crash“ bzw. ein vor die die Wand fahren“ (Autounfall) zu verhindern. Als Person kann die Wirtschaft lahmgelegt werden (Lüahmung), sogar sterben. Mann muüsse auf sie Ruücksicht“ nehmen. Die drei Metaphern stellen dabei je andere Aspekte in den Vordergrund. Ein zusammengebrochenes Gebüaude ist nicht oder nur unter sehr großem Aufwand wiederherstellbar. Mit der MASCHINE Metapher wird die Leistungsfaühigkeit der Wirtschaft und der Steuerungsaspekt in den Vordergrund geruückt, mit dem Verantwortlichkeit auf diejenigen gerichtet wird, welche die Wirtschaft mutwillig“ in den Crash“ steuern. Mit der
PERSON Metapher wird die Verletzlichkeit der Wirtschaft in den Vordergrund gerückt und Empathie erzeugt.
7.3 Der Regierungskritiker
Diese Pandemie kam fur unsere ’’führenden” Politiker zur Unzeit. Das gegenwärtige Hoch der Regierungsparteien wird sich als Strohfeuer erweisen, das sich bei schlechtesten Willen nicht bis zur nüchsten Wahl ausdehnen lüasst. Wenn nicht sehr bald kluge Eintscheidungen getroffen werden, bicht alles zusammen. Sich alleine auf widersprüuchliche Empfehlungen von rivalisierenden wissenschaftlichen Instituten zu verlassen, wird sich als Bumerang erweisen. Veranrtwortung wird von denen keiner üubernehmen. Die sind vielmehr daran interessiert, den gegenwüartigen Geldsegen nüoglichst lange zu erhalten. Das uneingeschrüankte Auffangen der wirtschaftlichen Schaüden ist nur mit auf Vollgas laufenden Gelddruckmaschinen zu machen. Die Folgen davon sind ein Albtraum, den unsere Großeltern schon trüaumen ”durften”.
Das Hauptanliegen des Regierungskritikers ist die Verunglimpfung wissenschaftlicher und speziell politischer Eliten“ , die er vom Normalbuürger“ distinguiert. Dazu bedient er sich einer vielfaültigen, argumentativen Mischung eigener Unterstellungen und Behauptungen, sowie argumentativer Aspekte aller anderen Typen, solange sich damit Eliten in ein schlechtes Licht ruücken lassen. Aü hnlich dem Gesellschaftskritiker ist dem Regierungskritiker das Virus ein Mittel zum Zwecke der Kritik bzw. der Rechtfertigung und Ausdrucksverleihung seiner Unzufriedenheit. Das Virus selbst wird kaum und wenn, opportunistisch b ehandelt. Im thematischen Vordergrund steht das Versagen der Eliten, vorrangig Wissenschaft, Bundesregierung und einzelner Politiker.
Wissenschaftlern wird vorgeworfen sich staündig zu widersprechen, sich uneinig, allein am Aufrechterhalten des gegenwaürtigen Geldsegen“ interessiert, nicht relevant oder staatlich gelenkt zu sein und damit deren Wissen und Empfehlungen Wertigkeit abgesprochen.
wer bitte schüon, außer Gelehrte, hat das Dasein von Leopoldina je bemerkt. So notwendig ich die forschenden und wissenschaftlichen Einrichtungen schaütze, so gefüahrlich finde ich den Beinamen National, da nachweislich der Staat das Sagen hat wie zum Beispiel RKI, welches garantiert nur Ergebnisse im Sinne der Regierung veroüffentlicht.
Viele Politiker seien inkompetent, Schwaützer und Selbstdarsteller“ und hoch bezahlte Schauspieler“ , die jeden Tag etwas anderes sagen und es versaüumt haütten sich auf eine Pandemie vorzubereiten. Aus niederen Interessen gar wichtige Informationen und Forschung, mit der die Pandemie eingedüammt hüatte werden küonnen, ignoriert respektive eingestampft“ haütten. Der konkrete Umgang der Politiker mit der Krise ist Plan- und ziellos.“
Das Herumgeeiere jetzt zeigt, dass man vorher nicht im Geringsten auf einen Plan geschaut hat. Vermutlich wussten die Entscheidungstraüger gar nicht, dass sie seit Januar 2013 ein Strategiepapier des Bundestages in ihren Schubladen haben - irgendwo tief unten vergraben, noch unter den Wahlversprechen, die man ja wenigstens alle 4 Jahre wieder hervorholen muss. Stattdessen verlüasst man sich auf ein unorganisiertes Institut, dessen Namensgeber R.Koch vermutlich im Grab rotiert, sowie eine amerikanische Privatuniversitüat, die offenbar eher an unsere Zahlen kommt als wir selber. Plan- und ziellos, learning by doing, ad-hoc-Aktion - wie soll man den Umgang mit Corona nennen? [...]
Corona ist Neuland?..Neuland wüare es wenn Aliens gelandet wüaren! Pandemien gibt es seit Menschengedenken, die letzte war die viel zitierte spanische Grippe, die Schweinegrippe war der Warnschuß den keiner gehüort hat in Politik und Wissenschaft.! Füur was gibt es diese elitüaren, subventionierten, hoch technisierten Institute mit den geistigen Eliten des Planeten, dass die Weltbevoülkerung jetzt dasteht und nur Hände waschen und Stoff aufs Gesicht binden kann um das schlimmste zu verhindern? Ganz offensichtlich wurde es versaumt die finanziellen wie auch Forschungsrelevanten Ressourcen entsprechend zu forcieren und hat lieber kurzfristige Anlegerinteressen bedient.
Das Virus wird opportunistisch thematisiert, z.B. verharmlosend durch den Verweis darauf auf Todeszahlen zum Jahresende abzuwarten, „wenn die Statistiken um die Falle bereinigt wurden, welche auch ohne Corona gestorben“ waren und die Unverhältnismäßigkeit der Maßnahmen zeigen sollen. Oder im Vergleich mit der Grippe, um der Regierung ein unbestaändiges und nicht nachvollziehbares Verhalten anzulasten.
Wo waren eigentlich unsere Politiker 2017/2018, als eine Grippeepidemie alleine in Deutschland 25100 Menschen hinweg raffte (Quelle: Deutsches Arzeblatt 09/2019)? Waren diese Menschen weniger wert? Was ist jetzt anders? Auch eine ”Schutzimpung” hilft nur sehr begrenzt und ist nicht mehr als ein Zufallstreffer, weil sich die Viren einfach nicht an die Vorgaben halten. Wir dürfen also in Zukunft damit rechnen, dass ” Wissenschaftler” von rivalisierenden Instituten immer üfter das Heft in die Hand nehmen werden!?
Im Versuch der Verunglimpfung greift der Regierungskritiker teils auf Falschinformationen zuruäck, z.B. auf die Behauptung Deutschland waäre von einer weniger aggressiven Corona-Spielart“ befallen, was die im Läandervergleich geringen Todeszahlen in Deutschland verantworte und nicht die politischen Maßnahmen.
Dieser Typ scheint, äahnlich Verschwoärungstheorikern, häaufiger dem Fehlschluss zu erliegen, dass nur eine individuelle, von anderen abweichende Meinung eine eigene Meinung sei und eine geäanderte Meinung ein Indiz fuär eine Luäge, anstelle eines Informationsgewinns.
Selbstverstüandlich muss jeder, der der vorgegebenen Meinung nicht folgt, schüarfstens bekaümpft werden. Wo kommen wir denn hin, wenn in der Wissenschaft jeder Forscher und ...-loge eigene Schlüusse zieht? In der Klimafrage hat es doch auch ganz gut funktioniert. Alles auf Linie, 99% Zustimmung zu einer These - mit den paar Abweichlern und Leugnern wird man doch fertig, oder?
Dieser Typ resoniert stark mit dem zweiten Teil des Artikels, welcher Politik metaphorisch als Theater behandelt und bereits einiges an Munition fuär Kritik an dieser bereitstellt
7.4 Der Leugner
Wen man das alles in den letzten Wochen gelesen hat und was jeden Tag von unseren Medien, in billigem Druckwerk immer wieder aufs Neue unter das Volk gebracht wird , macht das alte Sprichwort auch Sinn : Du musst eine Lüuge nur tausendmal wiederholen , dann wird sie am Ende auch geglaubt.Ich kann Euch nur raten , glaubt nicht jeden Unsinn den ihr in den Medien hüort und seht.Mit der Angst kann man ein Volk gefüugig machen und unter Kontrolle halten, denkt daran !!!
Der leugnende Typ grenzt sich von den anderen Typen dadurch ab, dass er die Existenz von Sars-CoV-2 bestreitet. Er spielt im äoffentlichen Diskurs eine geringe Rolle, so entfallen in dieser Stichprobe nur 2 Kommentare auf diesen Typen, und auch in den Kommentaren anderer News-Seiten scheint er kaum vertreten. Die uäberwäaltigende Mehrheit der deutschen Bevoälkerung scheint die Existenz von Sars-CoV-2 als Tatsache zu betrachten, was als Grundvoraussetzung dafuär angesehen werden kann, dass Maßnahmen Zuspruch finden, eingehalten werden und entsprechend wirken. In einzelnen Foren und z.B. Kommentarspalten von YouTube-Kanalen, wie z.B. der Tagesschau, ist dieser Typ jedoch durchaus gewichtig vertreten.
8 Schlussdiskussion
Ausgehend von der Frage inwiefern sich Befürworter und Gegner der vom 22. Marz verhängten Maßnahmen zur Eindämmung von Sars-CoV-2 in ihren Erklärungen, Argumenten, Denkweisen, Interessen und Metaphern unterscheiden, konnten 3 idealtypisch abgrenzbare Denktypen auf Seiten der Befuärworter und 4 auf Seiten der Gegner ausgemacht werden. Diese Typen sind in Tabelle 1 zusammengefasst.
Tabelle 1: Uä berblick uäber Denktypen
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Tab. 1: Erste Spalte: Interesse. Zweite Spalte: Motive, Schlagwörter. Dritte Spalte: Dominante Metaphern.
Auch wenn die Herausarbeitung von Unterschieden zwischen den beiden Gruppen Ziel der Untersuchung ist, soll nicht unerwähnt bleiben, dass ebenso viele Gemeinsamkeiten auffallen. So wird über Gruppen hinweg auf ähnliche Konzepte zurückgriffen, die jedoch unter anderem Fokus angewendet werden, z.B. Konzeptualisierungen von Ausbreitung“ oder Verbreitung“ mit dem etwas als geeinte Masse konzeptualisiert wird, die in der Breite zunimmt bzw. waüchst. Der Angstgeleitete z.B. wendet dieses Konzept auf das Virus an, wüahrend der Regierungskritiker es auf die Panik der Menschen anwendet. Oder die Konzeptualisierung als PERSON, eine Erfahrungseinheit mit Hilfe welcher allerlei andere Erfahrungen behandelt werden und in unterschiedlichem Maße von allen Typen verwendet wird. Zwei Beispiele allgegenwüartiger Komplexitüatsreduktionen, um Ereignisse und Erfahrungen fassbar zu machen. Das Virus z.B. wird als virtuelle Einheit konzeptualisiert (Langacker, 2008: 36), um es sprachlich verorten, Bezug darauf nehmen, es als etwas Bekanntes, nüamlich eine Person, behandeln zu koünnen, obgleich man uüber Trilliarden von lokal nicht fassbaren, nicht nüaher bekannten, weil an sich nicht erfahrenen Viren mit ebenso vielen kleineren, genetischen Abweichungen untereinander spricht.
Bei Argumentationen wird oftmals auf eigene, selektive Erfahrungen verwiesen, fuür die explizit oder implizit Allgemeinguültigkeit beansprucht wird. Das ist schluüssig, da Bedeutung in der eigenen Erfahrung liegt und am eigenen Leib‘ gemachte Erfahrungen wahrer und realer‘ wirken als Erfahrungen von Bildern oder Worten aus Medien. Sehr haüufig tritt dazu der Versuch die eigene Meinung zu staürken, indem fuür sie eine Mehrheit beansprucht wird, sei es durch explizites Herausstellen ( ich und die Mehrheit der Buürger sehen das jedenfalls so“ ) oder implizit durch das Nutzen von Pronomen wie uns“ , wir“ , die Buürger“ etc.
Daruüber hinaus sind Zahlen, Statistiken und Vergleiche festes Repertoire von Kommentatoren, um Argumentationen zu untermauern, die Situation einordnen und bewerten zu koünnen. Nicht zuletzt, da Seiten wie worldometers.info das Geschehen in Zahlen, Grafiken und Statistiken erschließen und in Echtzeit aktualisieren. Aber auch offizielle Stellen wie das Robert-Koch-Institut, Staüdte, Bund und Laünder greifen in ihren Empfehlungen und politischen Entscheidungen auf Zahlen zuruück, z.B. auf die viel genannte Reproduktionszahl, und etablieren diese als ausschlaggebende und dominante Diskurselemente. Ein weiteres Anzeichen fuür eine zunehmend quantitative und komparative Ausrichtung der Gesellschaft (Mau, 2017).
Interessante Folgeuntersuchungen waüren die Analyse von Laünderunterschieden in den Diskussionen, Meinungen und Einstellungen zu Corona, deren Entwicklung im Zeitverlauf und Einfluss auf den Umgang mit Epidemien. Metaphern, die 2003 in der SARS Epidemie in der UK hohe Verwendung fanden, z.B. SARS ist ein KILLER und SARS ist ein KRIMINELLER (Wallis und Nerlich, 2005) sind in den hier analysierten Kommentaren weniger bzw. nur vereinzelt beim angstgeleiteten Typen relevant. Die Metaphorisierung der Epidemie als KRIEG und dem Virus als FEIND wie sie z.B. vom amerikanischen Präsidenten vorgenommen wird,10 spielt ebenfalls keine große Rolle. Generell sind emotional intensive Metaphorisierungen des Virus selten und kommen wenn, dann beim angstgeleiteten Typen vor. Das konnte daran liegen, dass zum Zeitpunkt des Artikels für viele Sars-CoV-2 nur eine distanzierte Bedrohung oder gar nüchterner Fakt aus den Medien darstellte. Dafür spricht, dass zu diesem Zeitpunkt nur etwa 8% der Deutschen Personen aus ihrem Umfeld kannten, bei denen Sars-CoV-2 nachgewiesen wurde (Goersch und Knuth, 2020: 9). Fuür die meisten hat das Virus an sich also keine persoünliche Relevanz, lediglich indirekt uüber die politischen Maßnahmen auf Grund des Virus.
Hierin liegt die inhaürente Crux der Maßnahmen. Je einschrüankender und effektiver sie sind, desto weniger Menschen machen direkte‘ Erfahrungen mit dem Virus, messen dem Virus geringere Relevanz zu und haben eine geringere Akzeptanzbereitschaft, aufgrund der, den Maßnahmen zugeschriebenen, erfahrenen negativen Konsequenzen. Ob diese Akzeptanzbereitschaft auf Dauer durch eine mediale Realitaüt der Zahlen und Vergleiche, die persoünliche Eindringlichkeit und Relevanz simulieren, aufrechterhalten werden kann, ist fraglich. Schon in dieser Stichprobe haben Gegner der Maßnahmen eine laute Stimme und neuere Studien zeigen, dass die eingangs sehr hohe Akzeptanz der Maßnahmen Stuück fuür Stuück sinkt (Blom et al., 2020). Man wird sehen wie sich diese soziale Dynamik ausspielt.
Literatur
Arnheim, R. (2000). Kunst und Sehen. Berlin: Walter de Gruyter.
Bateson, G. (1987). Steps to an Ecology of Mind: Collected Essays in Anthropology, Psychiatry, Evolution, and Epistemology. Northvale, NJ: Jason Aronson.
Berlin, B., Breedlove, D. & Raven, P. (1974). Principles of Tzeltal Plant Classification. An Introduction to the Botanical Ethnography of a Mayan-speaking People of Highland Chiapas. New York, New York: Academic Press.
Biocca, F. A. (1988). Opposing Conceptions of the Audience: The Active and Passive Hemispheres of Mass Communication Theory. Annals of the International Communication Association, 11 (1), 51-80. https://doi.org/10.1080/23808985. 1988.11678679
Blom, A., Wenz, A., Rettig, T., Reifenscheid, M., Neumann, E., Möhring, K., Lehrer, R., Krieger, U., Juhl, S., Friedel, S., Fikel, M. & Cornesse, C. (2020). Die Mannheimer Corona-Studie: Das Leben in Deutschland im Ausnahmezustand. Bericht zur Lage vom 20. Maörz bis 6. Mai 2020.
Breuer, F., Dieris, B. & Muckel, P. (2019). Reflexive Grounded Theory. Eine Einführung in die Forschungspraxis (4. Aufl.). Wiesbaden: Springer VS.
Desimone, R. & Duncan, J. (1995). Neural Mechanisms of Selective Visual Attention. Annual Review of Neuroscience, 18 (1), 193-222. https : / /doi .org/ 10 . 1146 / annurev.ne.18.030195.001205
Gilbert, C. (2013). Intermediate-Level Visual Processing and Visual Primitives. In E. Candel, J. Schwartz, T. Jessell, S. Siegelbaum & A. Hudspeth (Hrsg.), Principles of Neural Science (5. Aufl., S. 602-620). New York: McGraw Hill Medical.
Glaser, B. G. (1978). Theoretical Sensitivity: Advances in the Methodology of Grounded Theory. Mill Valley, CA: Sociology Press.
Glaser, B. G. (1998). Doing Grounded Theory: Issues and Discussions. Mill Valley, CA: Sociology Press.
Goersch, H. & Knuth, D. (2020). Akkon-Bevöolkerungsstudien zu Verhalten, Erleben und Bewaöltigung der deutschen Bevoölkerung in der Corona-Krise (Stand: 03.04.2020). Akkon Hochschule füur Humanwissenschaften.
Hampe, B. (2005). Image schemas in Cognitive Linguistics: Introduction. In B. Hampe
& J. Grady (Hrsg.), From Perception to Meaning. Image Schemas in Cognitive Linguistics (S. 1-14). Berlin: Mouton de Gruyter. https: //doi.org/10. 1515 / 9783110197532.0.1
Hebb, D. O. (2002). The Organization of Behavior. A Neuropsychological Theory. Mah- wah, NJ: Lawrence Erlbaum.
Herzog, M. H., Kammer, T. & Scharnowski, F. (2016). Time Slices: What Is the Duration of a Percept? PLOS Biology, 14 (4), 1-12. https://doi.org/10.1371/journal. pbio.1002433
Johnson, M. (1987). The Body in the Mind. Chicago: The University of Chicago Press.
Kövecses, Z. (2016). Conceptual Metaphor Theory. In E. Semino & Z. Demjen (Hrsg.), The Routledge Handbook of Metaphor and Language. Abingdon, Oxon, NY: Routledge.
Koövecses, Z. (2017). Levels of Metaphor. Cognitive Linguistics, 28 (2), 321-347. https: //doi.org/10.1515/cog-2016-0052
Lakoff, G. (1989). Some Empirical Results about the Nature of Concepts. Mind & Language, 4 (1-2), 103-129. https://doi.org/10.1111/j.1468-0017.1989.tb00244.x
Lakoff, G. (1993). The Contemporary Theory of Metaphor. In A. Ortony (Hrsg.), Metaphor and Thought (S. 202-251). Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/cbo9781139173865.013
Lakoff, G. (2014). Mapping the Brain’s Metaphor Circuitry: Metaphorical Thought in Everyday Reason. Frontiers in Human Neuroscience, 8. https://doi.org/10. 3389/fnhum.2014.00958
Lakoff, G. & Johnson, M. (2003). Metaphors We Live By. Chicago, London: University of Chicago Press.
Langacker, R. (2008). Cognitive Grammar: A Basic Introduction. New York: Oxford University Press.
Leydesdorff, L. (2011). Meaning as a Sociological Concept: A Review of the Modeling, Mapping and Simulation of the Communication of Knowledge and Meaning. Social Science Information, 50 (3-4), 391-413. https://doi.org/10. 1177/ 0539018411411021
Luhmann, N. (1991). Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie (4. Aufl.). Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Mau, S. (2017). Das metrische Wir. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Meister, M. & Tessier-Lavigne, M. (2013). Low-Level Visual Processing: The Retina. In E. Candel, J. Schwartz, T. Jessell, S. Siegelbaum & A. Hudspeth (Hrsg.), Principles of Neural Science (5. Aufl., S. 577-601). New York: McGraw Hill Medical.
Peschl, M. F. (1990). Cognitive Modelling. Ein Beitrag zur Cognitive Science aus der Perspektive des Konstruktivismus und des Konnektionismus. Wiesbaden: DUV Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-663-14658-2
Talmy, L. (2000). Toward a Cognitive Semantics. Volume I: Concept Structuring Systems. Cambridge: MIT Press.
van Gorp, B. (2010). Strategies to take Subjectivity out of Framing Analysis. In P. D’Angelo & J. A. Kuypers (Hrsg.), Doing News Framing Analysis: Empirical and Theoretical Perspectives (S. 84-109). New York, London: Routledge.
Wallis, P. & Nerlich, B. (2005). Disease Metaphors in New Epidemics: the UK Media Framing of the 2003 SARS Epidemic. Social Science & Medicine, 60 (11), 26292639. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2004.11.031
Weber, M. (1922). Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre. Tübingen: Verlag von J.B.C. Mohr (Paul Siebeck).
Wood, M. L., Stoltz, D. S., Ness, J. V. & Taylor, M. A. (2018). Schemas and Frames. Sociological Theory, 36 (3), 244-261. https://doi.org/10.1177/0735275118794981
[...]
1 https://www.worldometers.info/coronavirus (Zugriff: 26.04.2020)
2 Worldometers.info wurde laut Similar Web allein im Marz 2020 annähernd eine Milliarde Mal besucht. Für gewöhnlich hat die Seite pro Monat um die 4 Mio. Besucher.
3 Siehe Besprechung der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Lander (Zugriff: 26.04.2020)
4 https://www.t-onlme.de/nachrichten/id_87699504 (Zugriff: 30.04.2020)
5 https://www.similarweb.com/website/t-online.de (Zugriff: 30.04.2020)
6 Im selben Zeitraum: sueddeutsche.de (50900), focus.de (38400 Treffer), welt.de (37000), faz.net (32600), n-tv.de (31000), bild.de (20900), zeit.de (11400), taz.de (7730), spiegel.de (7650).
7 https://www.leopoldina.org/publikationen/detailansicht/publication/coronavirus-pandemie-die-krise-nachhaltig-ueberwinden-13-april-2020/ (Zugriff: 30.04.2020)
8 spiegel.de, Bild.de, focus.de, 9Gag, YouTube, gmx.de, web.de etc.
9 Regeln sind Einschränkungen, aber eine Regel wird als Möglichkeiten schaffende Einschränkung betrachtet, z.B. Spielregeln, die durch Einschränkungen das Spiel öberhaupt erst kreieren und spielbar machen.
10 https://www.youtube.com/watch?v=mVAhBfRDXec (Zugriff: 10.05.2020).
- Arbeit zitieren
- Marco Hauptmann (Autor:in), 2020, Coronas Metaphern. Wir wir uns eine Pandemie begreiflich machen. Eine Frame-Analyse anhand von Online-Kommentaren, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1597784