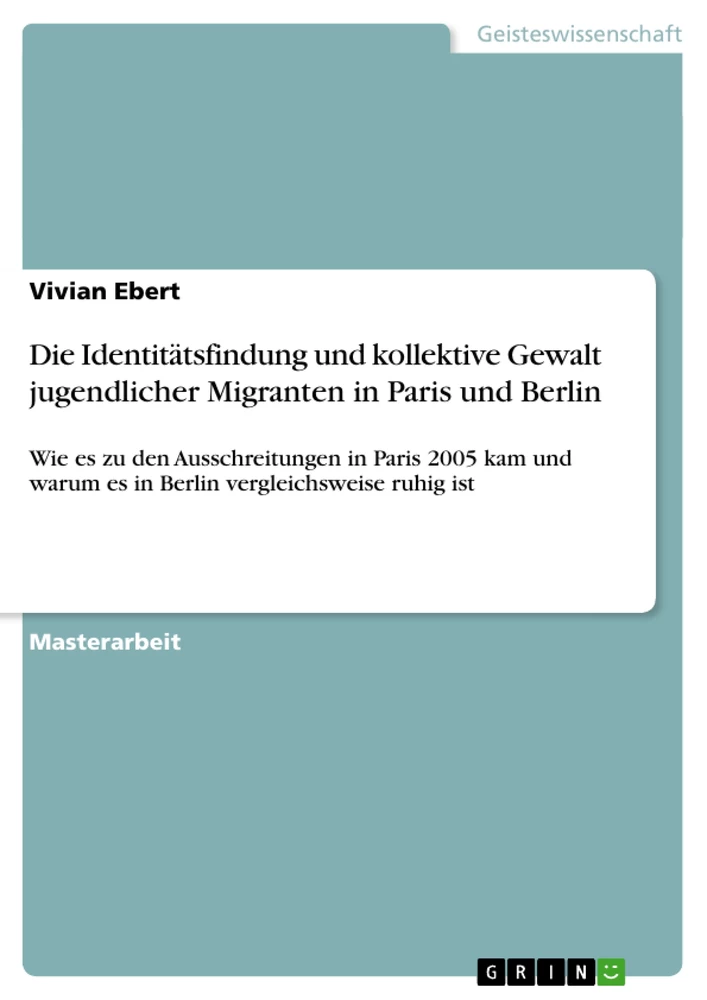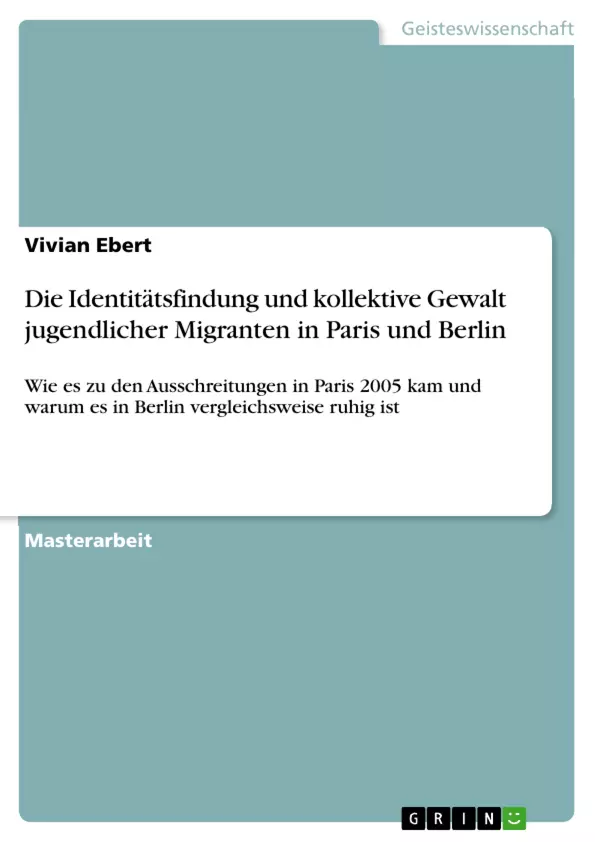Die brennenden Autos bei gewalttätigen Ausschreitungen in Pariser Vororten erregten 2005 viel Aufmerksamkeit über die Grenzen Frankreichs hinweg, denn die randalierenden Franzosen mit Migrationshintergrund schienen die Grundwerte der Republik, die stolz ist auf ihre Ideale der Universalität und Gleichheit, in Frage zu stellen. Als die Ausschreitungen in Paris im November 2005 ausbrachen, stellten Berichte über das Thema häufig die Frage an Politiker und Kriminologen, ob solche massiven Krawalle auch in Deutschland vorkommen könnten. Viele Befragte waren der Meinung,
dass es sicherlich das Potenzial und mögliche Auslöser für solche Ausschreitungen gäbe, denn die zunehmende Frustration unter arbeits- und ausbildungslosen Jugendlichen in den sozialen Brennpunkten schien ganz ähnlich wie in Paris. Der ehemalige innenpolitische Sprecher der CDU-Bundestagsfraktion Wolfgang Bosbach zum Beispiel beurteilte die Situation kritisch: „Auch wenn die gesellschaftliche Realität bei uns anders ist, sollten wir uns nicht der Illusion hingeben, dass so etwas wie in Frankreich bei uns nicht geschehen könnte“ (zitiert in Frankfurter Allgemeine, 5. November 2005). Politiker in Deutschland wie der ehemalige Innenminister Brandenburgs Jörg Schönbaum (CDU) kritisierten, dass die Integration für eine zu lange Zeit nicht ernst genommen wurde, was zu Gettoisierung und zusätzlicher Gewalt führte (ebd.). Bis heute sind gewalttätige Ausschreitungen jugendlicher Migranten in der Form wie in Paris auf Berliner Straßen allerdings nicht zu sehen gewesen. Wie Ottersbach und Zitzmann (2009) schreiben: „Die Bilder aus Frankreich von Straßenschlachten, Verfolgungsjagden und brennenden Autos haben bisher nach wie vor für Deutsche eher einen exotischen Charakter“ (S.10). Die Krawalle zwischen türkischen Jugendlichen und Berliner Polizisten im Kreuzberger Wrangelkiez 2006 sind eins der wenigen vergleichbaren Ereignisse, doch sie hielten nur einen Tag an und blieben auf den Stadtteil beschränkt. Der wichtigste Grund für den Vergleich sind die Integrationsmodelle in Deutschland und Frankreich, die sich in ihrer Prägung durch die traditionellen Nationalbilder stark unterscheiden. Da die Lebenssituation der Jugendlichen mit Migrationshintergrund in den beiden Städten im Grunde genommen ähnlich ist, muss der Unterschied im Mobilisierungspotenzial für Krawalle wohl im Feindbild liegen, das die Ausschreitungen motiviert hat.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die urbanen Ausschreitungen in Paris und Krawalle in Berlin
- Definitionen und Konzepte der Jugendgewalt
- Nationales Selbstverständnis und Einwanderungspolitik in Frankreich und Deutschland
- Die Konstruktion der Selbst- und Kollektividentität im Zusammenhang mit der Fremdheit, dem städtischen Raum und der Staatsangehörigkeit
- Zwischen Identität und Alterität - Exklusion und Inklusion
- Die Medien und Stigmatisierung
- Die kollektive Wahrnehmung der Andersartigkeit
- Identitätsspannungen zwischen der Einheimischen- und Herkunftskultur im städtischen Raum
- Die Rolle der Staatsangehörigkeit bei der Identitätskonstruktion
- Die Sozialisierung der jugendlichen Migranten in der Schule
- Der schulische Raum in der Sozialisierung, Identifizierung und Diskriminierung von Jugendlichen
- Das Nationalbild in Struktur und Mission der Schule
- Die institutionelle Diskriminierung in der Schule
- Vermittlung der Nationalbilder in den Schulen
- Der schulische Misserfolg in der Vermittlung von Perspektivlosigkeit und Frustration
- Der Zusammenhang zwischen der Schule, dem Nationalbild und der Identitätskonstruktion
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Ursachen für die unterschiedlichen Formen von jugendlicher Gewalt in Paris und Berlin. Sie beleuchtet die Rolle der Identitätsfindung und der kollektiven Gewalt von jugendlichen Migranten in beiden Städten und untersucht, wie die unterschiedlichen Integrationsmodelle in Frankreich und Deutschland dazu beitragen, dass es in Paris zu weitreichenden Ausschreitungen kam, während Berlin vergleichsweise ruhig geblieben ist.
- Identitätsfindung und kollektive Gewalt von jugendlichen Migranten
- Integrationsmodelle in Frankreich und Deutschland
- Rolle des Nationalbildes in der Identitätskonstruktion
- Sozioökonomische Bedingungen und ihre Auswirkungen auf die Jugendgewalt
- Medien und ihre Rolle bei der Konstruktion von Feindbildern
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und den Kontext der Arbeit dar, indem sie die gewalttätigen Ausschreitungen in Paris 2005 und die vergleichsweise ruhige Situation in Berlin kontrastiert. Sie hebt die Bedeutung der unterschiedlichen Integrationsmodelle in beiden Ländern hervor und legt den Fokus auf die Rolle der Identitätskonstruktion im Kontext von Migration und sozialer Benachteiligung.
- Die urbanen Ausschreitungen in Paris und Krawalle in Berlin: Dieses Kapitel beleuchtet die Ereignisse in Paris und Berlin, die den Ausgangspunkt der Untersuchung bilden. Es analysiert die Ursachen für die Ausschreitungen in Paris und untersucht die vergleichsweise geringe Gewaltbereitschaft jugendlicher Migranten in Berlin.
- Definitionen und Konzepte der Jugendgewalt: Dieses Kapitel stellt verschiedene Theorien und Konzepte zur Erklärung von Jugendgewalt vor. Es beleuchtet die spezifischen Merkmale der Jugendgewalt im Kontext von Migration und sozialen Benachteiligungen.
- Nationales Selbstverständnis und Einwanderungspolitik in Frankreich und Deutschland: Dieses Kapitel analysiert die unterschiedlichen Integrationsmodelle in Frankreich und Deutschland. Es untersucht, wie die traditionellen Nationalbilder die Einwanderungspolitik und die Integration von Migranten beeinflussen.
- Die Konstruktion der Selbst- und Kollektividentität im Zusammenhang mit der Fremdheit, dem städtischen Raum und der Staatsangehörigkeit: Dieses Kapitel befasst sich mit den Mechanismen der Identitätskonstruktion bei jugendlichen Migranten. Es analysiert die Rolle der Medien, der öffentlichen Meinung und des Schulsystems in der Bildung von Selbstidentitäten und der Wahrnehmung der Andersartigkeit.
- Die Sozialisierung der jugendlichen Migranten in der Schule: Dieses Kapitel untersucht die Bedeutung der Schule als Sozialisationsort und ihren Einfluss auf die Identitätsbildung von jugendlichen Migranten. Es beleuchtet die Rolle des Nationalbildes in der Schulstruktur und die Auswirkungen von institutioneller Diskriminierung auf die schulischen Leistungen.
- Der Zusammenhang zwischen der Schule, dem Nationalbild und der Identitätskonstruktion: Dieses Kapitel untersucht die Interaktion zwischen dem Schulsystem, dem Nationalbild und der Identitätskonstruktion von jugendlichen Migranten. Es zeigt auf, wie schulische Erfahrungen und die Wahrnehmung des Nationalbildes die Selbstwahrnehmung und das Mobilisierungspotenzial für Gewalt beeinflussen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Themen der Identitätsfindung, der kollektiven Gewalt, der Integration, der Einwanderung, der Migration, des Nationalbildes, der Jugendgewalt, der sozialen Benachteiligung, der Medien und der Schule. Sie fokussiert auf die städtischen Räume von Paris und Berlin und untersucht die Rolle der Integration in Frankreich und Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Warum kam es 2005 in Paris zu massiven Ausschreitungen?
Ursachen waren soziale Ausgrenzung, Frustration über Arbeitslosigkeit in den Banlieues und Spannungen zwischen Migranten und dem Staat.
Warum blieb es in Berlin vergleichsweise ruhig?
Unterschiedliche Integrationsmodelle und eine andere städtische Struktur führten dazu, dass das Mobilisierungspotenzial für Krawalle in Berlin geringer war.
Welche Rolle spielt die Schule bei der Identitätsfindung?
Die Schule vermittelt Nationalbilder; institutionelle Diskriminierung oder schulischer Misserfolg können jedoch zu Frustration und Identitätskonflikten führen.
Wie beeinflussen Medien die Stigmatisierung von Migranten?
Medienberichte können Feindbilder verstärken und soziale Brennpunkte als gefährlich brandmarken, was die Ausgrenzung der Bewohner vertieft.
Was ist der Unterschied zwischen Inklusion und Exklusion?
Inklusion bedeutet die Einbeziehung in die Gesellschaft, während Exklusion den Ausschluss von sozialen, politischen und wirtschaftlichen Ressourcen beschreibt.
- Citation du texte
- Vivian Ebert (Auteur), 2009, Die Identitätsfindung und kollektive Gewalt jugendlicher Migranten in Paris und Berlin, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/159789