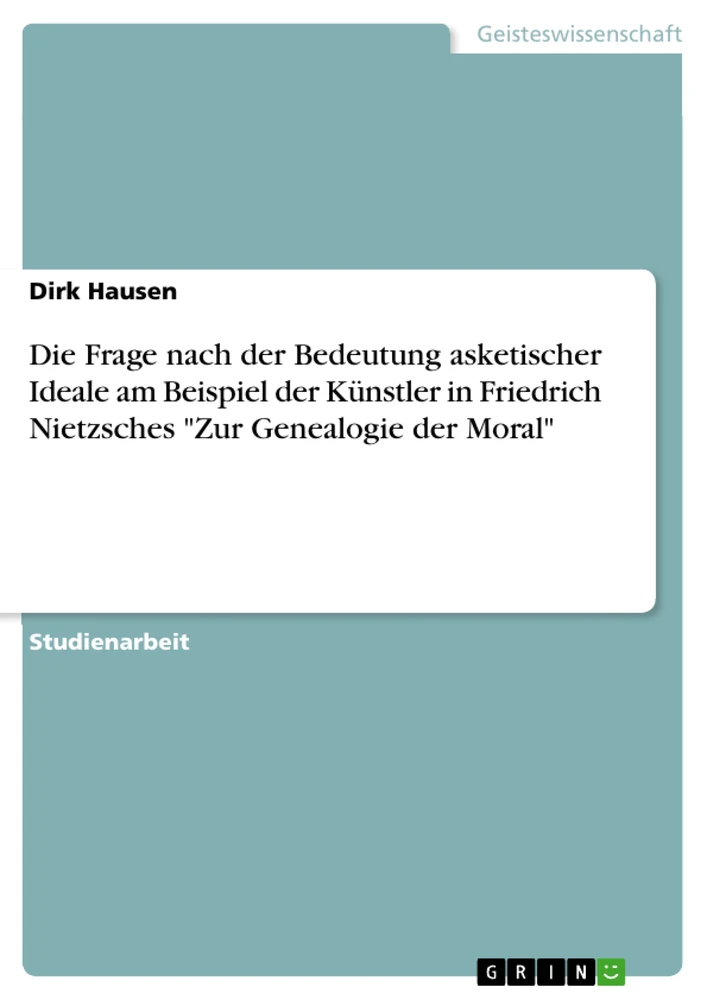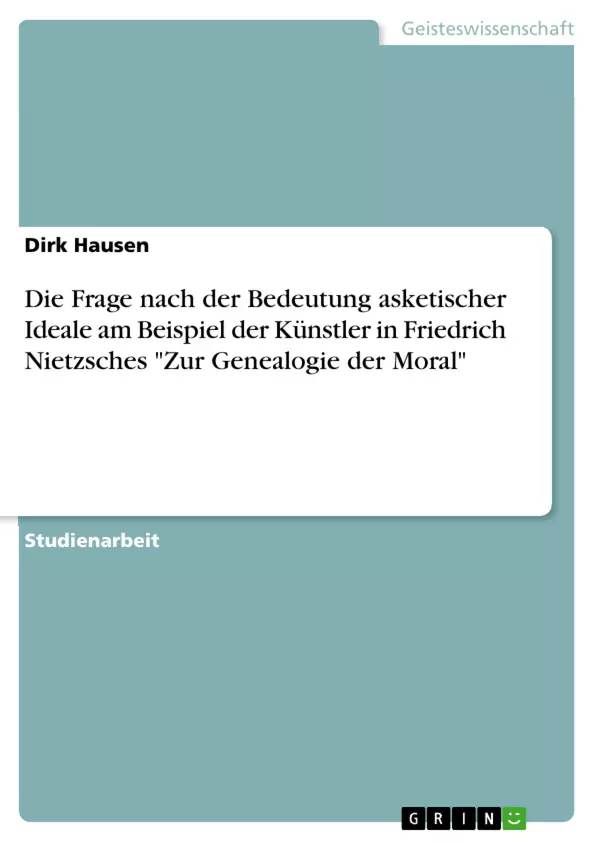Friedrich Nietzsche stellt zu Beginn der dritten Abhandlung seiner Schrift Zur Genealogie der Moral die Frage: „Was bedeuten asketische Ideale?“ Es wird gleichermaßen Aufgabe wie Herausforderung der folgenden Ausführungen sein, dieser Frage am von Nietzsche verwendeten Beispiel der Künstler nachzugehen. Der Schwerpunkt soll hierbei auf der Auslegung des fünften Aphorismus der dritten Abhandlung liegen, da dieser gleichsam eine Schnittstelle zwischen der Bedeutung asketischer Ideale bei Künstlern und Philosophen darstellt.
Um der Aufgabenstellung allerdings in adäquater Weise gerecht werden zu können, gilt es einführend zunächst darzulegen, welche Zielsetzung Nietzsche mit der Genealogie verfolgt. Damit einhergehend, soll sowohl auf den Aufbau des Werkes als auch auf die jeweiligen Inhalte der drei Abhandlungen eingegangen werden. Im hieran anschließenden Kapitel gilt es dann der nicht unerheblichen Frage nachzugehen, wie Nietzsche überhaupt gelesen werden kann bzw. gelesen werden sollte. Schließlich wird der besagte fünfte Aphorismus im vierten und zentralen Kapitel dieser Ausführungen zusammengefasst, bevor das von Nietzsche für die „Kunst der Auslegung“ eines Aphorismus geforderte „W i e d e r k ä u e n“ beginnen kann. Zwischen den einzelnen Phasen des Wiederkäuens werden, zum besseren und vertiefenden Verständnis, überdies Exkurse zum Verhältnis Nietzsches zu Richard Wagner, sowie zu Wagners Verhältnis zu Arthur Schopenhauer aus der Perspektive Nietzsches unternommen. Wenn die gewonnenen Ergebnisse dann in der Schlussbetrachtung zusammengeführt werden, wird sich erweisen, ob der nachfolgenden Aussage Nietzsches (in ihrer akustischen Dimension) zumindest ansatzweise entsprochen werden konnte: „Dies Buch, mein Prüfstein für Das, was zu mir gehört, hat das Glück nur den höchstgesinnten und strengsten Geistern zugänglich zu sein: dem R e s t e fehlen die Ohren dafür.“
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zielsetzung und Inhalt der Genealogie
- Wie soll man Nietzsche lesen?
- Der fünfte Aphorismus der dritten Abhandlung
- Zusammenfassung
- Kernpunkte des Aphorismus
- Erster Exkurs: Nietzsches Verhältnis zu Wagner
- Erstes „Wiederkäuen“
- Zweiter Exkurs: Wagners Verhältnis zu Schopenhauer aus der Perspektive Nietzsches
- Zweites Wiederkäuen
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Bedeutung asketischer Ideale bei Künstlern in Friedrich Nietzsches „Zur Genealogie der Moral“, fokussiert auf den fünften Aphorismus der dritten Abhandlung. Ziel ist die Auslegung dieses Aphorismus als Schnittstelle zwischen asketischen Idealen bei Künstlern und Philosophen. Die Arbeit beleuchtet Nietzsches methodische Herangehensweise an die Genealogie der Moral und analysiert seine Interpretation von Wagner und Schopenhauer.
- Nietzsches Zielsetzung in der „Genealogie der Moral“
- Die Bedeutung asketischer Ideale bei Künstlern
- Nietzsches Lesart und Interpretationsmethode
- Die Rolle Wagners und Schopenhauers in Nietzsches Denken
- Analyse des fünften Aphorismus der dritten Abhandlung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Bedeutung asketischer Ideale bei Künstlern in Nietzsches „Zur Genealogie der Moral“ vor. Sie skizziert den methodischen Ansatz, der sich auf den fünften Aphorismus der dritten Abhandlung konzentriert und diesen als Schnittstelle zwischen Künstlern und Philosophen versteht. Die Einleitung kündigt die Analyse von Nietzsches Zielsetzung in der Genealogie, seine Lesart und den geplanten „Wiederkäu“-Prozess zur Interpretation des Aphorismus an.
Zielsetzung und Inhalt der Genealogie: Dieses Kapitel untersucht Nietzsches Zielsetzung in der „Genealogie der Moral“. Es beleuchtet die Entstehung des Werkes, Nietzsches persönliche Perspektive, die historische Herleitung moralischer Vorurteile und seine Bezugnahme auf „Menschliches, Allzumenschliches“. Der Fokus liegt auf Nietzsches Kritik an moralischen Werten und seiner methodischen Vorgehensweise, die den Perspektivwechsel von der Begründung hin zur Infragestellung der Werte beinhaltet. Die Gliederung der Genealogie in drei Abhandlungen wird kurz zusammengefasst.
Wie soll man Nietzsche lesen?: (Dieses Kapitel wurde in der vorliegenden Textversion nicht näher erläutert und kann daher nicht zusammengefasst werden.)
Der fünfte Aphorismus der dritten Abhandlung: Dieses Kapitel ist das Herzstück der Arbeit und widmet sich der detaillierten Analyse des fünften Aphorismus. Es beinhaltet eine Zusammenfassung des Aphorismus, die Identifizierung der Kernpunkte, sowie Exkurse zu Nietzsches Beziehung zu Wagner und Wagners Verhältnis zu Schopenhauer, um ein tiefergehendes Verständnis des Aphorismus zu ermöglichen. Der "Wiederkäu"-Prozess wird angewendet, um die verschiedenen Aspekte des Aphorismus zu beleuchten. Die Exkurse liefern wichtige Kontextinformationen, die für die Interpretation des Aphorismus essentiell sind.
Schlüsselwörter
Nietzsche, Genealogie der Moral, Asketische Ideale, Künstler, Philosophen, Wagner, Schopenhauer, Ressentiment, Moralische Werte, Interpretationsmethode, Wiederkäuen, Psychologie des Christentums, Psychologie des Gewissens.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zu "Zur Genealogie der Moral" - Analyse des 5. Aphorismus der 3. Abhandlung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den fünften Aphorismus der dritten Abhandlung in Friedrich Nietzsches "Zur Genealogie der Moral". Der Fokus liegt auf der Bedeutung asketischer Ideale bei Künstlern und der Interpretation dieses Aphorismus als Schnittstelle zwischen künstlerischen und philosophischen Aspekten.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht Nietzsches Zielsetzung in der "Genealogie der Moral", die Bedeutung asketischer Ideale bei Künstlern, Nietzsches Interpretationsmethode, die Rolle Wagners und Schopenhauers in seinem Denken und schließlich eine detaillierte Analyse des fünften Aphorismus selbst.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Zielsetzung und zum Inhalt der Genealogie, ein Kapitel zu Nietzsches Lesart, eine detaillierte Analyse des fünften Aphorismus (inklusive Exkurse zu Nietzsche/Wagner und Wagner/Schopenhauer) und eine Schlussbetrachtung. Ein Inhaltsverzeichnis bietet einen umfassenden Überblick.
Was ist die zentrale Forschungsfrage?
Die zentrale Forschungsfrage ist die Bedeutung asketischer Ideale bei Künstlern im Kontext von Nietzsches "Zur Genealogie der Moral", speziell im fünften Aphorismus der dritten Abhandlung.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit verwendet eine detaillierte textanalytische Methode, die den fünften Aphorismus im Detail untersucht und durch Exkurse zu Nietzsches Beziehung zu Wagner und Schopenhauers Einfluss auf Wagner kontextualisiert. Nietzsches "Wiederkäu"-Methode wird als Interpretationsansatz verwendet.
Welche Rolle spielen Wagner und Schopenhauer?
Wagner und Schopenhauer spielen eine wichtige Rolle als Kontext für das Verständnis des fünften Aphorismus. Die Arbeit analysiert Nietzsches Verhältnis zu Wagner und Wagners Verhältnis zu Schopenhauer, um den Aphorismus besser zu interpretieren.
Was wird im fünften Aphorismus der dritten Abhandlung analysiert?
Der fünfte Aphorismus wird in seinen Kernpunkten zusammengefasst und detailliert analysiert. Die Analyse beinhaltet die Identifizierung der Kernpunkte und die Einordnung des Aphorismus in den Gesamtkontext der "Genealogie der Moral".
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Nietzsche, Genealogie der Moral, Asketische Ideale, Künstler, Philosophen, Wagner, Schopenhauer, Ressentiment, Moralische Werte, Interpretationsmethode, Wiederkäuen, Psychologie des Christentums, Psychologie des Gewissens.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler und Studenten, die sich mit Friedrich Nietzsche, der "Genealogie der Moral" und der Philosophie des 19. Jahrhunderts befassen.
- Quote paper
- Magister Artium Dirk Hausen (Author), 2008, Die Frage nach der Bedeutung asketischer Ideale am Beispiel der Künstler in Friedrich Nietzsches "Zur Genealogie der Moral", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/159861