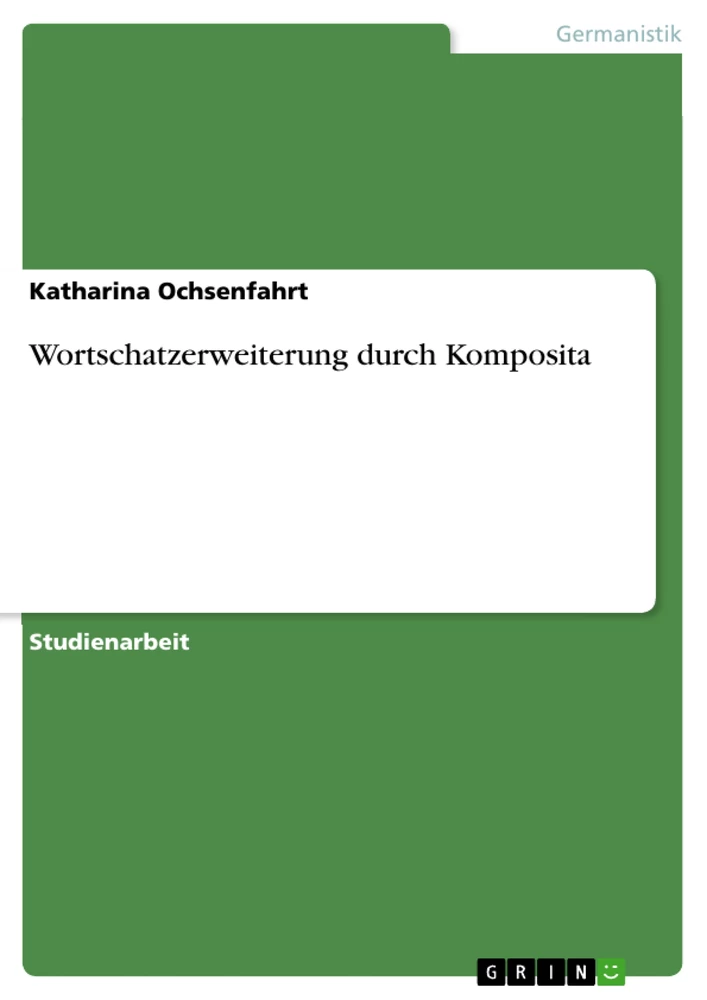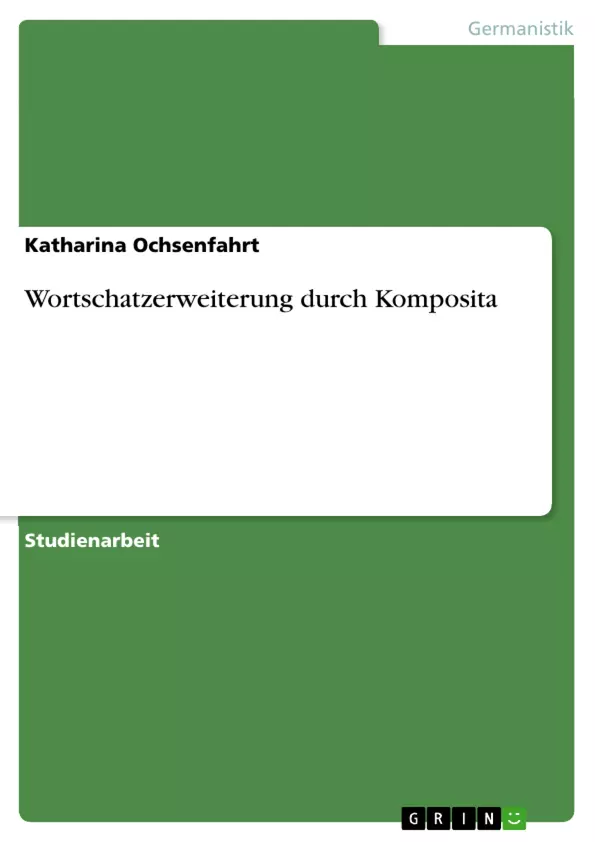Der Wortschatz einer Sprache ist ständiger Veränderung unterworfen. Einerseits gehen Wörter verloren, beispielsweise, weil der Gegenstand, den sie bezeichnen ungebräuchlich geworden ist. Andererseits entstehen auch ständig neue Wörter, die den Wortschatz wieder erweitern. Neue Wortformen können im Deutschen auf vielfältigste Weise von bereits bestehenden Lexemen abgeleitet werden. Es gibt verschiedende Systeme um die Wortbildungsarten zu klassifizieren. Die wichtigsten Verfahren, durch die neue komplexe Wörter entstehen, sind jedoch Derivation und Komposition.
Diese Arbeit soll sich mit der Komposition befassen. Dabei sollen die Unterarten der Komposita genannt und erläutert werden. Außerdem soll eine empirische Erhebung durchgeführt und ausgewertet werden, die sich mit der Getrennt- bzw. Zusammenschreibung von Adjektivkomposita, die aus einem Substantiv und einem Verbteil bestehen, befassen soll.
„Komposition ist eine Wortbildungsart, bei der durch die Verbindung von mehreren, mindestens aber zwei Basismorphemen oder Stämmen ein neues Wort (Kompositum) entsteht.“ Die so entstehenden Wörter, die sogenannten Komposita, sind in der Regel binär aufgebaut und strukturell ambig. Ihre zweite Konstituente ist meist der grammatische Kopf des gesamten Wortes. Es gilt das Prinzip der Rechtsköpfigkeit, da ausschließlich die letzte Konstituente flektiert wird. Außerdem sind die Komposita gegenüber dem Englischen an ihrer Zusammenschreibung und ihrer Primärbetonung zu erkennen.
Die Nahtstellen zwischen den Teilen des Kompositums können durch Fugenelement gekennzeichnet sein. Das sind Buchstaben bzw. Silben, die zwischen die Konstituenten eingefügt werden. Die häufigsten sind -(e)s-, -e-, -(e)n- und –er-, wie in Liebeslied, Wartezimmer, Trachtenkleid und Rinderbraten.
Komposita im Deutschen können sehr lang werden, wie zum Beispiel: Vereinsvorstandssitzungsprotokollbeauftragter, und sie können Wörter unterschiedlichster Wortarten kombinieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Komposita
- Determinativkomposita
- Eigenschaften aller Determinativkomposita
- Determinativkomposita im engeren Sinn
- Rektionskomposita
- Possessivkomposita
- Konfixkomposita
- Zusammenbildungen
- Determinativkomposita verschiedener Wortarten
- Substantivkomposita
- Adjektivkomposita
- Verbkomposita
- Determinativkomposita anderer Wortarten
- Kopulativkomposita
- Zusammenrückungen
- Andere Komposita
- Determinativkomposita
- Empirische Ergebung
- Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Komposition im Deutschen. Ziel ist die Erläuterung der Unterarten von Komposita und die Auswertung einer empirischen Erhebung zur Getrennt- bzw. Zusammenschreibung von Adjektivkomposita, bestehend aus Substantiv und Verbteil.
- Klassifizierung und Erklärung verschiedener Kompositatypen
- Analyse der semantischen Relationen in Determinativkomposita
- Untersuchung von Rektions- und Possessivkomposita
- Empirische Datenanalyse zur Schreibweise von Adjektivkomposita
- Beitrag zum Verständnis der deutschen Wortbildung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der ständigen Veränderung des deutschen Wortschatzes ein, wobei Wörter verloren gehen und neue entstehen. Sie hebt die Bedeutung von Derivation und Komposition als Wortbildungsverfahren hervor und benennt den Fokus der Arbeit auf die Komposition, einschließlich der Erläuterung ihrer Unterarten und einer empirischen Untersuchung zur Schreibweise von Adjektivkomposita.
Komposita: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Übersicht über Komposita im Deutschen. Es beschreibt detailliert Determinativkomposita, ihre Eigenschaften und verschiedene Untertypen wie Rektions- und Possessivkomposita. Die Kapitel-Unterabschnitte erklären die verschiedenen semantischen Relationen innerhalb von Determinativkomposita (Prädikations-, Relator- und Kasusrelation) und geben zahlreiche Beispiele. Zusätzlich werden Kopulativkomposita, Zusammenrückungen und andere Kompositatypen kurz erwähnt, wobei der Schwerpunkt auf den Determinativkomposita liegt, da diese den Großteil komplexer Komposita ausmachen.
Schlüsselwörter
Komposition, Determinativkomposita, Rektionskomposita, Possessivkomposita, Wortbildung, deutsche Sprache, Morphologie, Lexikologie, semantische Relationen, empirische Erhebung, Getrennt- und Zusammenschreibung, Adjektivkomposita.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: "Komposita im Deutschen"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich umfassend mit der Komposition im Deutschen, insbesondere mit der Klassifizierung und Erklärung verschiedener Kompositatypen. Ein Schwerpunkt liegt auf Determinativkomposita und deren Unterarten (z.B. Rektions- und Possessivkomposita). Die Arbeit beinhaltet zudem die Auswertung einer empirischen Erhebung zur Getrennt- und Zusammenschreibung von Adjektivkomposita.
Welche Kompositatypen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Kompositatypen, wobei der Fokus auf Determinativkomposita liegt. Detailliert erklärt werden Determinativkomposita im engeren Sinn, Rektionskomposita, Possessivkomposita, Konfixkomposita und Zusammenbildungen. Zusätzlich werden Kopulativkomposita, Zusammenrückungen und andere Kompositatypen kurz angesprochen. Die verschiedenen Wortarten der Determinativkomposita (Substantiv-, Adjektiv- und Verbkomposita) werden ebenfalls betrachtet.
Welche semantischen Relationen werden untersucht?
Die Arbeit analysiert die semantischen Relationen innerhalb von Determinativkomposita, insbesondere Prädikations-, Relator- und Kasusrelationen. Diese Relationen werden anhand von zahlreichen Beispielen erläutert.
Welche empirische Erhebung wurde durchgeführt?
Die empirische Erhebung konzentriert sich auf die Getrennt- und Zusammenschreibung von Adjektivkomposita, die aus einem Substantiv und einem Verbteil bestehen. Die Ergebnisse dieser Erhebung werden in der Arbeit ausgewertet und diskutiert.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit verfolgt das Ziel, die verschiedenen Unterarten von Komposita im Deutschen zu erläutern und die Ergebnisse der empirischen Erhebung zur Schreibweise von Adjektivkomposita zu präsentieren. Sie soll einen Beitrag zum Verständnis der deutschen Wortbildung leisten.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Komposition, Determinativkomposita, Rektionskomposita, Possessivkomposita, Wortbildung, deutsche Sprache, Morphologie, Lexikologie, semantische Relationen, empirische Erhebung, Getrennt- und Zusammenschreibung, Adjektivkomposita.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel über Komposita (mit Unterkapiteln zu verschiedenen Kompositatypen), ein Kapitel zur empirischen Erhebung und eine Schlussfolgerung.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich an Personen, die sich akademisch mit der deutschen Sprache, insbesondere der Morphologie und Wortbildung, auseinandersetzen. Sie ist für Studenten, Wissenschaftler und alle Interessierten geeignet, die ein tieferes Verständnis von Komposita im Deutschen erlangen möchten.
- Quote paper
- Katharina Ochsenfahrt (Author), 2010, Wortschatzerweiterung durch Komposita, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/159866