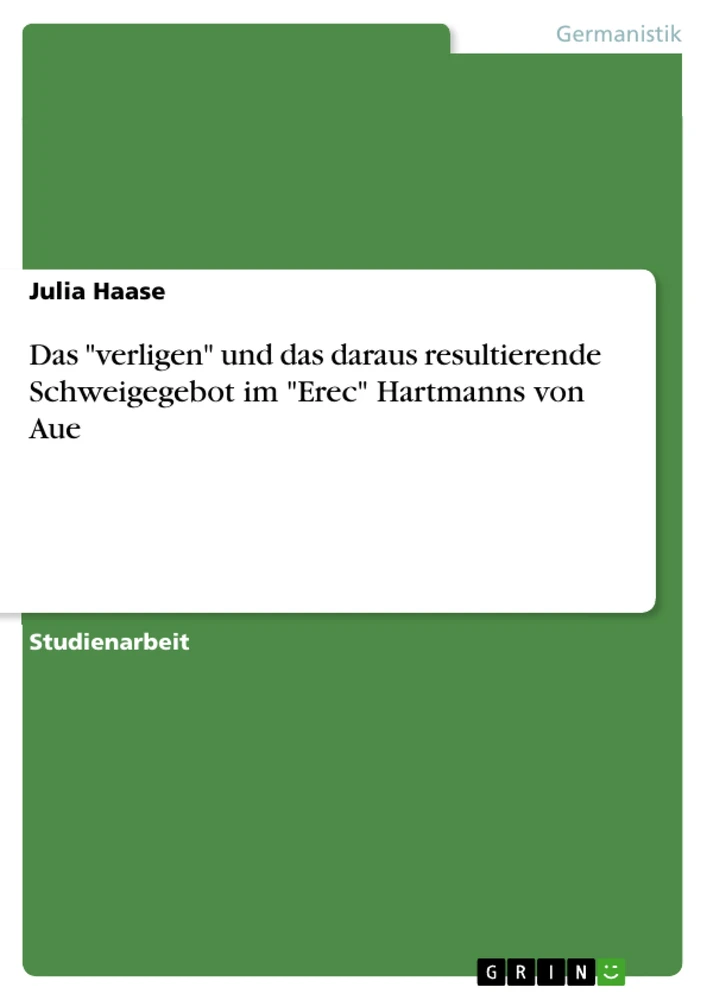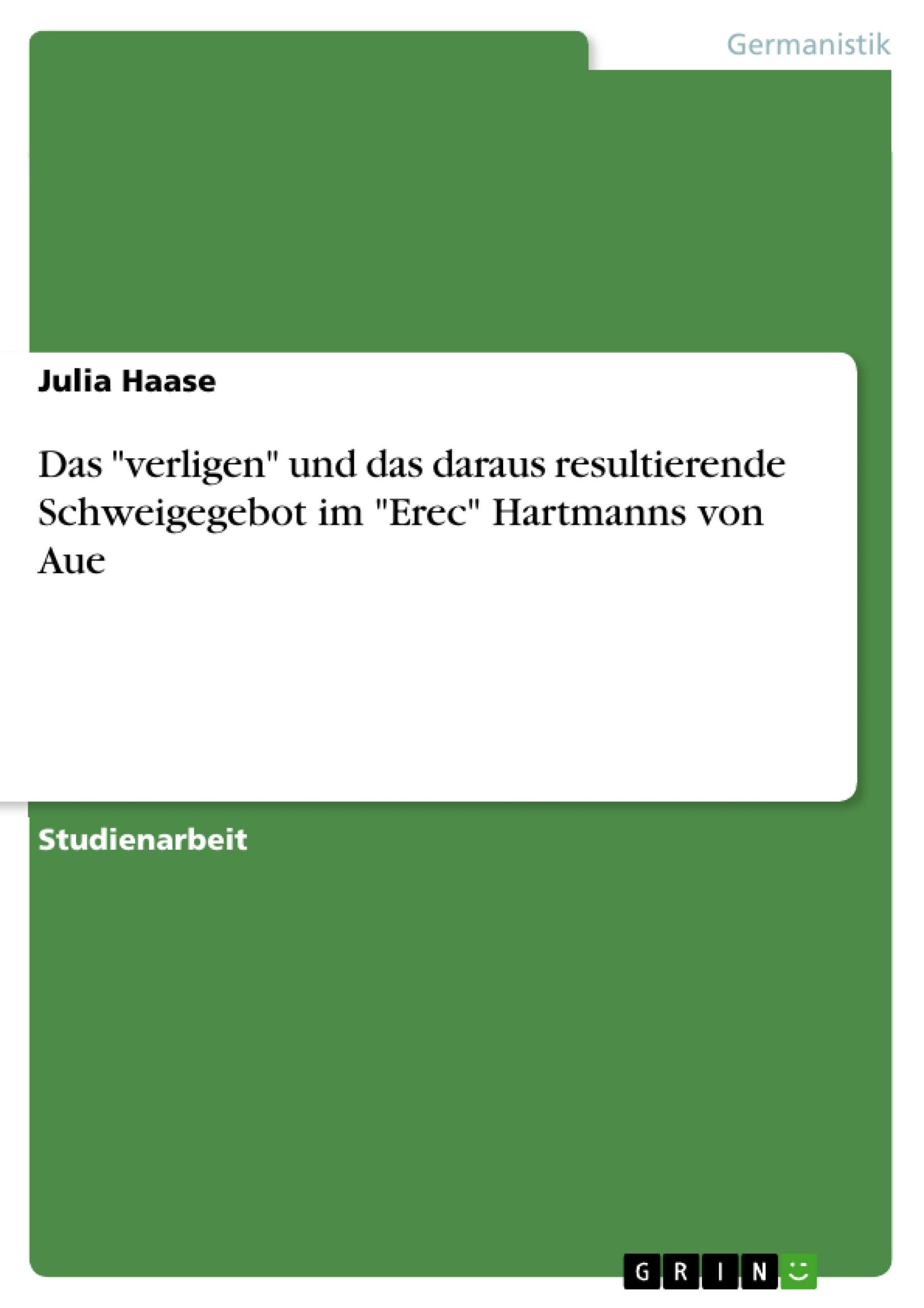2
1. Einleitung
In der hier vorliegenden Arbeit soll es um einen thematischen Schwerpunkt im Erec
Hartmanns von Aue gehen. Die um 1180 herum entstandene Verserzählung gilt als der
erste Artusroman in deutscher Sprache. Hartman übertrug und bearbeitete Erec et Enide
von Chrétiens de Troyes und schuf den prominentesten Typus des höfischen Romans im
deutschsprachigen Raum.
1
Inhaltlich geht es um den adligen Jüngling Erec, der durch âventiure und durch die
Liebe zu Enite zu Herrschaft und Ehre kommt. Er verliert den erreichten Status jedoch
und muss ihn auf einer zweiten, etwas längeren âventiure-Fahrt wieder
zurückgewinnen.
Auf den ersten Blick geht es thematisch hauptsächlich um die Rückeroberung der
verlorenen Ritterehre sowie den Tugenden eines Ritters. Bei näherer Untersuchung wird
jedoch klar, dass die Problematik der richtigen und falschen Liebe einen ebenso großen
Platz einnimmt und einen unerlässlichen Interpretationspunkt bildet.
Mein besonderes Augenmerk liegt hierbei auf dem Schweigegebot, welches Erec Enite
auferlegt hat. Die Ursache dieses Gebots ist, meiner Ansicht nach, im verligen des
Paares in Karnant zu suchen. Aufgrund dieser inhaltlichen Korrespondenz scheint es
erforderlich, auch dieses Thema zu bearbeiten und darauf einzugehen.
Bevor jedoch zu dem eben genannten Kern der Arbeit übergegangen werden kann, muss
kurz auf den Aspekt der höfischen Liebe Bezug genommen werden. Dies ist wichtig für
den Gesamtzusammenhang, da über die allgemeine Bedeutungserklärung und die
Definition des Minnebegriffs geklärt werden kann, welche Ausgangs- und
Endsituationen Erec und Enite im Roman haben und erreichen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Höfische Liebe
- Höfische Liebe im Allgemeinen
- Hohe und niedere Minne
- Höfische Liebe und die Minneproblematik im Erec
- Höfische Liebe im Erec
- Die Minneproblematik in der Ehe Enites und Erecs
- Das verligen in Karnant als Auslöser des Redeverbots
- Reden und Schweigen
- Allgemeines zum Reden und Schweigen im Geschlechterverhältnis
- Das Redeverbot während der âventiure-Fahrt
- Enites inneres Wort
- Zusammenfassung und Fazit
- Zusammenfassung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert den Erec Hartmanns von Aue und untersucht die Problematik der höfischen Liebe innerhalb der Ehe von Erec und Enite. Dabei wird besonderes Augenmerk auf das Schweigegebot gelegt, welches Erec Enite auferlegt. Die Arbeit beleuchtet die Ursachen des Redeverbots und setzt dieses in den Kontext der höfischen Liebe und der Minneproblematik im Erec.
- Die Darstellung der höfischen Liebe im Erec und ihre spezifischen Eigenheiten.
- Die Analyse der Minneproblematik in der Beziehung zwischen Erec und Enite.
- Die Untersuchung des Redeverbots als Folge des verligens und seine Bedeutung im Kontext der höfischen Gesellschaft.
- Die Rolle des Redens und Schweigens im Geschlechterverhältnis im Erec.
- Die Einordnung des Erec in die Tradition des höfischen Romans und seine Bedeutung für die deutschsprachige Literatur.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit vor und erläutert die Bedeutung des Erec als erster Artusroman in deutscher Sprache. Sie betont die zentrale Rolle der höfischen Liebe und des Schweigegebots in der Geschichte.
Kapitel 2 analysiert die höfische Liebe im Allgemeinen, definiert den Begriff und untersucht die Unterscheidung zwischen hoher und niederer Minne. Es beleuchtet die idealisierten Tugenden und Regeln der höfischen Liebe sowie die Gefahren der Auslebung von Triebhaftigkeit und Affektionalität.
Kapitel 3 untersucht die höfische Liebe im Erec, insbesondere die Ehe zwischen Erec und Enite. Es beleuchtet die Umstände der Heirat, die Rolle der Schönheit und Rittertüchtigkeit sowie die fehlende Liebe zu Beginn der Beziehung.
Kapitel 4 beleuchtet das Verligen des Paares in Karnant und die damit verbundene Minneproblematik. Es zeigt auf, wie die Überbetonung der Individualität und die Abkehr von der höfischen Gesellschaft zur falschen Liebe führen.
Kapitel 5 befasst sich mit dem Schweigegebot, welches Erec Enite auferlegt. Es analysiert die Ursachen des Verbots und stellt es in den Kontext des verligens und der höfischen Liebesordnung.
Schlüsselwörter
Höfische Liebe, Minneproblematik, Schweigegebot, Verligen, Erec, Hartmann von Aue, âventiure, Ritterehre, Tugend, hohe Minne, niedere Minne, Geschlechterverhältnis, höfisches Gesellschaftsmodell.
- Citation du texte
- Julia Haase (Auteur), 2008, Das "verligen" und das daraus resultierende Schweigegebot im "Erec" Hartmanns von Aue, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/159967