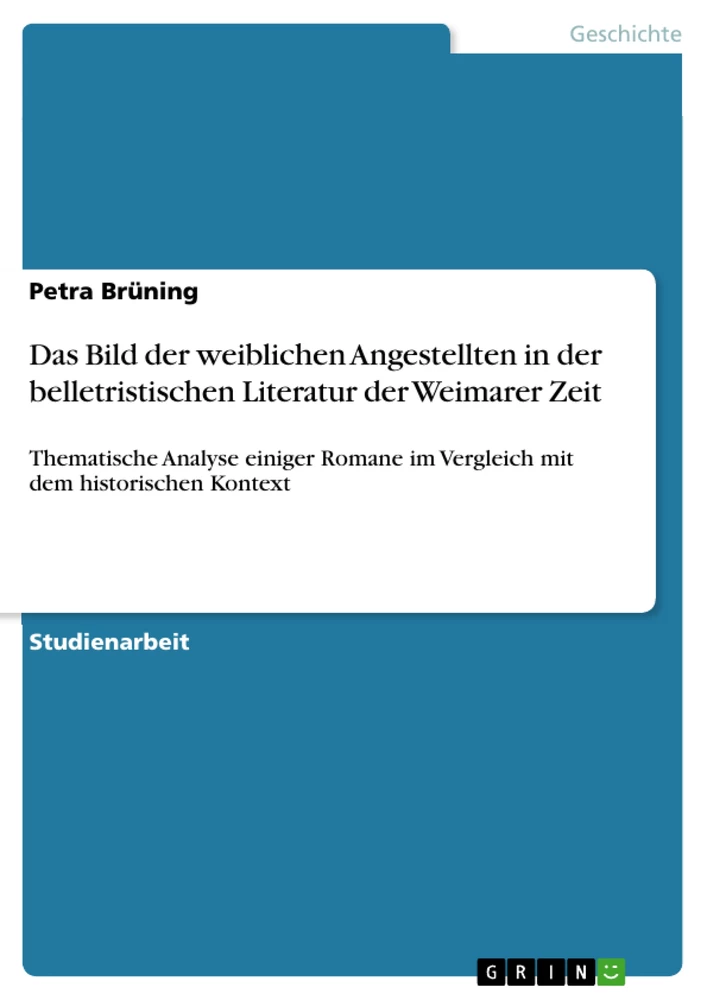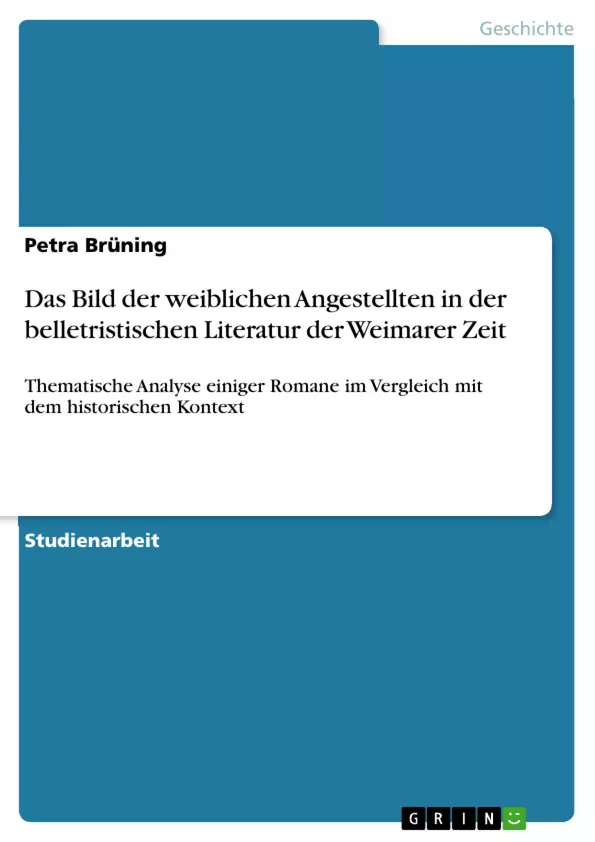In der vorliegenden Arbeit soll anhand einiger Romane aus der Weimarer Zeit, in denen weibliche Angestellte als Protagonisten agieren, deren dargestellter Tätigkeitsbereich und ihr Verhältnis zu diesem analysiert werden. Des Weiteren soll ein Abgleich mit der Sekundärliteratur über die damalige Zeit stattfinden, sodass ein ständiger Rückbezug zum historischen Kontext gegeben ist. Somit soll zusätzlich der Frage nachgegangen werden, inwiefern ein Roman die Wirklichkeit darstellen kann und will.
Bei den analysierten Romanen handelt es sich um folgende fünf Romane:
Braune, Rudolf: Das Mädchen an der Orga Rivat. Berlin: Dietz 1962.
Brück, Christa Anita: Schicksale hinter Schreibmaschinen. Berlin: Sieben-Stäbe-Verlag 1930.
Brück, Christa Anita: Ein Mädchen mit Prokura. Berlin: Sieben-Stäbe-Verlag 1932.
Leitner, Maria: Hotel Amerika. Berlin: Dietz 1962.
Sommerfeld, Adolf: Das Fräulein vom Spittelmarkt. Berlin: Continent Edition (1929).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Berufsfeld der weiblichen Angestellten
- Der berufliche Arbeitstag
- Motive für die Berufswahl und Aufstiegschancen
- Die materielle Sicherheit
- Das soziale Umfeld
- Private und berufliche Beziehungen
- Konsum- und Freizeitverhalten
- Die gewerkschaftlichen Verbindungen
- Die thematische Schwerpunktsetzung der Romane
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die Darstellung weiblicher Angestellter in Romanen der Weimarer Zeit. Ziel ist es, die Arbeitsbedingungen, das soziale Umfeld und die Problematiken, die in den Romanen beleuchtet werden, zu untersuchen. Die Hausarbeit stellt einen Bezug zum historischen Kontext her und analysiert, inwiefern die Romane die Wirklichkeit abbilden.
- Das Arbeitsfeld der weiblichen Angestellten
- Das soziale Umfeld der Angestellten
- Die Rolle von Gewerkschaften
- Die Problematiken, die in den Romanen behandelt werden
- Die Darstellung von Arbeitsbedingungen in der Belletristik
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt das Thema der Hausarbeit ein und erläutert die Vorgehensweise. Es wird auf die Relevanz der Angestellten in der Weimarer Zeit und die Darstellung dieser Berufsgruppe in der Literatur eingegangen.
Das Berufsfeld der weiblichen Angestellten
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Arbeitsalltag der weiblichen Angestellten. Es werden die Arbeitsbedingungen, die Motive für die Berufswahl, die Aufstiegschancen und die materielle Sicherheit der Frauen analysiert.
Das soziale Umfeld
Dieses Kapitel betrachtet die sozialen Beziehungen der weiblichen Angestellten, sowohl im beruflichen als auch im privaten Umfeld. Es analysiert das Konsum- und Freizeitverhalten der Frauen und sucht nach Ursachen für bestimmte Verhaltensmuster.
Die gewerkschaftlichen Verbindungen
Dieses Kapitel untersucht die Rolle von Gewerkschaften in den Romanen und beleuchtet die gewerkschaftliche Tätigkeit der weiblichen Angestellten. Es wird die Frage gestellt, inwieweit die dargestellten Verhältnisse die Realität widerspiegeln.
Die thematische Schwerpunktsetzung der Romane
Dieses Kapitel analysiert die thematischen Schwerpunkte der Romane und stellt die Problematiken heraus, mit denen sich die Autoren auseinandersetzen. Es wird beleuchtet, ob die dargestellten Problematiken den Zeitgeist widerspiegeln und ob in den Romanen Lösungsansätze angeboten werden.
Schlüsselwörter
Die Hausarbeit beschäftigt sich mit den Themen weiblichen Angestellten, Belletristik der Weimarer Zeit, Arbeitsbedingungen, Soziales Umfeld, Gewerkschaften, Problematiken, historische Kontext und die Darstellung der Wirklichkeit in der Literatur.
Häufig gestellte Fragen
Wie werden weibliche Angestellte in der Weimarer Literatur dargestellt?
Die Arbeit analysiert anhand von fünf Romanen den beruflichen Alltag, die Motive für die Berufswahl und das soziale Umfeld der Protagonistinnen.
Welche Romane wurden für die Analyse ausgewählt?
Unter anderem „Das Mädchen an der Orga Rivat“ von Rudolf Braune und „Schicksale hinter Schreibmaschinen“ von Christa Anita Brück.
Wie realistisch ist die Darstellung in den Romanen?
Die Arbeit gleicht die fiktiven Schilderungen mit historischer Sekundärliteratur ab, um zu prüfen, inwiefern sie die tatsächliche Wirklichkeit widerspiegeln.
Welche Themen stehen im Fokus des sozialen Umfelds?
Untersucht werden private und berufliche Beziehungen sowie das spezifische Konsum- und Freizeitverhalten der „neuen Frau“ dieser Ära.
Spielten Gewerkschaften in den Romanen eine Rolle?
Ja, ein Kapitel widmet sich den gewerkschaftlichen Verbindungen der Angestellten und deren thematischer Behandlung in der Belletristik.
- Citation du texte
- Petra Brüning (Auteur), 2008, Das Bild der weiblichen Angestellten in der belletristischen Literatur der Weimarer Zeit , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/160010