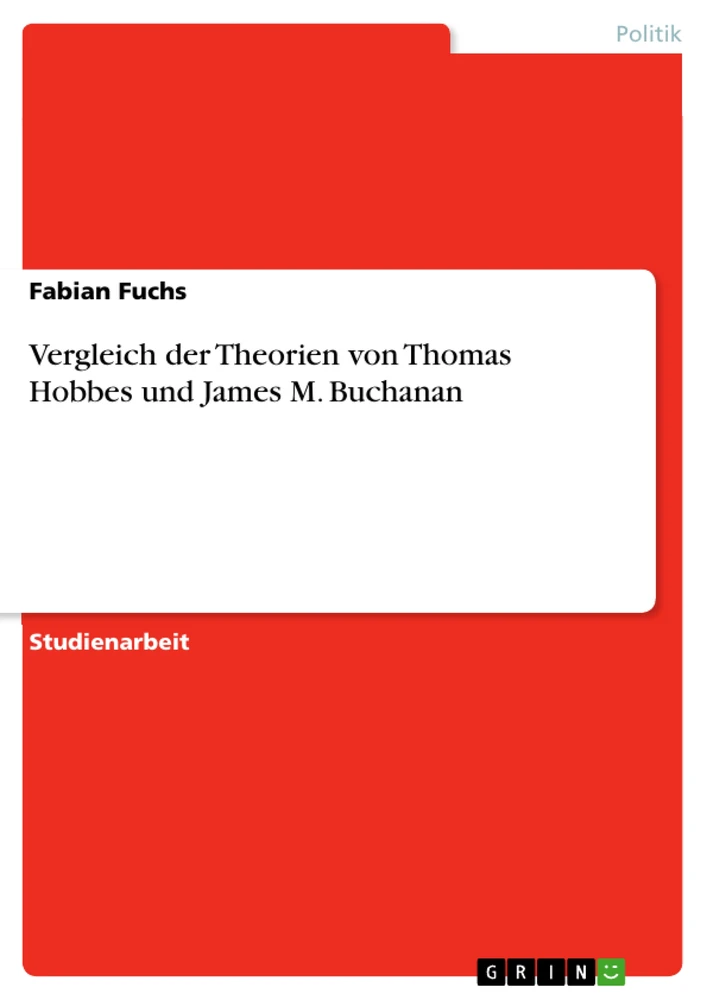Die vorliegende Hausarbeit vergleicht die politischen Theorien von Thomas Hobbes und James M. Buchanan. Der Philosoph und Staatstheoretiker Hobbes, der im 17. Jahrhundert in England lebte, schrieb unter dem Eindruck des in den 1650er Jahren in England wütenden Bürgerkrieges im französischen Exil sein Hauptwerk „Leviathan“1, einen Klassiker der politischen Ideengeschichte. In diesem Werk entwirft er eine Theorie, in der die Individuen einen vorgesellschaftlichen, rechtlosen Kriegszustand durch Abschluss eines Gesellschaftsvertrages beendigen, in dem die Rechte der Individuen auf einen Souverän mit absoluter Macht übertragen werden.
Der 1919 geborene Ökonom James M. Buchanan, der 1986 den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften erhielt, beeinflusste durch sein interdisziplinär angelegtes Oeuvre auch die politische Theorie. Er ist ebenso Vertragstheoretiker wie Hobbes, auf dessen Basis er
in seinem 1975 erschienenen Werk „Die Grenzen der Freiheit. Zwischen Anarchie und Leviathan“ sein Modell eines Gesellschaftsvertrages entwickelte. Im Gegensatz zu Hobbes resultiert aus der Buchananschen Vertragstheorie die Demokratie, während im Hobbesschen Modell der Vertragsabschluss einen absoluten Staat konstituiert.
Die Intention, die Theorien dieser beiden Staatstheoretiker zu vergleichen, gründet sich eben in letztgenanntem Argument und der Diskrepanz, dass man trotz relativ kongruenter Grundlage, also einer ähnlichen Naturzustandssituation, doch zu solch unterschiedlichen
Resultaten kommt.
Der Hauptteil meiner Arbeit gliedert sich in die drei Bereiche des Naturzustandes, des Vertragsabschlusses und des Vertragsinhaltes. In allen drei Stufen wird jeweils zuerst die Argumentation von Thomas Hobbes erläutert, sie anschließend der Theorie Buchanans
gegenübergestellt und dort auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede eingegangen.
Der (immer fiktive) Naturzustand stellt das menschliche Zusammenleben vor jeder Vergesellschaftung dar, eine rechtslose Situation der Unsicherheit, in der niemand seines Besitzes und seines Lebens sicher sein kann. Die Stufe des Vertragsabschlusses soll zeigen, welche Beweggründe die Individuen dazu bringen, durch wechselseitige Kontrakte dem Naturzustand zu entfliehen. Im dritten Bereich wird aufgezeigt, welche Inhalte die abgeschlossenen Verträge festgelegt haben und welche Auswirkungen diese auf die weitere
gesellschaftliche Entwicklung hin zum Leviathan bzw. zur Demokratie besitzen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vergleich der Theorien von Thomas Hobbes und James M. Buchanan
- Naturzustand
- Hobbes
- Vergleich mit Buchanan
- Vertragsabschluss
- Hobbes
- Vergleich mit Buchanan
- Vertragsinhalt
- Hobbes
- Vergleich mit Buchanan
- Naturzustand
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit zielt darauf ab, die politischen Theorien von Thomas Hobbes und James M. Buchanan zu vergleichen und die Unterschiede in ihren jeweiligen Gesellschaftsvertragsmodellen aufzuzeigen, obwohl sie von einer ähnlichen Ausgangssituation im Naturzustand ausgehen. Dabei werden die unterschiedlichen Schlussfolgerungen hinsichtlich der Staatsform – absoluter Staat bei Hobbes versus Demokratie bei Buchanan – beleuchtet.
- Naturzustand als Ausgangspunkt für den Gesellschaftsvertrag
- Vergleich der Argumente und Schlussfolgerungen von Hobbes und Buchanan
- Entwicklung des Vertragsabschlusses und seine Auswirkungen auf die Gesellschaftsordnung
- Unterschiede in den Inhalten der Verträge und ihre Folgen für die Staatsform
- Analyse der Rolle der Vernunft und des menschlichen Verhaltens im Naturzustand
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die beiden Staatstheoretiker sowie ihre zentralen Werke vor. Der Hauptteil der Arbeit gliedert sich in drei Kapitel, die sich mit dem Naturzustand, dem Vertragsabschluss und dem Vertragsinhalt beschäftigen. Im ersten Kapitel wird die Hobbessche Naturzustandskonzeption als „bellum omnium contra omnes“ (Krieg aller gegen alle) vorgestellt und durch die vier Hauptgründe von Wolfgang Kersting – Knappheit, Grenzsituation, Vernunft und Misstrauen – erläutert. Anschließend wird die Naturzustandstheorie Buchanans im Vergleich zu Hobbes beleuchtet.
Das zweite Kapitel analysiert die Beweggründe der Individuen, dem Naturzustand zu entfliehen, und stellt die Mechanismen des Vertragsabschlusses dar. Dabei werden die unterschiedlichen Perspektiven von Hobbes und Buchanan auf den Vertragsabschluss und die Folgen für die Gesellschaftsform herausgearbeitet.
Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit den Inhalten der abgeschlossenen Verträge und ihren Auswirkungen auf die weitere gesellschaftliche Entwicklung. Hier werden die unterschiedlichen Ansätze von Hobbes und Buchanan hinsichtlich der Staatsform und die Konsequenzen für die Rolle des Staates in der Gesellschaft betrachtet.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Arbeit sind die Gesellschaftsvertragstheorie, der Naturzustand, der Vertragsabschluss, der Vertragsinhalt, die Staatsform, die Rolle des Staates, die Vernunft und das menschliche Verhalten, Thomas Hobbes, James M. Buchanan, Leviathan, „Die Grenzen der Freiheit“ und Demokratie.
Häufig gestellte Fragen
Was vergleicht diese Hausarbeit?
Die Arbeit vergleicht die Vertragstheorien von Thomas Hobbes (17. Jh.) und James M. Buchanan (20. Jh.) hinsichtlich Naturzustand, Vertragsabschluss und Staatsform.
Wie definiert Hobbes den Naturzustand?
Hobbes beschreibt ihn als „bellum omnium contra omnes“ (Krieg aller gegen alle), eine rechtslose Situation der Unsicherheit aufgrund von Knappheit und Misstrauen.
Was ist der Hauptunterschied im Ergebnis ihrer Theorien?
Bei Hobbes führt der Gesellschaftsvertrag zu einem absoluten Staat (Leviathan), während bei Buchanan eine Demokratie als Resultat der vertraglichen Einigung entsteht.
Warum erhielt James M. Buchanan den Nobelpreis?
Buchanan erhielt 1986 den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften, insbesondere für seine Arbeiten zur ökonomischen Theorie politischer Entscheidungsprozesse.
Welche Rolle spielt die Vernunft in beiden Modellen?
Beide Theoretiker gehen davon aus, dass Individuen aus rationalem Eigeninteresse handeln, um durch wechselseitige Verträge dem unsicheren Naturzustand zu entfliehen.
Welches Werk von Buchanan wird primär untersucht?
Die Untersuchung basiert auf Buchanans 1975 erschienenem Werk „Die Grenzen der Freiheit. Zwischen Anarchie und Leviathan“.
- Quote paper
- Fabian Fuchs (Author), 2010, Vergleich der Theorien von Thomas Hobbes und James M. Buchanan, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/160049