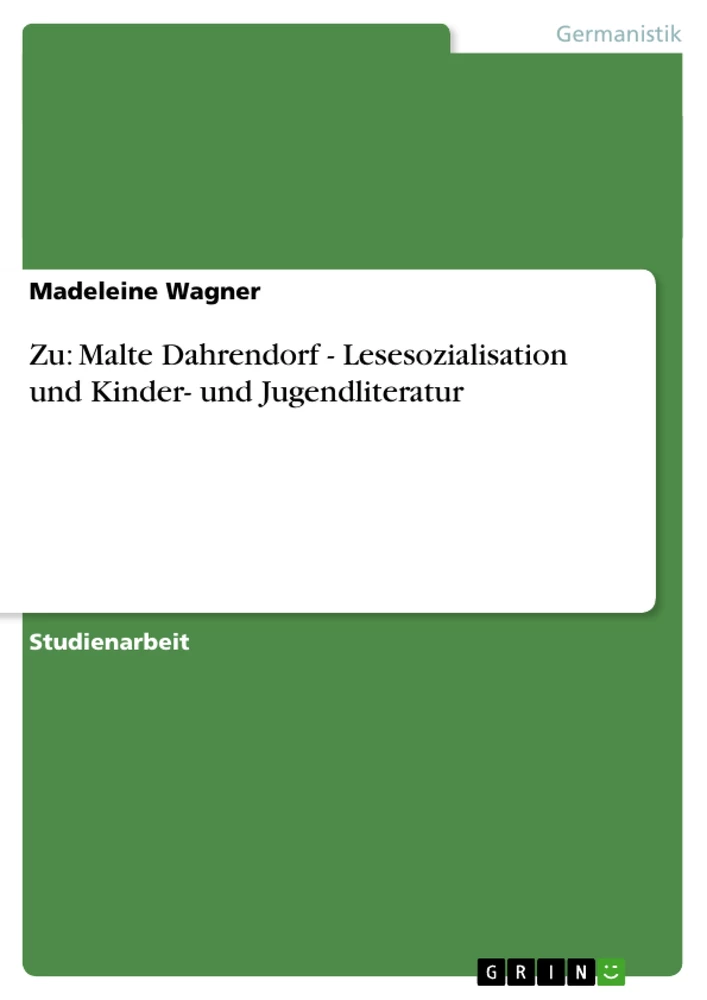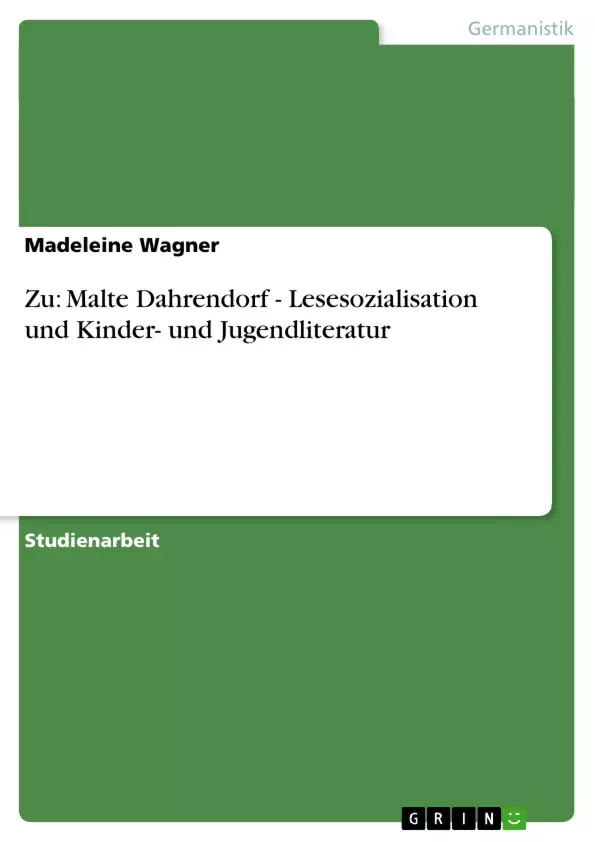Bei der Erarbeitung meiner Hausarbeit stellt sich für mich als Erstes die Frage:
Was ist Sozialisation?
Sozialisation (lat. sociare verbinden, vereinigen; engl. socialization). Prozess, in dessen lebenslangen Verlauf ein Individuum über die kulturspezifischen Regulationen seiner Bedürfnisbefriedigung, den alltäglichen Umgang mit Familienangehörigen und anderen Bezugspersonen, über Lernprozesse im System der gesellschaftlichen Instanzen sowie als Teil bzw. Nutzer von gesellschaftlichen Institutionen die mehrheitlich anerkannten Kriterien für erfolgreiches bzw. erwünschtes und weniger erfolgreiches bzw. unerwünschtes Verhalten, die wesentlichen Verständigungsmittel und ein daran orientiertes Repertoire von Einstellungen und Verhaltensmustern erwirbt. Aufgrund dieser vielfältigen Erfahrungen und Lernprozesse wird das Individuum zum Mitträger einer Kultur, so dass das alltägliche Verhalten für die meisten Lebenssituationen im Einzelnen überwiegend sozial programmiert ist. Dies stabilisiert Individuum und Gesellschaft und sichert außerdem Kommunikation und Kontinuität. Das Individuum wird zur soziokulturellen Persönlichkeit. Die Sozialpsychologen sprechen von der Internalisierung einer Kultur. Mit zunehmendem Alter wächst durch subjektive Spontaneität und äußere Anregungen die Ausbildung der individuellen Urteilskraft, also das Vermögen des Individuums, den Prozess der kulturellen Regelung und Stabilisierung seines Verhaltens zu reflektieren, Alternativen, Widersprüche und Wandlungen zu erkennen, Konflikte zwischen sozialen Erwartungen und subjektiven Standards zu fällen. Im Sozialisationsprozess ist das Individuum folglich nicht Objekt der soziokulturellen Beeinflussungen, vielmehr ist es von Anbeginn an der Gestaltung seiner soziokulturellen Persönlichkeit beteiligt. Diese wachsende aktive Teilnahme der Individuen an der Sozialisation ist unabdingbare Voraussetzung für jeden kulturellen Wandel. Die Sozialwissenschaften betrachten den Prozess der Sozialisation differenziert (Soziabilisierung, Enkulturation, Personalisation, Akkulturation). Erziehung wird als absichtlicher, formalisierter und kontrollierter Teilprozess der Sozialisation verstanden.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- Was ist Sozialisation?
- Einführung ins Thema nach M. Dahrendorf
- B. Hauptteil
- 1. Thesen des Aufsatzes ,,Lesesozialisation und KJL❝
- 2. Sprachbildung im Vorschulalter
- 3. Bedingungen der Lesesozialisation
- C. Schluss
- Mein persönliches Statement
- D. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Lesesozialisation und der Bedeutung der Kinder- und Jugendliteratur (KJL) in diesem Prozess. Sie analysiert die Thesen des Aufsatzes „Lesesozialisation und KJL“ von Malte Dahrendorf und untersucht die Rolle der Sprachbildung im Vorschulalter sowie die Bedingungen der Lesesozialisation. Die Arbeit zielt darauf ab, ein tieferes Verständnis für den komplexen Prozess der Lesesozialisation zu entwickeln.
- Die Entstehung der Lesekultur im Zivilisationsprozess und ihre Folgen
- Die Rolle der Sprachbildung im Vorschulalter für die Lesesozialisation
- Die Bedeutung der Kinder- und Jugendliteratur für die Entwicklung von Lesekompetenz
- Die Einflussfaktoren der Lesesozialisation, z.B. Familie, Schule und Medien
- Die Auswirkungen des Lesens auf die Entwicklung der Persönlichkeit
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einleitung
Die Einleitung definiert den Begriff „Sozialisation“ und führt in das Thema der Lesesozialisation ein. Sie beleuchtet die aktuelle Debatte um die Leseförderung und stellt die Forschungsfrage nach der Rolle der Kinder- und Jugendliteratur in diesem Prozess.
B. Hauptteil
1. Thesen des Aufsatzes „Lesesozialisation und Kinder- und Jugendliteratur“
Dieser Abschnitt präsentiert die Thesen des Aufsatzes von Malte Dahrendorf und betrachtet die Entwicklung der Lesekultur im Zivilisationsprozess. Dabei werden die Folgen des Wandels von der Oralkultur zur Schriftkultur und die Bedeutung der Kinder- und Jugendliteratur in diesem Zusammenhang untersucht.
2. Sprachbildung im Vorschulalter
Dieser Abschnitt untersucht die Bedeutung der Sprachbildung im Vorschulalter für die spätere Entwicklung der Lesekompetenz. Er beleuchtet die Bedeutung des frühen Spracherwerbs und die Rolle der Eltern und Erzieher in diesem Prozess.
3. Bedingungen der Lesesozialisation
Dieser Abschnitt beleuchtet die verschiedenen Bedingungen, die die Lesesozialisation beeinflussen. Dazu gehören Faktoren wie die Familie, die Schule, die Medien und die soziale Umgebung.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Lesesozialisation, Kinder- und Jugendliteratur, Sprachbildung, Zivilisationsprozess, Oralkultur, Schriftkultur, Familie, Schule, Medien, Lesekompetenz.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird Sozialisation in dieser Hausarbeit definiert?
Sozialisation ist ein lebenslanger Prozess, in dem Individuen gesellschaftlich anerkannte Verhaltensmuster, Einstellungen und Verständigungsmittel erwerben.
Welche Rolle spielt die Kinder- und Jugendliteratur (KJL) für die Lesesozialisation?
KJL wird als zentrales Medium betrachtet, das die Entwicklung von Lesekompetenz und die aktive Teilnahme am kulturellen Leben fördert.
Warum ist Sprachbildung im Vorschulalter so wichtig?
Sie bildet das Fundament für die spätere Lesesozialisation und den erfolgreichen Erwerb von Schriftkompetenz.
Welche Thesen vertritt Malte Dahrendorf in seinem Aufsatz?
Dahrendorf untersucht die Entwicklung der Lesekultur im Zivilisationsprozess und die Bedingungen, unter denen Kinder heute zu Lesern werden.
Welche Instanzen beeinflussen den Prozess der Lesesozialisation?
Wesentliche Einflussfaktoren sind die Familie, Bildungseinrichtungen wie die Schule sowie die Nutzung moderner Medien.
Ist das Individuum im Sozialisationsprozess nur ein passives Objekt?
Nein, die Arbeit betont, dass das Individuum von Anbeginn an aktiv an der Gestaltung seiner soziokulturellen Persönlichkeit beteiligt ist.
- Citation du texte
- Madeleine Wagner (Auteur), 2003, Zu: Malte Dahrendorf - Lesesozialisation und Kinder- und Jugendliteratur, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/16008