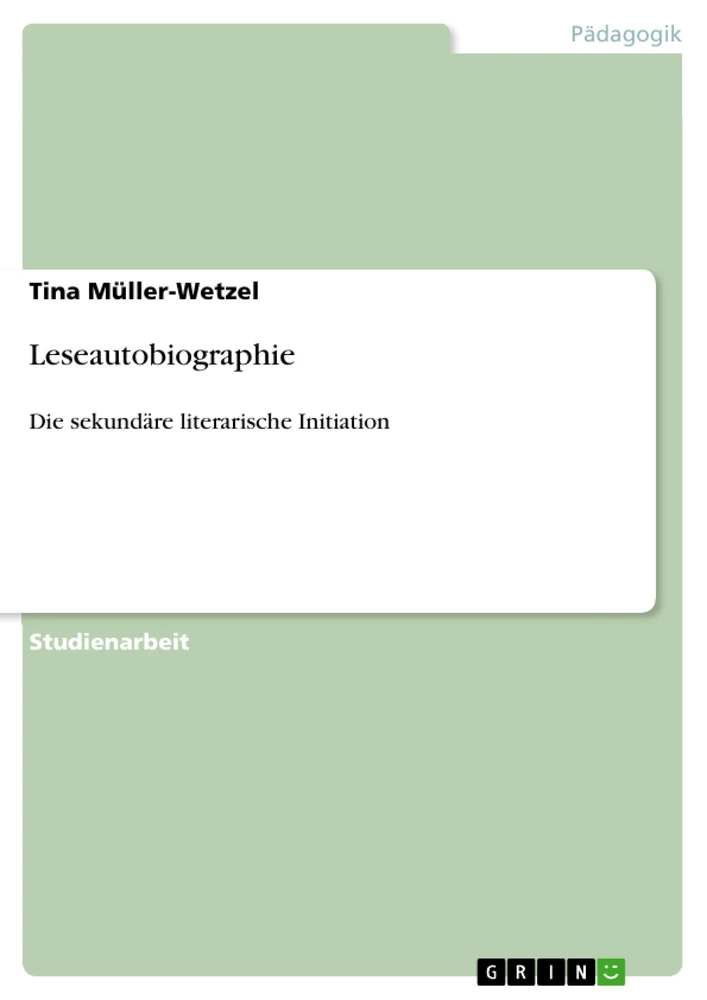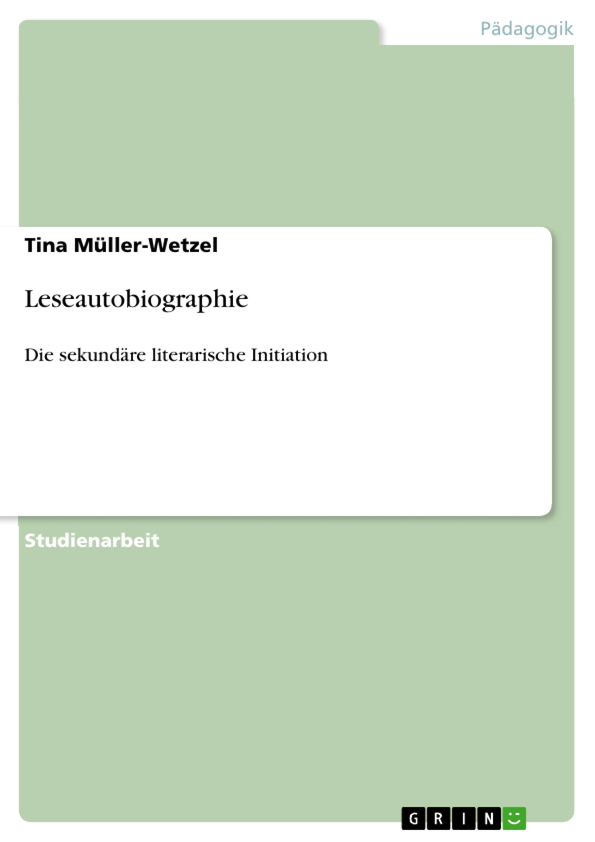Bei näherer Betrachtung ihres späteren Berufes ist durchaus sinnvoll, dass Lehramtsstudenten für Deutschunterricht sich nicht nur mit der Literaturdidaktik, sondern auch mit ihrem eigenen Leseverhalten auseinandersetzen. Eine große Rolle dabei spielt die Erforschung der Lesesozialisation, welche definiert wird als die in Abhängigkeit von der sozialen Umwelt erlernte Kompetenz, Geschriebenes kognitiv zu verarbeiten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Lesesozialisation
- 2.1 Primäre literarische Initiation und Lesekrise
- 2.2 Sekundäre literarische Initiation
- 3. Adoleszenz und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Zielsetzung dieser Leseautobiografie besteht darin, die eigene Lesesozialisation zu untersuchen und den Einfluss des sozialen Umfelds auf die Lesemotivation zu analysieren. Dies geschieht anhand der sieben Lesemodi nach Graf. Die Arbeit beleuchtet die Entwicklung des Leseverhaltens von der primären literarischen Initiation bis hin zur sekundären Initiation während der Adoleszenz.
- Primäre literarische Initiation und die Rolle der Familie
- Entwicklung der Lesekompetenz und die Bedeutung der Schule
- Die Lesekrise und ihre Auswirkungen auf das Leseverhalten
- Sekundäre literarische Initiation und der Einfluss des sozialen Umfelds
- Die sieben Lesemodi nach Graf und ihre Anwendung auf den individuellen Fall
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung erläutert die Relevanz der Auseinandersetzung von Lehramtsstudenten für Deutschunterricht mit ihrem eigenen Leseverhalten und der Lesesozialisation. Sie führt die sieben Lesemodi nach Graf ein und benennt die zentrale Fragestellung der Arbeit: die Untersuchung des eigenen Lesemodus und die Anwendung der sieben Modi auf den individuellen Fall. Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit und stellt die Bedeutung der Untersuchung für den zukünftigen Unterricht in den Vordergrund.
2. Lesesozialisation: Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung der Lesesozialisation der Autorin. Zunächst wird die positive primäre literarische Initiation im familiären Umfeld detailliert dargestellt, geprägt von einem guten Leseklima und der frühzeitigen Begegnung mit Literatur. Es folgt die Beschreibung der Phase der Alphabetisierung und der lustvollen Kinderlektüre, in der die Familie und die Deutschlehrerin als wichtige Sozialisierungsinstanzen fungierten. Das Kapitel beleuchtet auch die Lesekrise während der Pubertät, die im individuellen Fall der Autorin jedoch eher als nahtloser Übergang zur Erwachsenenliteratur beschrieben wird. Der Einfluss von Mobbing in der Schule und das Fehlen einer beeinflussenden Peergroup werden als ausschlaggebende Faktoren für das ungestörte Leseverhalten der Autorin genannt.
2.1 Primäre literarische Initiation und Lesekrise: Dieser Abschnitt beschreibt die positive Erfahrung der Autorin mit Literatur in ihrer Kindheit, geprägt von einer lesefreundlichen Familie. Der Zugang zu Büchern und das Vorlesen durch die Eltern werden als grundlegend für die Entwicklung ihrer Lesekompetenz und -freude dargestellt. Die Phase der Alphabetisierung und die darauf folgende lustvolle Kinderlektüre werden als stufenweise Entwicklung ihrer Leselust beschrieben. Trotz der Lesekrise während der Pubertät, die bei vielen Jugendlichen auftritt, beschreibt die Autorin einen kontinuierlichen und positiven Leseverlauf ohne Unterbrechungen.
2.2 Sekundäre literarische Initiation: Dieser Abschnitt beschreibt den Übergang von der Kinder- zur Erwachsenenliteratur. Auslöser für die sekundäre literarische Initiation ist ein Schulwechsel, der mit positiven Veränderungen im sozialen Umfeld verbunden ist. Der Fokus verlagert sich auf anspruchsvollere Literatur, klassische Werke und ein systematisches Erkunden von "Pflichtlektüre". Es wird die Entwicklung von einem intimen Leser hin zu einem Leser mit breiterem Interessenhorizont beschrieben.
Schlüsselwörter
Lesesozialisation, Lesemotivation, primäre literarische Initiation, sekundäre literarische Initiation, Lesekrise, sieben Lesemodi nach Graf, Adoleszenz, Peergroup, Familieninfluence, Leseklima
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema dieser Leseautobiografie?
Die Leseautobiografie untersucht die eigene Lesesozialisation und analysiert den Einfluss des sozialen Umfelds auf die Lesemotivation. Sie beleuchtet die Entwicklung des Leseverhaltens von der primären literarischen Initiation bis zur sekundären Initiation während der Adoleszenz.
Was sind die Hauptthemen, die in der Leseautobiografie behandelt werden?
Die Hauptthemen umfassen die primäre literarische Initiation und die Rolle der Familie, die Entwicklung der Lesekompetenz und die Bedeutung der Schule, die Lesekrise und ihre Auswirkungen auf das Leseverhalten, die sekundäre literarische Initiation und der Einfluss des sozialen Umfelds sowie die Anwendung der sieben Lesemodi nach Graf.
Was wird in der Einleitung erläutert?
Die Einleitung erläutert die Relevanz der Auseinandersetzung von Lehramtsstudenten für Deutschunterricht mit ihrem eigenen Leseverhalten und der Lesesozialisation. Sie führt die sieben Lesemodi nach Graf ein, benennt die zentrale Fragestellung der Arbeit und skizziert den Aufbau der Arbeit.
Was wird im Kapitel über Lesesozialisation beschrieben?
Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung der Lesesozialisation der Autorin, von der positiven primären literarischen Initiation im familiären Umfeld über die Phase der Alphabetisierung und lustvollen Kinderlektüre bis hin zur Lesekrise während der Pubertät. Es werden auch der Einfluss von Mobbing in der Schule und das Fehlen einer beeinflussenden Peergroup auf das Leseverhalten beleuchtet.
Was ist die primäre literarische Initiation?
Die primäre literarische Initiation bezieht sich auf die positiven Erfahrungen der Autorin mit Literatur in ihrer Kindheit, geprägt von einer lesefreundlichen Familie und dem Vorlesen durch die Eltern.
Was versteht man unter sekundärer literarischer Initiation?
Die sekundäre literarische Initiation beschreibt den Übergang von der Kinder- zur Erwachsenenliteratur, ausgelöst durch einen Schulwechsel und positive Veränderungen im sozialen Umfeld. Der Fokus verlagert sich auf anspruchsvollere Literatur und klassische Werke.
Was sind die Schlüsselwörter, die in dieser Arbeit verwendet werden?
Die Schlüsselwörter sind Lesesozialisation, Lesemotivation, primäre literarische Initiation, sekundäre literarische Initiation, Lesekrise, sieben Lesemodi nach Graf, Adoleszenz, Peergroup, Familieninfluence, Leseklima.
Welche Bedeutung hat die Familie für die Lesesozialisation der Autorin?
Die Familie spielt eine zentrale Rolle in der positiven primären literarischen Initiation der Autorin. Ein gutes Leseklima, der Zugang zu Büchern und das Vorlesen durch die Eltern fördern die Entwicklung der Lesekompetenz und -freude.
Wie beeinflusste die Schule das Leseverhalten der Autorin?
Die Deutschlehrerin und die Schule fungierten als wichtige Sozialisierungsinstanzen während der Phase der Alphabetisierung und der lustvollen Kinderlektüre. Der Schulwechsel markierte den Beginn der sekundären literarischen Initiation.
Wie ging die Autorin mit der Lesekrise während der Pubertät um?
Im individuellen Fall der Autorin wird die Lesekrise eher als nahtloser Übergang zur Erwachsenenliteratur beschrieben, ohne Unterbrechungen im Leseverlauf.
- Citar trabajo
- Tina Müller-Wetzel (Autor), 2021, Leseautobiographie, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1600938