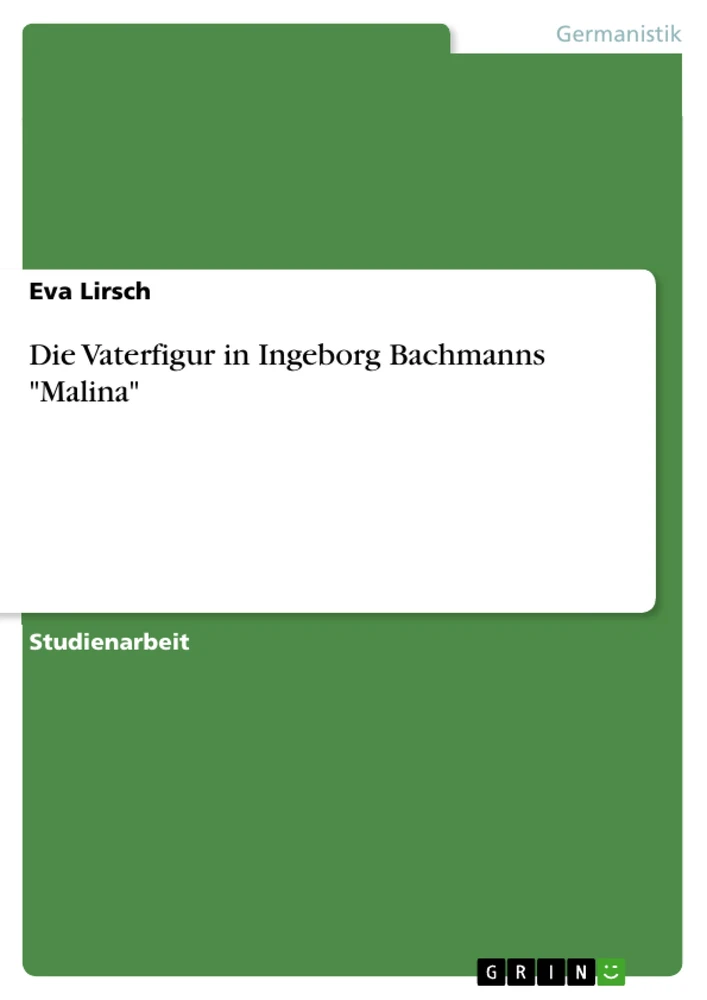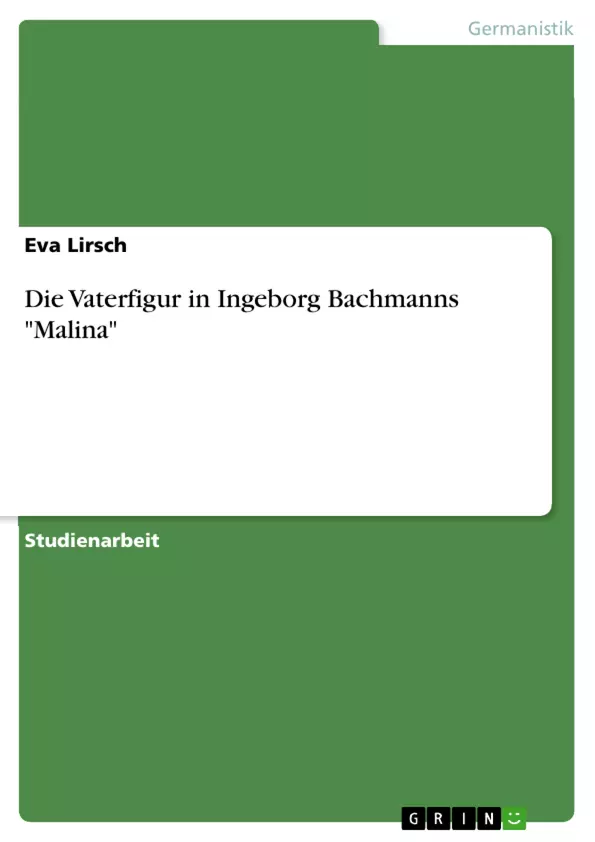Die Vaterfigur ist natürlich die mörderische ... die verschiedene Kostüme trägt, bis sie am Ende alle ablegt und dann als der Mörder zu erkennen ist. Ein Realist würde wahrscheinlich viele Furchtbarkeiten erzählen, die einer bestimmten Person oder Personen zustoßen. Hier wird es zusammengenommen in diese große Person, die das ausübt, was die Gesellschaft ausübt.
Als dritter Mann tritt der Vater auf den Plan. Er ist der Potentat, der Machthaber, der die Spielregeln bestimmt, nach denen die Gesellschaft funktioniert. Die Verbildlichung der Gesellschaft als „größter Mordschauplatz“ wird gerade in den Traumsequenzen in vielfältiger Weise gewahr, in Übersteigerung dessen, was ist und (nach Bachmann) immer sein wird. Es handelt sich um ein hierarchisch strukturiertes Rollenspiel, das in gesellschaflichen Inszenierungen veranstaltet wird. In immer neuen Variationen des einen Grundmotivs zeigt sich die Vaterfigur als perfide Verkörperung von Richter und Henker in einer Person, der als Stellvertreter das ausagiert, was die Gesellschaft betreibt, die absolute Machtausübung gegenüber dem ihm anvertrauten und sich ihm immer wieder vertrauensvoll anvertrauenden „Ich“. Zeitlich und örtlich nicht lokalisierbar, vielleicht an einem See, aber eigentlich an einem „Ort, der heißt Überall und Nirgends“ , liegt der „Friedhof der ermordeten Töchter“
Inhaltsverzeichnis
- DER VATER ALS TÄTER...
- PARTIZIPATION AN DER MACHT.
- DIE SCHULD DER MUTTER
- PARTIZIPATION DES ICH AN DER MACHT.
- DIE DEGRADIERUNG ZUM OBJEKT.
- DIE ENTMÜNDIGUNG DES ICH
- FASCHISMUS IN DER BEZIEHUNG..
- DIE GESELLSCHAFT ALS „ALLERGRÖẞTER MORDSCHAUPLATZ“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit beschäftigt sich mit der Vaterfigur in Ingeborg Bachmanns Roman „Malina“ und untersucht ihre Funktion im Kontext der weiblichen Subjektwerdung. Die Analyse beleuchtet die Rolle des Vaters als Repräsentanten einer despotischen Machtstruktur und die Auswirkungen seiner Herrschaft auf das Ich.
- Der Vater als Täter und Repräsentant gesellschaftlicher Machtstrukturen
- Die Rolle der Mutter als Mittäterin und Verkörperung weiblicher Ohnmacht
- Das Ich als Opfer der väterlichen Herrschaft und seine Suche nach Autonomie
- Die Degradierung des weiblichen Ichs zum Objekt männlicher Macht
- Die Gesellschaft als Ort der Unterdrückung und Gewalt
Zusammenfassung der Kapitel
Der Vater als Täter
Der Vater wird als mörderische Figur dargestellt, die verschiedene Kostüme trägt und die Gesellschaft verkörpert. Der Roman zeigt die destruktive Wirkung der patriarchalischen Machtstrukturen durch Träume und Traumsequenzen, die die Gesellschaft als "größten Mordschauplatz" präsentieren.
Partizipation an der Macht
Die Schuld der Mutter
Die Mutter wird als ohnmächtig und resigniert dargestellt, die sich der väterlichen Herrschaft fügt. Ihre Abwesenheit in der Konstruktion des weiblichen Ichs bedeutet die Verleugnung weiblicher Macht und die Beteiligung am väterlichen Massaker.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt die Vaterfigur in Ingeborg Bachmanns „Malina“?
Der Vater wird als mörderische, despotische Figur dargestellt, die als Stellvertreter für die Gewalt und Machtstrukturen der gesamten Gesellschaft fungiert.
Was symbolisiert der „Friedhof der ermordeten Töchter“?
Er ist ein Bild für die systematische Unterdrückung und psychische Vernichtung weiblicher Identität durch patriarchale Herrschaft.
Warum wird die Mutter in der Analyse als „mitschuldig“ betrachtet?
Die Mutter partizipiert an der Macht, indem sie sich der väterlichen Herrschaft fügt und durch ihre Ohnmacht und Resignation das System stützt.
Was versteht Bachmann unter der Gesellschaft als „Mordschauplatz“?
Es beschreibt eine Welt, in der zwischenmenschliche Beziehungen von faschistoiden Machtstrukturen und der Degradierung des Gegenübers zum Objekt geprägt sind.
Inwiefern ist „Malina“ eine Analyse weiblicher Subjektwerdung?
Der Roman zeigt den verzweifelten Kampf des weiblichen Ichs um Autonomie in einer Welt, die von männlicher Logik und Gewalt dominiert wird.
Was bedeuten die Traumsequenzen im Roman?
Die Träume im zweiten Kapitel ("Der dritte Mann") machen die verborgene Gewalt und die traumatischen Erfahrungen mit der Vaterfigur bildhaft sichtbar.
- Arbeit zitieren
- Mag. Eva Lirsch (Autor:in), 2006, Die Vaterfigur in Ingeborg Bachmanns "Malina", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/160103