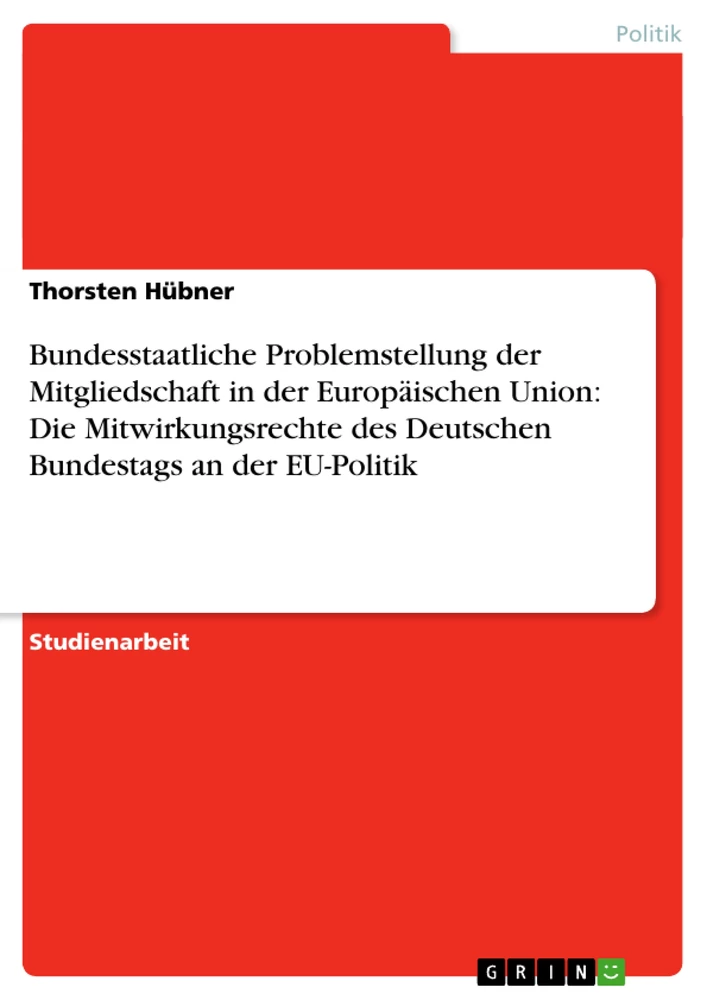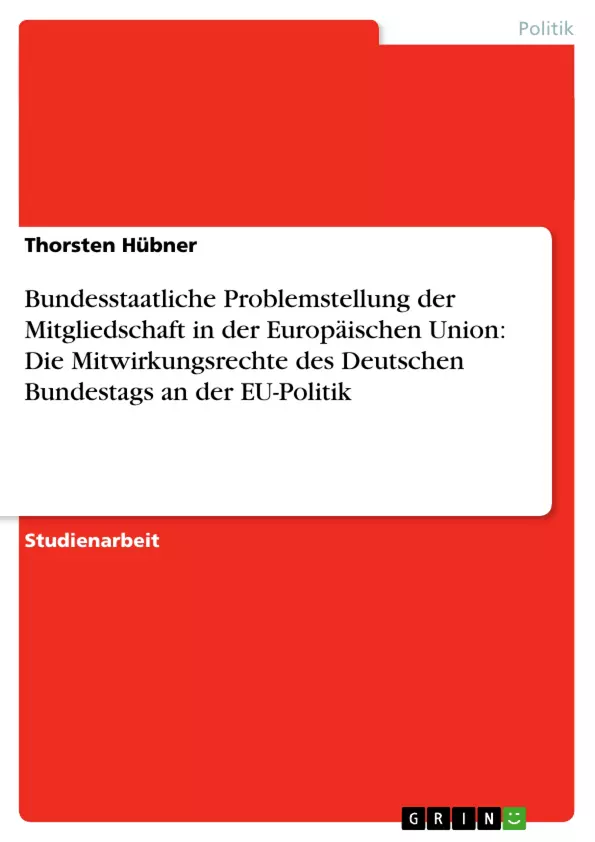Die Integration eines Bundesstaates wie der Bundesrepublik Deutschland in einer Supranationalen Organisation ist ein ebenso schwieriger wie interessanter Prozeß. Während prinzipiell die Bundesregierung der Verhandlungspartner der Europäischen Union ist, berühren viele der Integrationsaufgaben nicht einmal die Kompetenzen des Bundes. Statt dessen gibt es starke Eingriffe in die Rechtsgebiete anderer Institutionen, so sehen sich Bundestag und Bundesländer mit einer ganz neuen Situation konfrontiert: einerseits sollen sie die Verordnungen und Richtlinien aus Brüssel umsetzen und Gesetze erlassen, andererseits werden ihre eigenen Kompetenzen und Spielräume immer geringer.
Bereits in den neunziger Jahren verdichtete sich die Diagnose hinsichtlich von Erosionstendenzen zentraler Strukturmerkmale des politisch-administrativen Systems (Föderalismus, Parlamentarismus, kommunale Selbstverwaltung) durch die Europäisierung. In der Literatur spricht man von einer zunehmenden Entparlamentarisierung der Gesetzgebung. Der Bundestag, in der verfassungsrechtlichen Terminologie der „Gesetzgeber“, sieht sich innerhalb des politischen Systems, aber auch in Folge des fortschreitenden Prozesses der europäischen Vergemeinschaftung wachsenden Handlungs- und Verhandlungszwängen gegenüber. Handlungszwänge ergeben sich, weil das Parlament in viele autonomisierte gesellschaftliche Entwicklungen nicht mehr steuernd eingreifen, sondern nur noch nachregulieren kann; Verhandlungszwänge entstehen wiederum, weil in dem verwobenen Mehrebenensystem der EU eine unübersichtliche Reihe von Akteuren an den Entscheidungsprozessen sowohl in der horizontalen als auch in der vertikalen Dimension teilnimmt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Herausforderung der Parlamente durch die europäische Integration
- Die Übertragung von Hoheitsrechten und die Auswirkungen auf das Parlament
- Politikwissenschaftliche Thesen
- Die Beteiligung des Deutschen Bundestags an der Gestaltung der EU-Politik
- Bedeutung des Maastrichturteils des Bundesverfassungsgerichts
- Die Rechtsgrundlagen
- Das Grundgesetz
- Amsterdamer Protokoll
- Der EU-Ausschuß des Bundestags
- Die rechtliche Grundlage
- Arbeit, Aufgaben und Funktionen
- Der EU-Ausschuß als Chance des Bundestags an der EU-Politik mitzuwirken ?
- Die Konferenz der Europa-Ausschüsse
- Der Vertrag von Amsterdam
- Die Chancen und Grenzen von COSAC – Vertragstiger oder Vertretung der Parlamente ?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die staatsorganisatorischen Herausforderungen, die sich aus der europäischen Integration für den Deutschen Bundestag ergeben. Sie analysiert die Auswirkungen der Kompetenzübertragung auf die EU-Ebene auf den deutschen Parlamentarismus und die Möglichkeiten des Bundestags, an der Gestaltung der EU-Politik mitzuwirken.
- Die Auswirkungen der europäischen Integration auf das deutsche politische System
- Die Rolle des Deutschen Bundestags bei der Gestaltung der EU-Politik
- Die Bedeutung des Maastrichturteils des Bundesverfassungsgerichts
- Die Arbeit des EU-Ausschusses des Bundestags
- Die Chancen und Grenzen der Konferenz der Europa-Ausschüsse
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik der europäischen Integration für den Deutschen Bundestag vor. Sie beleuchtet das Spannungsverhältnis zwischen nationalstaatlichen Strukturen und der zunehmenden Europäisierung des Regierens. Im ersten Kapitel werden die Herausforderungen der Parlamente durch die Übertragung von Hoheitsrechten auf die EU-Ebene behandelt, einschließlich politikwissenschaftlicher Thesen zur Entparlamentarisierung der Gesetzgebung. Kapitel zwei analysiert die Beteiligung des Deutschen Bundestags an der Gestaltung der EU-Politik und die Bedeutung des Maastrichturteils des Bundesverfassungsgerichts. Die Rechtsgrundlagen der deutschen EU-Beteiligung werden im Detail dargestellt, einschließlich des Grundgesetzes und des Amsterdamer Protokolls. Das dritte Kapitel widmet sich dem EU-Ausschuss des Bundestags, dessen rechtliche Grundlage, Aufgaben und Funktionen sowie dessen Chancen und Grenzen als Instrument der Mitwirkung an der EU-Politik beleuchtet werden. Im vierten Kapitel wird die Konferenz der Europa-Ausschüsse (COSAC) analysiert, ihre Chancen und Grenzen im Kontext der europäischen Integration werden diskutiert.
Schlüsselwörter
Europäische Integration, Deutsche Bundestag, EU-Politik, Parlamentarismus, Bundesstaatlichkeit, Maastricht-Urteil, EU-Ausschuss, Konferenz der Europa-Ausschüsse (COSAC), Kompetenzübertragung, Entparlamentarisierung, Mitwirkungsrechte.
Häufig gestellte Fragen
Wie wirkt der Deutsche Bundestag an der EU-Politik mit?
Der Bundestag wirkt über den EU-Ausschuss und durch gesetzliche Informationsrechte an der Gestaltung der deutschen Position in Brüssel mit.
Was versteht man unter der „Entparlamentarisierung“?
Der Begriff beschreibt den Prozess, bei dem Kompetenzen von nationalen Parlamenten auf die EU-Ebene übertragen werden, wodurch der direkte Einfluss gewählter Volksvertreter sinkt.
Welche Bedeutung hatte das Maastricht-Urteil für den Bundestag?
Das Bundesverfassungsgericht stärkte mit diesem Urteil die Rolle des Bundestags, indem es festlegte, dass wesentliche Entscheidungen weiterhin eine parlamentarische Legitimation benötigen.
Was ist die Aufgabe des EU-Ausschusses?
Der EU-Ausschuss koordiniert die Europapolitik innerhalb des Bundestags, prüft EU-Vorlagen und dient als Forum für die parlamentarische Auseinandersetzung mit Brüsseler Themen.
Was ist die COSAC?
Die COSAC ist die Konferenz der Europa-Ausschüsse der nationalen Parlamente, die den Austausch zwischen den Parlamenten der EU-Mitgliedstaaten fördern soll.
- Arbeit zitieren
- Thorsten Hübner (Autor:in), 2003, Bundesstaatliche Problemstellung der Mitgliedschaft in der Europäischen Union: Die Mitwirkungsrechte des Deutschen Bundestags an der EU-Politik, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/16011