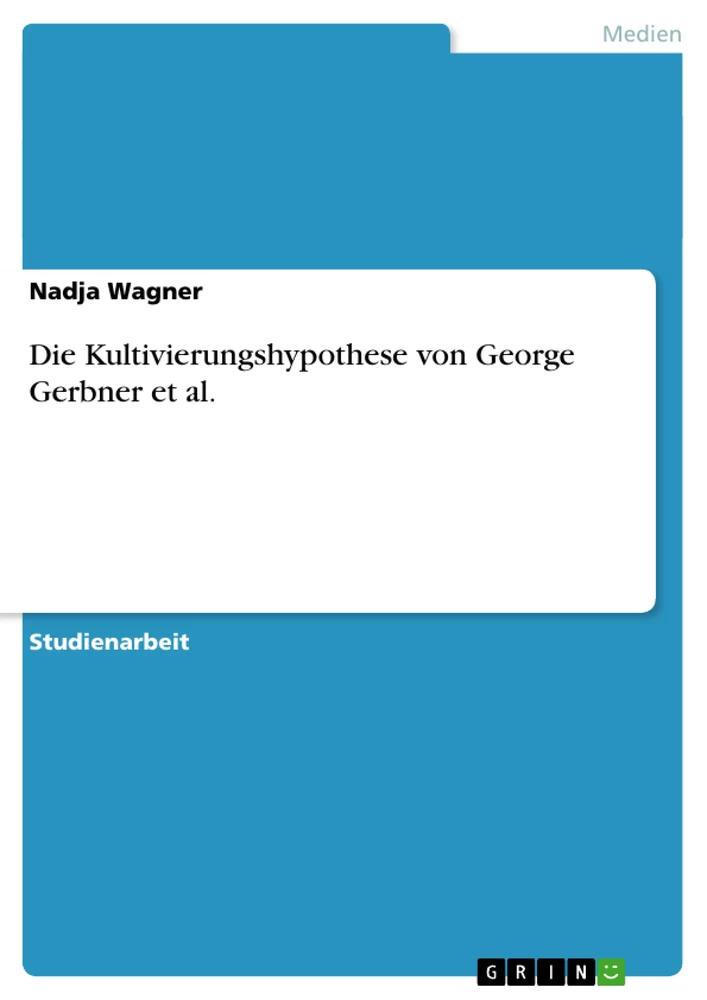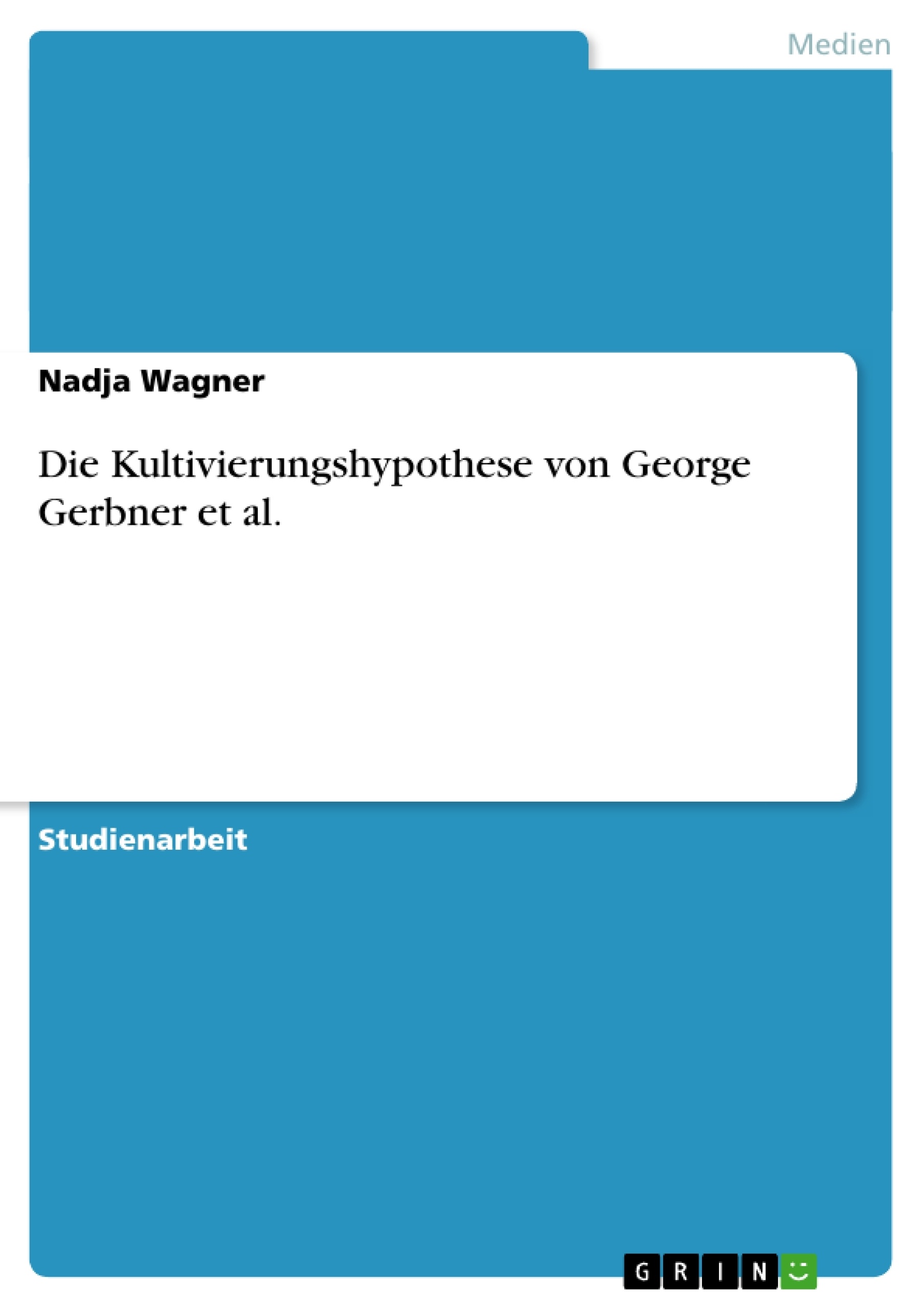„Vergleiche nun unsere Natur in bezug auf Bildung und Unbildung mit folgendem Erlebnis. Stelle Dir Menschen vor in einer unterirdischen, höhlenartigen Behausung; diese hat einen Zugang, der zum Tageslicht hinaufführt, so groß, wie die ganze Höhle. In dieser Höhle sind sie von Kind auf, gefesselt an Schenkeln und Nacken, so dass sie an Ort und Stelle bleiben und immer nur geradeaus schauen; ihrer Fesseln wegen können sie den Kopf nicht herumdrehen...“
Um den Lesern seiner Studie „Die angsterregende Welt des Vielsehers“ den Kern seiner sogenannten Kultivierungshypothese zu veranschaulichen, greift George Gerbner, Dozent an der Annenberg School of Communications in Philadelphia, das Höhlengleichnis von Platon auf.
"Man stelle sich einen Einsiedler vor, der in einer Höhle lebt und mit der Außenwelt lediglich über einen Fernsehapparat verbunden ist, welcher nur zur Hauptsendezeit funktioniert. Seine Kenntnisse von der Welt würden sich ausschließlich aus den Bildern und Fakten zusammensetzen, die er den im Fernsehen vorkommenden fiktiven Ereignissen, Personen, Objekten und Orten entnimmt."
Vielseher, das sind Menschen, mit einem täglichen Fernsehkonsum von mehr als vier Stunden, neigen demnach eher zur Annahme der im Fernsehen widergespiegelten Realität, als Wenigseher, also diejenigen, die täglich weniger als zwei Stunden vor dem Bildschirm verbringen. Vielseher „kultivieren“ auf diese Weise ein sich erheblich unterscheidendes Weltbild, zu dem der Wenigseher. Nach Gerbner unterscheiden sich die Sichtweisen und Vorstellungen der Fernsehrealität in erheblichem Maße von denen der Wirklichkeit. Vielseher nehmen ihre Umwelt anders wahr als Wenigseher und werden vom Fernsehen kultiviert.
Anhand von empirischen Untersuchungen konnten Gerbners Aussagen bezüglich der oben beschriebenen Fernsehkultivierung bestätigt werden. Beispielsweise wurden Probanden mit spezifischen Fragen zu deren Weltsicht und allgemeinen Einstellungen konfrontiert. Es zeigten sich erhebliche Unterschiede zwischen den Antworten der Probanden aus der TV Welt und denen aus der realen Welt. 1974 hatten 10 % aller Verbrechen in den USA einen violenten Charakter, in der Fernsehwelt waren es ca. 77%. Vielseher entschieden sich, im Gegensatz zu den Wenigsehern, eher für die Fernsehantwort, damit betrachtete die Forschungsgruppe um Gerbner den Einfluss des TV, also die oben genannte Kultivierungshypothese, als nachgewiesen.
Inhaltsverzeichnis
- VORWORT
- EINLEITUNG
- DIE VERÄNDERUNG DES ÖFFENTLICHEN BEWUSSTSEINS DURCH SPEZIFISCHE SYSTEME VON MEDIENBOTSCHAFTEN
- Ein neuartiges und zweistufiges Verfahren - der „Cultural Indicators Approach“
- Entwicklungsgeschichte der Forschungsreihen
- Einfluss auf das Publikum durch gewalthaltige Fernsehprogramme
- Kultivierungseffekte und das Kultivierungsdifferential
- DIE KRITIK AN GERBNERS FORSCHUNGSREIHEN
- Methodische Mängel an Gerbners Ansätzen – das Ende des Violence Profile
- Parallelen zwischen Mainstreaming und den Visionen der Bestseller- autoren George Orwell und Aldous Huxley
- Resonance – eine weitere Reaktion Gerbners auf die Kritik seiner Methoden und Ergebnisse der ersten Forschungsreihen
- KULTIVIERUNG ZWEITER ORDNUNG - KRITIK AN GERBNERS TRADITIONELLEM FORSCHUNGSANSATZ
- Spezifische TV-Genres kultivieren das Publikum intensiver als unspezifischer TV Konsum
- SCHLUSS
- QUELLEN/LITERATURVERZEICHNIS:
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Kultivierungshypothese von George Gerbner et al. und untersucht die Auswirkungen von Medienkonsum auf die Wahrnehmung der Realität. Der Fokus liegt dabei auf der These, dass der häufige Konsum von Fernsehprogrammen, insbesondere gewalthaltiger Inhalte, zu einer kultivierten Weltsicht führt, die von der realen Welt abweicht.
- Die Kultivierungshypothese und ihre theoretischen Grundlagen
- Methodische Ansätze zur Untersuchung von Kultivierungseffekten
- Die Rolle von Fernsehgewalt in der Kultivierung
- Kritik an Gerbners Forschungsansätzen
- Die Weiterentwicklung der Kultivierungshypothese
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Kultivierungshypothese von George Gerbner in den Kontext der Medienforschung einordnet und die zentralen Argumente der Arbeit vorstellt. Anschließend wird der „Cultural Indicators Approach“, der methodische Ansatz, der von Gerbner und seinen Kollegen entwickelt wurde, erläutert. Es folgt eine Darstellung der Entwicklungsgeschichte der Forschungsreihen und eine detaillierte Diskussion über die Auswirkungen von gewalthaltigen Fernsehprogrammen auf das Publikum.
In einem weiteren Kapitel wird die Kritik an Gerbners Forschungsreihen thematisiert. Es werden methodische Mängel aufgezeigt und Parallelen zwischen den Konzepten von Mainstreaming und den dystopischen Visionen von George Orwell und Aldous Huxley gezogen. Außerdem wird Gerbners Reaktion auf die Kritik, die sogenannte „Resonance“-Hypothese, vorgestellt. Schließlich werden alternative Ansätze zur Erforschung von Kultivierungseffekten, die sich von Gerbners traditionellem Forschungsansatz abgrenzen, beleuchtet.
Schlüsselwörter
Kultivierungshypothese, George Gerbner, Cultural Indicators Approach, Mainstreaming, Resonance, Fernsehgewalt, Medienkonsum, Wahrnehmung der Realität, Medienwirkungen, empirische Forschung, Medienkritik
- Quote paper
- Nadja Wagner (Author), 2003, Die Kultivierungshypothese von George Gerbner et al., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/16014