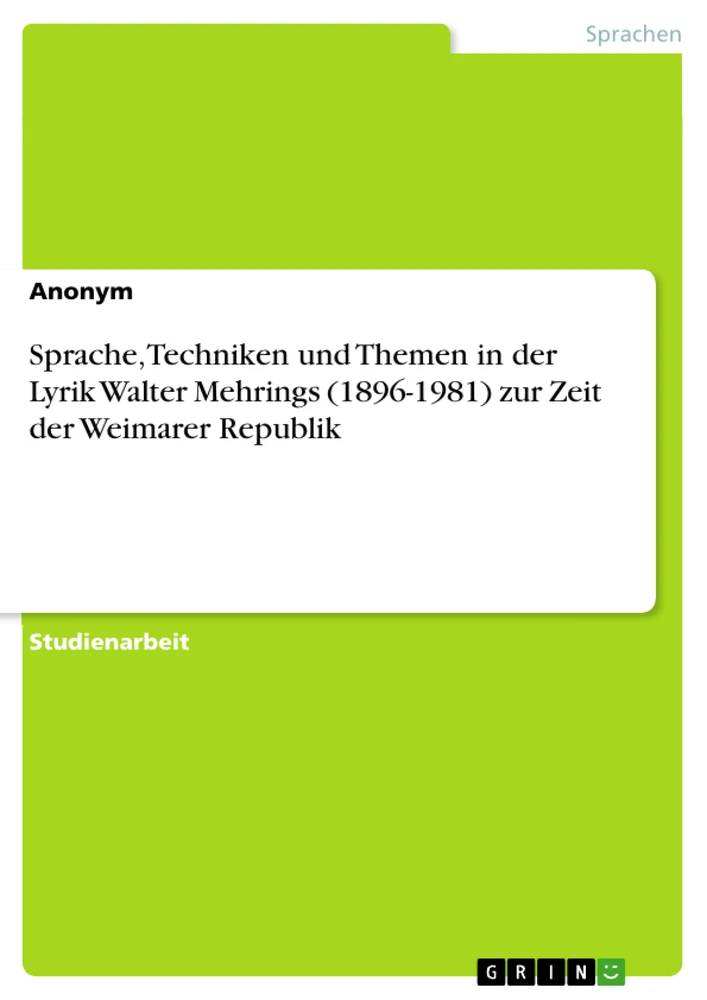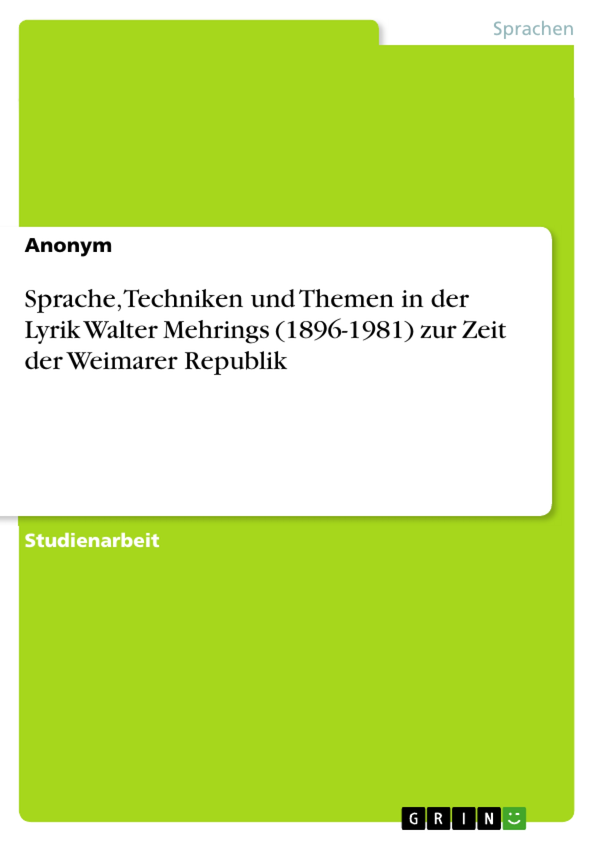Walter Mehring zählt zu den eigenwilligsten und sprachmächtigsten Lyrikern der Weimarer Republik – und zugleich zu den am meisten unterschätzten. Diese Hausarbeit bietet einen fundierten Einblick in Mehrings lyrisches Werk der 1920er Jahre und beleuchtet zentrale Themen, Techniken und sprachliche Strategien, die sein Schaffen prägen: von dadaistischer Spracherneuerung über Collage- und Montagetechnik bis hin zum „Sprachen-Ragtime“. Anhand ausgewählter Gedichte zeigt die Analyse, wie Mehring seine Lyrik als Bühne politischer und gesellschaftlicher Reflexion nutzt – oft mit satirischer Zuspitzung, formalem Bruch und klarem Anspruch an literarische Eigenständigkeit. Die Untersuchung richtet sich an literaturwissenschaftlich Interessierte, Lehrkräfte, Studierende sowie an Leser:innen, die sich für moderne Lyrik, politische Literatur oder die ästhetische Vielfalt der Weimarer Zeit interessieren.
Inhalt
1. Einleitung
2. Mehrings dichterisches Selbstverständnis und seine literarischen Ansprüche
3. Wichtige Stile und Techniken
3.1 Die radikale dadaistisch-avantgardistische Neuordnung von Sprache
3.2 Die Montage- bzw. Collagetechnik
3.3 Sprachen-Ragtime, unregelmäßiger Rhythmus und Jazzelemente
4. Gesellschaftliche Kritik durch Sprache und Form – verschiedene Ansätze
4.1 Die Diskrepanz von Form und Inhalt am Beispiel der Verwendung eines regelmäßigen Rhythmus
4.2 Das liturgische Chanson – Rückgriff auf religiöse Kontexte und Formen
4.3 Rollengedicht und Ballade – Rückgriff auf traditionelle Untergattungen
5. Der vergessene Walter Mehring?
6. Fazit
7. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Mehr als 100 Jahre sind vergangen, seit der junge Dadaist Walter Mehring seine ersten, noch unter dem Zeichen des Ersten Weltkrieges stehenden Gedichte veröffentlichte. Noch bevor er zu einem der wichtigsten Akteure in der Kabarettszene der zwanziger Jahre avancierte und seine Texte auf Kabarettbühnen wie Max Reinhardts „Schall und Rauch“ oder Trude Hesterbergs „Wilder Bühne“ das Publikum begeisterten, zeigt sich schon in seiner frühen Lyrik sein hochreflektiertes Bewusstsein von Sprache, derer Intensität, Vielfalt und Macht sich Mehring schon in jungen Jahren bewusst ist – ein Bewusstsein, das sich durch sein gesamtes lyrisches Werk ziehen wird, das von vielschichtigen Themen und stilistischen Formen geprägt ist und somit nicht nur Zeugnis einer komplexen dichterischen Persönlichkeit, sondern auch mit der Weimarer Republik Beleg für eine ereignisreiche und unbeständige Zeit ist. Die folgende Untersuchung soll als Querschnitt durch das lyrische Werk des Autors dienen und die Vielfalt v. a. seiner Formen unterstreichen. Zunächst sollen Mehrings eigenes dichterisches Selbstverständnis und seine Vorstellungen von Lyrik und Sprache kurz thematisiert werden, um aufzuzeigen, welche hohen Ansprüche der Dichter nicht zuletzt an sich selbst stellte. Anschließend soll der Fokus auf die wichtigsten Techniken und Stile in seinen Gedichten gerückt werden, wobei die dadaistische Spracherneuerung, die Montage- bzw. Collagetechnik sowie der Sprachen-Ragtime thematisiert werden. Mehrings Kreativität zeigt sich auch in seinen vielgestaltigen Wegen, seinem Publikum eine politische Botschaft bzw. Pointe zukommen zu lassen, weshalb hier drei von Mehring gewählte Ansätze näher betrachtet werden sollen – das Aufgreifen einer Form, die entgegengesetzt zum beschriebenen Inhalt steht, der Rückgriff auf religiöse bzw. gebetstextähnliche Lieder sowie die Verwendung von Rollengedichten und Balladen. Exemplarisch sollen dabei jeweils pro Aspekt ein bzw. zwei Beispieltexte zur Verdeutlichung herangezogen und näher betrachtet werden. Zur Abrundung der Untersuchung soll versucht werden, der Frage nachzugehen, weshalb Mehrings Bekanntheit und Popularität der frühen zwanziger Jahre nicht unbedingt von nachhaltiger Wirkung blieb. Die hier gewählte Gliederung dient als ein grober, erster Anknüpfungspunkt. Es handelt sich um keine streng-kategorische Unterteilung in Unterpunkte, die strikt voneinander zu trennen wären. So beeinflusst natürlich Mehrings Sprachverständnis seine dadaistischen Verfremdungstechniken, welche sich wiederum in der Anwendung der Montagetechnik widerspiegeln bzw. fortsetzen, usw.
2. Mehrings dichterisches Selbstverständnis und seine literarischen Ansprüche
Walter Mehrings Gedichte im Hinblick auf ‚genau den einen vorgefassten Sinn‘ bzw. ‚die eine Bedeutung‘ hin zu interpretieren und festzulegen, wäre vermutlich nicht der produktivste Ansatz. Mehr noch als in den Gedichten anderer Lyriker seiner Zeit steht bei Mehring das hochreflektierte Einfangen von Eindrücken im Mittelpunkt, die von Gedicht zu Gedicht, von Jahr zu Jahr andersartig sind: „Mehring war kein Analytiker, der in seinen Gedichten die Wirklichkeit kraft seiner Ratio durchdrang, vielmehr entwarf er mit seinen fast unbegrenzten formalen Möglichkeiten Bilder, die frappierend genau sind und die nicht selten zu eindrücklichen Visionen sich verdichten.“1 Das bedeutet allerdings nicht, dass Mehring nicht von der Bedeutung und Macht der Sprache bzw. des Wortes überzeugt gewesen wäre – ganz im Gegenteil. Gerade in seinem pragmatischen, kreativen, intellektuell-spielerischen Umgang mit schon vorhandenem, ‚vorgefertigtem‘ Sprachmaterial zeigt sich die Bandbreite der Möglichkeiten, derer sich Mehring in seinen Gedichten bediente. So verwendete er u. a. Werbeplakate, Songtexte, Zeitungsberichte, Filme, Sozio- und Dialekte sowie fremdsprachige Zitate, um diese in neue – oftmals parodistische und doppeldeutige, aber auch warnende – Kontexte einzubauen, sie in neue syntaktische Strukturen einzuordnen, mit ihnen neue Assoziationen herzustellen. Mehrings selbstbewusster Umgang mit Sprache, der die Instabilität und Kontextabhängigkeit des losen Wortes verdeutlicht, spiegelt auf textueller Ebene die gesellschaftlichen Unsicherheiten seiner schnelllebigen Zeit wider, die den Alltag der Weimarer Republik und das Denken der Menschen mitbestimmten.2
Mehring selbst betont das geistige Element in Literatur und Kunst, sein Vorgehen zeugt zudem von einem für den Dichter charakteristischen, stark ausgeprägten Individualismus – es ist das denkende Individuum, das nicht nur Sprache, sondern auch sein eigenes Handeln reflektieren soll. Frank Hellberg weist hier auf die Spuren der Erziehung des Autors hin, geprägt von „einem Geist des Rationalismus“ und einem „aufklärerische[n] Gedankengebäude“3 – bereits als Grundschulkind verbringt Mehring viel Zeit in der breit angelegten Bibliothek seines Vaters, um sich selbst fortzubilden –, die sich sowohl in seinem lyrischen als auch in seinem essayistischem Schaffen widerspiegeln. Wie für die meisten Dichter seiner Zeit ist die größte Herausforderung für Mehring wohl, ästhetische und politische Ansprüche miteinander in Einklang zu bringen. Der Dichter will den Leser zum Reflektieren anregen, wobei er weder seine oftmals ideologie- und machtkritischen Ansprüche4 noch seine literarisch-stilistischen Überzeugungen und Grundsätze über Bord werfen will. Gerade „[i]m Zeichen der Prinzipien der Intellektualität, der Sprachkritik und der Konstruktivität“5 wird ein antwortender Leser verlangt, der sich auf die Dichtung einlässt, das Gedicht auf sich wirken lässt und es nicht nur überfliegt. Die Abhebung der lyrischen Sprache von der gewöhnlichen, alltäglichen Sprache ist dabei ein wesentliches Element, das zu dem Anspruch, die Menschen zu erreichen, nicht im Widerspruch steht, da gerade bei Mehring nicht das sprachliche Material selbst, sondern vielmehr dessen Anordnung und Konstruktionsweise im Gedicht das Einfangen von neuen Eindrücken bedingt und die Reflexion anregt. So weisen beispielsweise die Montage von alltäglichen Sprachfetzen aus unterschiedlichen Kontexten, „[m]inimale sprachrhythmische Verschiebungen“6 oder das Mittel „des einfachen, des paradoxen, des zynischen oder sarkastischen Lakonismus“7 auf die Eigenständigkeit jedes einzelnen Eindrucks hin, auch wenn das Sprachmaterial oft durchaus schon bekannt ist. Bekanntes und Fremdes werden somit verknüpft, aber der Leser wird aufgefordert, eben dieses auf den ersten Blick Bekannte aus einer neuen Perspektive heraus zu betrachten und in dem auf den ersten Blick Fremden das Bekannte herauszufiltern. Gerade im Kabarett – Mehring war von dem Potenzial und den Wirkungsmöglichkeiten der Kleinkunst in deren Anfangs- und Blütezeit überzeugt – sah der Dichter schon früh eine Möglichkeit, ein modernes Äquivalent zum Satyrspiel der antiken griechischen Tragödie zu schaffen:
Wie der griechischen Tragödie das Satyrspiel frecher und spottender Halbtiere gefolgt ist, so müsse der ‚miserablen Geschichtstragödie‘ des 1. Weltkrieges, den größenwahnwitzigen Generälen und gekrönten Häuptern der Spott und die Satire entgegengesetzt werden. Denn an Grausamkeiten, Ausschweifungen und Entgleisungen stehe diese zivilisierte Gesellschaft am Anfang des 20. Jahrhunderts, nach Krieg, Revolution und Freikorpsunwesen, in keiner Weise längst überholt und exotisch erscheinenden Ereignissen mittelalterlicher Jahrhunderte nach.8
Neben ästhetischen und politischen Kriterien war für die Kabarettlyrik Mehrings auch die Dimension des Vortrags9, die „Synthese von Text, Musik und Gestik, wobei weder eine Komponente fehlen noch dominieren sollte“10, wichtig. Viele seiner Chansons verfasste er für bestimmte Interpreten, deren Eigenarten er kannte. Wenn er Schwierigkeiten hatte, einen Interpreten zu finden, der seine Vorstellungen von Intonation, Rhythmus und Aussprache, z. B. von Dialekt und Soziolekt, umsetzen konnte, trug er sie gelegentlich auch selbst vor.
3. Wichtige Stile und Techniken
3.1 Die radikale dadaistisch-avantgardistische Neuordnung von Sprache
Spuren des Expressionismus, v. a. aber seit Kriegsende des Dadaismus und der Avantgarde ziehen sich durch das gesamte Werk Mehrings, prägen aber gerade seine frühe Lyrik bis Anfang der zwanziger Jahre stark, was sich z. B. in der von ihm häufig angewandten Technik der Montage, auf die im nächsten Kapitel genauer eingegangen werden soll, widerspiegelt. Im Dadaismus, in der Neuordnung der Sprache, dem Bruch mit traditionellen Konventionen, kann der Dichter auf sprachlicher Ebene einen radikalen, durchaus auch unsicheren Neubeginn nach Jahren von sinnloser Zerstörung und Leid, die eine Fortsetzung traditioneller Kunst für viele Lyriker unmöglich machten, markieren. Gerade dem jungen Mehring, der schon früh mit der Avantgarde bekannt gemacht wurde und schnell zu einem der wichtigsten Mitglieder des Berliner Dadaismus um Richard Huelsenbeck avancierte11, boten sich neue Ausdrucksmöglichkeiten für seinen Widerstand gegen Militarismus und Krieg, die Werte der bürgerlichen Gesellschaft und das Fortbestehen traditioneller verkommener Strukturen, v. a. in der Politik.
Exemplarisch lässt sich dieser radikale Traditionsbruch an Mehrings Gedicht „Höllenbahn“ (1918/19) darstellen. Das Bahnmotiv war nicht nur im Expressionismus weit verbreitet, es durchzieht auch (v. a. in Form der Stadtbahn) die gesamte Lyrik Mehrings. Der Leser wird mit einem Gedicht konfrontiert, in dem Eindrücke, die auf den Leser in der Tat wie Beobachtungen während einer ‚Höllenbahnfahrt‘ wirken, direkt in Verse umgewandelt werden, ohne dass eine klare syntaktische oder metrische Struktur zu erkennen wäre. Mehring verzichtet in seinem Gedicht bis auf den letzten Vers völlig auf Interpunktion, was das Tempo des Leseflusses, analog zur Fahrt der ‚Höllenbahn‘, erhöht. Auch die einzelnen Verse selbst sind sehr kurz, bestehen oftmals nur aus einem Wort, manchmal sogar nur aus der Präposition „[i]n“ (CdL, Vs. 11, 22, 25, 65)12. Unter häufiger Verwendung von Assonanzen (z. B. einer u-Assonanz in „Sehnengedr u ckt / Viad u kt / […] / Z u ckt / Z u g um Z u g“ [Vs. 2 f., 8 f.]), Alliterationen (z. B. „ B ahnbrechend / B rünstig / B ruder B runnen überschäumend / B randend / B rand / B richt […]“ [Vs. 36-41]), Neologismen (z. B. „Höllenbahnbrechend“ [Vs. 1], „Eisenschienenschein“ [Vs. 6], „Menschenall“ [Vs. 35]) und weiteren rhetorischen Figuren wie dem Kyklos („ Strahl um Strahl “ [Vs. 5; Vs. 42], „ Zug um Zug “ [Vs. 9], „ Stadt um Stadt “ [Vs. 23]), wird spielerisch jedes einzelne Wort, jeder einzelne Eindruck bzw. Moment als Einzelteil des Ganzen verstärkend hervorgehoben: Jede durch das Gedicht hervorgerufene Assoziation – und gerade die assoziative Schreibweise ist für den Dadaismus charakteristisch – muss dabei als den Gesamteindruck von Hektik, Orientierungslosigkeit, Unsicherheit, Schock und Schnelligkeit verstärkendes Element gesehen werden. In einer Weise, die an dadaistische Lautgedichte erinnert, in denen den Lauten eines Wortes eine höhere Bedeutung als dessen Sinn beigemessen wurde, spielt auch Mehring in seinem Text mit klanglichen Ähnlichkeiten, so z. B. mit einem Polyptoton (z. B. „Leben / lebendig“ [Vs. 59 f.]), dem Stilmittel der Paronomasie („verqualmt / verqualt“ [Vs. 63 f.]) oder der figura etymologica (z. B. „brünstig / Brunst“ [Vs. 66 f.]) – verschiedene, aber doch zusammenhängende Eindrücke drängen sich dem Leser auf, wobei die Eigenständigkeit jedes einzelnen Eindrucks im Ganzen gerade durch diese sprachlich-spielerische Schreibweise nicht untergeht. In einem raschen Tempo werden ähnliche Laute in fast schon mechanischer Weise aneinandergereiht, was die Geräusche einer sich pausenlos und schnell fortbewegenden Höllenbahn – einem Z ug auf Sch ienen – imitieren könnte: z. B. „ Z uckt / Z ug um Z ug / Ge z ückt / […] / Z erbohrt / Z erbrannt / […]/ Ab st ur z “ (Vs. 8-10, 17 f., 21); „ Str ahl um Str ahl / St ahl sch ein die Sch ienen“ (Vs. 42 f.). Die ‚rasende‘ Aneinanderreihung von Sprachfetzen, oft verschiedenster Wortarten, in jeweils separaten Versen, wie in „Langt / bang / entlang / die Bahn“ (Vs. 51-54), verdeutlicht das rasche Tempo der schnellen Höllenbahn bzw. -fahrt, bei der nur eines gewiss ist, was auch zum ersten und einzigen Mal im letzten Vers emphatisch mit einem schließenden Satzzeichen ausgedrückt wird: „Nichts!“ (Vs. 69). Interessanterweise verändert Mehring mit dem Druckbild des Gedichtes die typische Struktur von zusammen- und wieder auseinanderlaufenden Gleisen, wie er sie durch das Einrücken einer fünfzeiligen Strophe, die bildlich eine Weiche darstellt, sowie den parallel verlaufenden Gedichtsträngen im Simultangedicht „Achtung Gleisdreieck!“13 zwei Jahre später anwenden wird. Auch das Fundament steht in der „Höllenbahn“ also auf wackligem, unsicherem Boden.
3.2 Die Montage- bzw. Collagetechnik
Die Montagetechnik ist Inbegriff des dadaistischen Anspruches, Sprache zu verfremden und zu erneuern. Mehring verwendet als sprachliches Rohmaterial für seine Montagen hauptsächlich politische Parolen, Schlagzeilen aus Zeitungen, Sprichwörter, Werbeslogans, Liedzitate, Firmennamen, verfremdete literarische Zitate, Filmzitate, fremdsprachige Begriffe, dialektale Formulierungen, Zuhälter- und Dirnenjargon sowie Bibelstellen und Gebetspredigten, um diese zu einem collageartigen Ganzen zu formen bzw. in einen fremden Kontext einzubauen. Oft erzielt die radikale Kombination verschiedener Elemente die Wirkung einer alle Eindrücke einfangenden Reportage; auch für parodistisch-satirische Zwecke verwendet Mehring seine Technik. In einer Zeit, in der neue mediale Formen wie Kino und Reportage, die Dominanz der Unterhaltungs- und Werbeindustrie, politische Propagandaparolen sowie eine zunehmend rationalisierte Technik- und Arbeitswelt das Alltagsleben v. a. des Großstadtmenschen prägen, spiegelt die Form der Montage das Lebensgefühl der zwanziger Jahre wider, in der das Individuum die auf ihn ununterbrochen einprasselnden Eindrücke zu verarbeiten hat. Mehring versucht, diesen reflektiv-kritischen Umgang mit Sprache, der den Erfahrungshorizont des Einzelnen erweitern soll, mit seiner Montagetechnik anzukurbeln:
Gerade im 1. Weltkrieg, in dem Kriegsberichte, Wochenschauen, patriotische Reden und Appelle die Bürger in dem ‚Schlicksand der Propagandaphrasen‘ und den ‚Bunkern der Gedankenabwehr‘ einzufangen versuchten, war die Filterfunktion der Sprache auch bei Walter Mehring besonders krass erfahren worden. Die Montage kann also als eine Möglichkeit verstanden werden, das ‚illusionistische Sprachgewebe‘ aufzuweichen, zu durchlöchern und damit ‚die [E]insicht in das, was sich in dieser unserer [R]ealität mit uns selbst abspielt‘, ganz entscheidend zu erweitern. Die Montage deutet folglich ein Prinzip zur Realitätserfahrung an.14
Gerade dadurch, dass die Kombination bzw. Anordnung von solchem oft radikal verschiedenartigem Sprachmaterial auf den ersten Blick keinen oder nur einen sehr doppeldeutigen Sinn ergibt, was auf den Rezipienten wie ein Schock wirkt15, wird der Leser zur Reflexion angeregt. Es ist eben nicht das Bild des harmonischen Ganzen, in dem das Einzelelement untergeht, das vom Dichter erzeugt wird – ganz im Gegenteil:
[D]er Avantgardist [will] gerade diesen von ihm erkannten ‚Schein der Totalität‘ zerstören. Er montiert Fragmente, und zwar reale, ihn umgebende Wirklichkeitsfragmente des Alltags zu einem Ganzen, ohne die Absicht, den Einbau der Teile zu glätten und zu kaschieren. Dem Kunstwerk sind die Einzelteile unterschiedlicher Herkunft anzumerken, die sich nicht fugenlos zu einem harmonisch runden Gesamteindruck zusammenfügen.16
Exemplarisch kann dies z. B. am Sprachmaterial in der ersten Strophe des Chansons „Wenn der Westen aber ein Loch hat…“ (1920) gezeigt werden, das vermutlich illegale Handels- bzw. Grenzgeschäfte und Korruption zur Zeit der Rheinlandbesetzung, die von der Missachtung deutscher Ein- und Ausfuhrverbote durch die Alliierten geprägt war, thematisiert bzw. parodiert. Die Kombination verschiedenartiger Dialogfetzen stellt die Undurchsichtigkeit des beschriebenen Rummels auf sprachlicher Ebene dar: „»Frei Saarbrücken: Navy-cuts! / Occasion of cigaretts!« / »Prima Ware!« Was betrog’s? / Ran die Ladung!« »Haste Koks? / Eeene Prise for de Neese, / Deklariert als weißer Käse!« / »Salvarsan gleich mit Vehikel / Riesig gangbarer Artikel!« (CdL Vs. 1-8). Fehlerhaftes Englisch, Berliner Dialekt, präzise Standardsprache und elliptische Ausrufe werden aneinandergereiht, ohne dass ein harmonischer Gesamteindruck entsteht oder das Einzelne im Ganzen der Strophe bzw. des Gesamteindrucks untergeht. Genauso wie die undurchsichtigen und getarnten Geschäfte soll auch die Sprache in diesem Zusammenhang getarnt bleiben, so wird „Koks“ schnell zu „weißem Käse“, „Salvarsan“ – ein Medikament gegen Syphilis – schnell zu einem „[r]iesig gangbare[n] Artikel“. Wenn man von den ersten beiden Versen absieht, die als einzige in der Strophe durch einen unreinen und nicht durch einen Paarreim zusammengehalten werden, zeigt sich, dass die Verfremdung der Sprache selbst nicht so sehr durch die Verfremdung des einzelnen Wortes, das an sich verständlich bleibt, sondern durch die Aneinanderreihung bzw. Montage der Wörter in einen völlig neuen, fremden Kontext, in dem selbst das scheinbar verständliche Wort einer neuen Überprüfung unterzogen werden muss, vollzogen wird.
3.3 Sprachen-Ragtime, unregelmäßiger Rhythmus und Jazzelemente
Mit dem von Mehring selbst verwendeten Begriff ‚Sprachen-Ragtime‘, den Frank Hellberg wörtlich mit „zerrissene Zeit“17 übersetzt, sind v. a. Unregelmäßigkeiten im Metrum gemeint, wobei eine „unregelmäßige, die schwingende Bewegung störende rhythmische Organisation“18 das Gedicht charakterisiert, die v. a. durch das Gegeneinanderarbeiten von Satzrhythmus, also der Anordnung der Wörter, in der Hellberg das Individuelle sieht, und Versrhythmus, womit das Metrum gemeint ist, in dem Hellberg das Allgemeine sieht, hervorgerufen wird.19 Somit wird eine einheitliche Rhythmusbewegung durch die Spannung zwischen Satz- und Versrhythmus verhindert und oft zusätzlich verstärkt durch deutlich unterschiedliche Verslängen, der Verwendung von Einwortzeilern und fremdsprachigen Sprachfetzen, der Montage von scheinbar nicht zusammenhängendem Sprachmaterial, einem unregelmäßigen Reimschema und einer fehlenden Gliederung in Strophen. Dadurch wird nicht der Effekt eines harmonischen, gleichmäßigen, sondern eines in schnellem Tempo vorantreibenden, unberechenbaren Rhythmus erzielt. „[D]er regelmäßig fließende Rhythmus der traditionellen Lyrik wird durch einen ‚Ragtime‘, einen in kurze Explosionen gesprengten Satz ersetzt, der den Leser/Zuhörer irritiert.“20 Dabei bezeichnet der Ragtime auch den in den USA entstandenen Vorläufer des Jazz; bis 1915 kann sich ‚Ragtime‘ als gängige Bezeichnung für die Musikrichtung des Jazz halten.21 Der ‚jazzartige‘, vorwärtstreibende Rhythmus spiegelt dabei das Lebensgefühl der Menschen der zwanziger Jahre wider, „das hektische und schnellebige [sic!] Treiben der europäischen Großstädte“, in der der Jazz die Unterhaltungskultur wesentlich mitbestimmte.22
Exemplarisch lässt sich dieser Rhythmus am Kabarettgedicht „Salto Mortale“ (1921) darstellen, das ein Zirkusprogramm beschreibt, welches mit dem Unglück des Trapezkünstlers endet. Dabei erinnern die Thematik des Gedichtes, der Name des Künstlers (Augustin) und einzelne Passagen aus Mehrings Gedicht an das balladenartige, durch seinen Galgenhumor gekennzeichnete Spottlied „O du lieber Augustin“ des Bänkelsängers Marx Augustin, welches sich Anfang des 19. Jahrhunderts als bekanntes Volkslied verbreitete. Bereits in den ersten Versen von „Salto Mortale“ lässt sich ein stark unregelmäßiger Rhythmus feststellen; die schwingenden Bewegungen, die auch die Aufführung der Zirkuskünstler charakterisieren, spiegeln sich in dem raschen, unübersichtlichen, hektischen Rhythmus wider:
Ach, du lieber Augustin, Augustin, Augustin – x – x – x x – x x – x x
Ach, du lieber Au… – x – x –
Schau –
der Excentrics x x – x
Mit Fußtritts x – –
Und slapsticks x – –
Die Wände lang x – x –
längelang = – x –
Chorgirls aus – – x
Engel-Land – x –
reigen am Gängelband – x x – x x
zeigen die Schenkel = – x x – x
ihr Lullaby x – x x
Lullaby – – x x
Ach, du lieber … – x – x
Husch – und – x
vorbei – – –
und x
Vorhang und Tisch = – x x –
Seile in – x x
Eile hin – – x – (CdL Vs. 1-21)
Weder im Reimschema (es werden sowohl identische Reime, unreine Reime, Paarreime als auch freie Verse verwendet, ohne dass eine feste Struktur zu erkennen wäre) noch im Metrum (eine trochäisch-daktylische Grundstruktur lässt sich grob ausmachen, die allerdings sehr oft unterbrochen wird, z. B. durch Spondeen und freie Verse) noch in der Abfolge der Kadenzen lässt sich eine Regelmäßigkeit erkennen, wie es noch im Volkslied der Fall ist. Gerade durch die unterschiedlich langen Verse – v. a. das stufenweise Abnehmen der Verslänge in Vs. 15-18 und Vs. 62-69 sticht hier ins Auge –; durch Einwortzeiler wie „Schau“ (Vs. 3), „und“ (Vs. 18, 44, 69), „Fertig“ (Vs. 48), die die Spannung verstärken und das Tempo erhöhen; durch die häufige Verwendung von Anakoluthen (wie z. B. Auf in den Kampf – und = : / Wie sie so sanft ruhn = und“ [Vs. 70f.]) und Elisionen (wie z. B. „Ach, du lieber Au…“ [Vs. 2]) sowie durch englische Begriffe („Excentrics“ [Vs. 4], „Lullaby“ [Vs. 13 f.], „LOOPING – the – Loop“ [Vs. 57]) wird eine harmonische Grundstruktur gar nicht erst ermöglicht. Es sind Schnelligkeit und Hektik, aber auch Unberechenbarkeit und Gefahr – wie sich an dem Unglück des Trapezkünstlers, das gegen Ende des Gedichtes angedeutet wird, zeigt – die die beschriebene Atmosphäre im Zirkus charakterisieren, die der schnelle, explosionsartige Rhythmus, der die Spannung bis zum Ende aufrechterhält, verstärkt. Das Ende des Gedichtes zeigt, dass die gefährliche Aufführung des Trapezkünstlers auf genauso wackligem Boden stand wie das ‚alles zusammenhaltende‘ und ‚schwingende‘ rhythmische Gerüst des Gedichtes, und das Resultat wird ähnlich wie in der „Höllenbahn“ ernüchternd-resignativ formuliert: „Alles / ist / hin.“ (Vs. 79-81). Sogar diese letzten Worte werden in drei Verse auseinandergerissen, während das Volkslied von Augustin noch in einem Vers – „Alles ist hin!“ endet. Wie die Montagetechnik verlangt auch der Sprachen-Ragtime einen aktiven und hinterfragenden Leser, der die auf ihn einprasselnden Reize und Eindrücke kritisch hinterfragt und sein Verhältnis zur Realität reflektiert:
Der Dichter kann und will nicht die umfassende Realität negieren oder verdrängen, sondern er drückt ein grundsätzlich anderes Verhältnis zu ihr aus. Dieses ist nun nicht mehr geprägt von einer Unterschiede nivellierenden, vermischenden lyrischen Stimmung, sondern von Distanz, Skepsis und Kritik. Wie die Montage legt es auch der ‚Sprachen-Ragtime‘ darauf an, die Kontinuität der traditionellen Lyrik zu zerstören und ganz bewußt mit dem Bruch und dem Gegensatz zu arbeiten. Beide verhindern eine Rezeption, die durchgehend und glatt und ohne eine reflektorische und überprüfende Anstrengung den Text einverleiben will. Der Effekt ist gleichermaßen der einer Diskontinuität und des Zerrissenen.23
4. Gesellschaftliche Kritik durch Sprache und Form – verschiedene Ansätze
4.1 Die Diskrepanz von Form und Inhalt am Beispiel der Verwendung eines regelmäßigen Rhythmus
Es darf nach den Eindrücken des „Salto Mortale“ nicht unerwähnt bleiben, dass Mehring genauso regelmäßige Strukturen für seine Gedichte verwendete, v. a. für parodistisch-politische Zwecke in seiner Kabarettlyrik. So parodiert er in dem politischen Chanson „Maifeier“ (1920) unter Verwendung einer schlichten, einprägsamen, fast schon harmonisch-fröhlichen metrischen Form, die an die Volksliedstrophe erinnert, allerdings in starkem Gegensatz zum aufgegriffenen Thema steht, seine Wut auf die Freikorps und die Sozialdemokratie, der er einen mangelnden revolutionären Elan24 und einen Verrat an der Arbeiterklasse vorwirft. In der „Maifeier“ lässt sich im Gegensatz zum „Salto Mortale“ eine regelmäßige Stropheneinteilung ausmachen, auch die Verse sind alle ungefähr gleich lang. Mit dem Metrum des größtenteils durchgehaltenen, oft katalektischen trochäischen Drei- bzw. Vierheber werden die vier Strophen, die jeweils aus acht Versen bestehen, die alle einen Paarreim25 und eine regelmäßige Abfolge von vier weiblichen und männlichen Kadenzen (Schema: wwwwmmmm) aufweisen, zusammengehalten. Das recht eingängige Metrum und Reimschema stellen eine zur Thematik entgegengesetzte Wirkung her: Der Anlass zur „Maifeier“, der Tag der Arbeit, scheint auf den ersten Blick fröhlich, allerdings wird in Mehrings Gedicht eine sehr spezielle Art der „Sozialreform“ und „Arbeitslosen-Dezimierung“ thematisiert: „Von Berlin bis Oberbayern / Soll’n wir’n ersten Mai jetzt feiern, / Jleich befiehlt die Reichsregierung: / Arbeitslosen-Dezimierung! / Todesmutig, Mann für Mann / Rückt das Freikorps Lüttwitz an. / Der Erfolg is janz enorm, / Stike! Mensch – Sozialreform!“ (CdL Vs. 1-8). Genau am Tag der Arbeit werden nun ironischerweise Teile des Proletariats durch Freikorps bekämpft, wie bereits vor einem Jahr – dem „Jahrestag der Schlacht bei München“ (Vs. 20), mit der der letzte Versuch der Errichtung einer Räteregierung in Deutschland endete. In der Kooperation der von den Sozialdemokraten geführten Regierung mit den spöttisch als „[t]odesmutig“ bezeichneten paramilitärischen Einheiten sieht Mehring nicht nur einen Verrat der Arbeiterpartei an dem Proletariat, sondern auch das Fortbestehen von gesellschaftlich-politischen Strukturen der kaiserlichen Vorkriegsgesellschaft, das nicht zuletzt auch durch die traditionelle, konventionelle Struktur des Gedichts symbolisiert wird. Auch den Untertanengeist bzw. das Mitläufertum der Durchschnittsdeutschen, die den 1. Mai fröhlich feiern, ohne das Vorgehen der Regierung und der Freikorps zu hinterfragen, sich vermutlich sogar die Strukturen des Kaiserreiches zurückwünschen, kritisiert er: „Und nach altem deutschem Brauch / Kriecht Germania auf dem Bauch.“ (Vs. 29 f.). Erst in der letzten Strophe ändert Mehring den Refrain zum ersten Mal ab: „Ja die Pleite is enorm, / Stike! Mensch – Sozialreform!“ (Vs. 31 f.). Was im ironischen Unterton des ganzen Gedichtes bereits anklang, wird nun direkt als das beschrieben, was es für Mehring ist: eben nicht ein ‚janz enormer Erfolg‘, sondern eine moralische „Pleite“ (Vs. 31), v. a. auf Seiten der Regierung. Die Abänderung des Refrains in der letzten Strophe stellt dabei eine für Mehring typische Technik dar:
Der Refrain ist nicht mehr nur eine sich wiederholende spassige Pointe, Mehring setzt ihn ein, um seine polemische, satirische Absicht zu unterstützen. Kleine Veränderungen im letzten Refrain unterlaufen die Erwartungshaltung des Zuhörers und sollen das ‚aha‘ bewirken. Mehrings Couplets sind nicht auf das Strophenende, sondern auf das Ende des Couplets hin orientiert, ähnlich wie ein Drama mit seiner Konzentration auf einen Höhepunkt. Der letzte Refrain setzt die lehrhafte Pointe.26
4.2 Das liturgische Chanson – Rückgriff auf religiöse Kontexte und Formen
In seinem Kabarettprogramm „Das Ketzerbrevier“ (1921), das nun weniger von der Thematisierung tagespolitischer Ereignisse wie dem Verhalten von Militär und Regierung am Tag der Arbeit, sondern von allgemeineren und grundsätzlicheren, oft aber immer noch politischen Aussagen geprägt ist27, behandelt Mehring u. a. das Verhältnis von Macht und Religion28 sowie die Zusammenarbeit von Staat und Kirche bei Machtmissbrauch und Unterdrückung des Individuums, dessen Untertanengeist und Unselbstständigkeit er kritisiert. Mehring, der immer noch durch die Erfahrungen des 1. Weltkrieges, aber auch durch den anhaltenden Militarismus im eigenen Land und an den Landesgrenzen beeinflusst ist, parodiert in den Chansons die „Selbstverständlichkeit, mit der der Staat die lebensbejahenden Grundsätze des christlichen Glaubens für seine aggressiven und lebensvernichtenden Zwecke vereinnahmt“29 und weist auf „Betrug und Verlogenheit von machtausübenden staatlichen wie kirchlichen Institutionen [und] das Leiden der Menschen unter dem staatlichen Machtmißbrauch zu Gunsten partikulärer Interessen“30 hin. Dabei dienen auch hier das Aufgreifen von traditionellen, eingängigen Formen wie dem Gebetslied oder der Einbau von biblischen Zitaten oder Gebetsrufen in einen veränderten Kontext dem Zweck der Parodie bzw. der teils doch sehr deutlich formulierten Kritik. Bereits die Überschriften der im Unterkapitel „Die weiße Messer der Häretiker“ abgedruckten Chansons verweisen, wie auch hier in „Sanctus (Segen des Alltags)“, auf eine religiöse Thematik. Ein erster Blick auf den Text würde vermuten lassen, dass es sich auch wirklich um einen Song für einen Gottesdienst handelt: Nicht nur die Überschrift ist einem solchen Kontext ähnlich, auch jede einzelne Strophe schließt mit einem Fleh- bzw. Jubelruf an Gott – Hosiannah! („Rette/Hilf doch!; „Gib Heil!“). Der Aufbau des Gedichts ist regelmäßig – vier Strophen mit je vier Versen, wobei die vorletzte Zeile jeweils zu Beginn der darauffolgenden Strophe wiederholt wird, wie es in vielen gottesdienstlichen Gebetstexten üblich ist. Das Reimschema signalisiert analog dazu ebenfalls eine Regelmäßigkeit. Es ergibt sich – wenn man den am Ende jeder Strophe wiederholten Gebetsruf weglässt – die Abfolge a a b / b b c / c c d / d d d – drei Paarreime und ein Haufenreim, wobei die Verse 3, 7 und 11 jeweils Waisen sind, die den Reim der folgenden Strophe einleiten. Bei näherer Betrachtung des Textes zeigt sich, dass das gebetsmühlenartige Wiederholen des Bittrufes sowie des jeweils letzten Verses einer Strophe zu Beginn der darauffolgenden Strophe spöttisch parodiert wird: Wie „dressierte Papageien“ (CdL Vs. 3 u. 4) plappern die Kirchengänger routiniert einen Text nach („Auf Höllenangst dressierte Papageien!“ – „Auf Höllenangst dressierte Papageien!“ [Vs. 3 u. 5]), in dem gerade ihr Verhalten ins Lächerliche geführt wird – was ihnen nicht auffällt, da sie ihre eigenen Worte offenbar nicht hinterfragen können: „Auf Höllenangst dressiert[]“ (Vs. 3) beten sie beispielsweise „um ihr täglich Futter“ (Vs. 6), während ironischerweise ihr dicker „Schmerbauch“ (Vs. 11) deutlich hervorsticht und ihr unangenehmer Atem mit seinem Zwiebelgeruch den Weihrauch „schwänger[t]“ (Vs. 10) – ein durchaus gewagter Begriff für die Beschreibung eines kirchlich-religiösen Kontextes wie dem Gottesdienst, was Mehrings Bereitschaft, das gesellschaftlich unkritisch hingenommene Tabu von Religion und Kirche aufzubrechen, zeigt. Im ganzen Gedicht verwendet der Dichter doch eine sehr direkte Sprache, so stellt er die Kirchengänger als hohle Kahlköpfe (vgl. Vs. 2) dar, deren Art zu beten – „Sie beten mit dem Schädel gegen Wände“ (Vs. 1 u. in leicht abgeänderter Form Vs. 15) – genauso ‚hohl‘, geistlos und unproduktiv ist wie ihr Nachplappern von Texten, deren Inhalt sie sowieso nicht hinterfragen. Ihre Anwesenheit beim Gottesdienst stellt somit nicht mehr dar als die Anwesenheit eines „[i]n Haut gebunden[en] […] Leichnam[s]“ (Vs. 14). Mehring selbst weist in seinen Texten immer wieder auf die Notwendigkeit der Selbstbestimmung des einzelnen Individuums hin, dessen Aufgabe allein es ist, eigenständig zu hinterfragen und handeln, was den Kirchengängern hier offensichtlich nicht gelingt. Im Chanson „Schwarze Ostern (Victimae Paschali Laudes)“ formuliert er seine Kritik am untertänigen Einzelnen, der sich für seinen ‚Ungeist‘ und moralisch verwerfliches Handeln auf Gott, Autorität und Herrscher bezieht, noch direkter. Nach einem biblischen Vergleich – „Da half kein Kaiser und kein König, / Kein Gott nicht und Gebet nicht / Dem Sündenbock für ihre Schuld!“ (CdL Vs. 9-11, 22-24) – adressiert er schließlich sein Leser- bzw. Hörerpublikum, das jetzige Volk: „Da hilft kein Kaiser und kein König, / Kein Gott nicht und Gebet nicht / Dem Sündenbocke eurer Schuld“ (Vs. 35-37). In der letzten Strophe bringt er seine Forderung noch deutlicher zum Ausdruck:
Und bleibt ein ganzes Volk im Dreck,
Winkt ihm ein Paradies als Speck!
Ob Religion und Staat befehl’n,
Sie alle ködern eure Seel’n!
Mißtraut, mißtraut dem höhern Zweck!
Mißtraut, wo Abgetanes siecht!
Mißtraut, wo’s nach Kasteiung riecht!
Seid euch selbst untertänig! (Vs. 27-34)
4.3 Rollengedicht und Ballade – Rückgriff auf traditionelle Untergattungen
Seit der Entstehung seiner politischen Satiren für das Kabarett im Jahr 1920 bedient sich Mehring zunehmend auch traditioneller Formen wie dem Rollengedicht und der Ballade, um Hörer und Leser mit seinen Texten zu erreichen. In seinen Rollengedichten lässt Mehring das lyrische Ich in verschiedene gesellschaftliche Außenseiterrollen schlüpfen – Dirnen, Zuhälter, Landstreicher, Abenteurer, Seemänner. Dabei sind die mit den Tätigkeiten bzw. Berufen der jeweiligen Figuren assoziierten Eigenschaften und Merkmale wichtiger als deren individuelle Charakterzüge und Hintergrundgeschichten. Wie in seinen Großstadtgedichten zeichnet Mehring also auch in den Rollengedichten grundsätzlich keine detaillierten Einzelschicksale; vielmehr stehen die Äußerungen der Figur auf der Bühne im Mittelpunkt. Der Dichter behält grundsätzlich Distanz zu seinen Figuren; seine recht allgemeine, oft unrealistisch gehaltene Darstellung zeugt eher von der Beschreibung eines Figurentypus als von der eines Individuums.31 Die Figur ist durch ihr Milieu definiert, was sich häufig auch auf sprachlicher Ebene in Dialektfärbung und Verwendung von Milieuwortschatz widerspiegelt. Aus diesem Milieu heraus kann sie in authentischer Weise ihre Erlebnisse reflektieren, die immer auch ein Spiegelbild der gesellschaftlichen Verhältnisse bzw. politischen, sozialen und/oder moralischen Zustände ihrer Zeit sind. Auch wenn Mehring mit dem Rückgriff auf das Rollengedicht eine Form verwendet, die sich schon immer großer Beliebtheit erfreute, modernisiert er diese doch32 und formuliert oft eine allgemeine, aber dennoch recht direkt zum Vorschein kommende gesellschaftskritische Position in seinen Texten: „Mehrings Beitrag [besteht] vor allem in der Ablösung von der rein persönlichen Aussage, wie sie bei Ringelnatz meist im Vordergrund stand, durch eine allgemeiner gehaltene, die es ihm erlaubt, seine Zeit zu kritisieren, deren Kind er war […]“.33 Seine Rollenlieder erfreuen sich großer Beliebtheit beim Kabarettpublikum, v. a. das Dirnenlied ist sehr populär.34 Formal und inhaltlich zeichnen sich Mehrings Rollengedichte größtenteils durch einen „längere[n] und sich ändernde[n] Refrain“35, eine inhaltliche und mediale Anlehnung an den Bänkelsang – also erzählende Lieder mit traurigem oder spektakulärem Inhalt36 – und durch die Verwendung von „bissig scharfe[m] Witz“37, „bittere[m] Ernst“ und „gezielte[r] Satire“38 aus.
In „Die Arie der Großen Hure Presse“ (1924) lässt Mehring eine Prosituierte, die als personifizierte Presse auftritt, ihr Gesangsstück vortragen. Dabei wählt er für die Beschreibung der Tätigkeit der ‚Frau Presse‘ bewusst Wörter, die auch mit dem Berufsfeld der Prostitution assoziiert werden, z. B. „Reiz“ (CdL Vs. 3), „Dessous“ (Vs. 12), „unschuldsvoll geschminkt“ (Vs. 16 f., 45 f.), „Was ich wohl verbergen mag!“ (Vs. 28), „Neugierlüstern“ (Vs. 27, 56), „Löst sich Blatt für Blatt die Hülle“ (Vs. 30), „verführt“ (Vs. 35), „Empfehlung“ (Vs. 38), „Denn die Ware und die Liebe sucht Verbreitung“ (Vs. 42). Auch in diesem Rollengedicht wird somit schnell klar, dass die typischen Eigenschaften einer gewöhnlichen Dirne wichtiger sind als das persönliche Einzelschicksal der ‚Frau Presse‘. Auch Gefühle, sofern sie vorhanden sind, sind leicht zu verstellen und der jeweiligen Situation bzw. dem jeweiligen Kunden anzupassen, also ebenfalls untrennbar mit ihrem Beruf verbunden: „Und ein Jüngling sucht bei mir ein liebend Herz, / Ich verkünde voller Scham die Vermählung, / Voller Tränen von der Hinterbliebnen Schmerz.“ (Vs. 39-41). Auch in diesem Chanson bewirken kleine Veränderungen im letzten Refrain weitreichende Veränderungen für das Verständnis der Moral des Gedichtes, da die wahren Motive der Presse und v. a. die Sensationsgier der Bürger entlarvt werden: Es geht nämlich nicht (nur) darum, „[d]es Gerüchtes Donnerwetter“ (Vs. 21) oder „[d]er Reklamen Ruhmgeschmetter“ (Vs. 50) zu verkünden, sondern auch darum, Hetze – „[d]er Verhetzung Donnerwetter“ (Vs. 80) – zu verbreiten. ‚Frau Presse‘ ist jetzt nicht mehr „unschuldsvoll geschminkt“ (Vs. 16 f., 45 f.), sondern „blutendrot“ (Vs. 75). Das ‚flüsternde Lüstern‘ der Kunden (vgl. Vs. 26 f., 55 f.) hat sich nicht verändert, allerdings sind nun die wahren Wünsche der Herrschaften durchsichtig geworden: Nicht (nur) ihre geifernde, schier endlose Neugier („Neugierlüstern“ [Vs. 27, 56]; „Was ich wohl verbergen mag!“ [Vs. 28, 57]), sondern auch das Verlangen, die schon polarisierte, konfliktreiche gesellschaftliche Situation zur Befriedigung ihrer Sensationslust noch zu verschärfen: „Und ein Flüstern / Fragt sich lüstern, / Wo den Brand ich schüren mag!“ (Vs. 85-87). In einer Zeit, in der der Mensch von neuen Reizen einer aufblühenden Unterhaltungskultur und einer spannungsgeladenen politischen Situation geradezu überschwemmt wird, sind sowohl die Presse, der Mehring u. a. „Kommunistenhetze, Opportunismus und Deckung von Fememorden vorwirft“39 als auch der sensationssüchtige Großstadtbürger nur auf die eigenen Interessen und egoistischen Bedürfnisse bedacht.
Auch in dem vier Jahre zuvor veröffentlichten Chanson „Fräulein Irène, die tätowierte Wunderdame“ (1920) lässt Mehring eine Dirne sprechen, die hier nun die Tätowierungen an ihren einzelnen Körperteilen beschreibt. Dabei wird parodistisch beschrieben, wie der Freier deutsche Kultur u. a. in Form von „Malzbier“, das der Dirne „aus’m Hals [wächst]“ (CdL Vs. 8 f.), sowie durch die „Wagner- und die Mozartbüsten“ auf ihren Brüsten (Vs. 11 f.) erleben kann. Auch am Ende dieses Textes stößt der Leser auf eine politische Pointe, als nicht mehr genau benannte Körperteile der Prosituierten beschrieben werden, sondern paradoxerweise ihre „Unschuldsphäre“ (Vs. 29) erwähnt wird, in der „Die junge Republik “ (Vs. 28) – gemeint ist hier die Weimarer Republik – eintätowiert ist. Ob es sich bei der „Unschuldsphäre“ um den Intimbereich der Prostituierten oder um ein Bordell handelt, bleibt unklar, allerdings ist ‚unschuldig‘ sicherlich nicht die erste Assoziation, die der Leser mit diesem Milieu und mit der sehr freizügig-frech auftretenden Fräulein Irène verbindet. Nach der Aufführung des Songs hat laut Anweisung im Text die Kapelle ausgerechnet das Lied „Deutschland, Deutschland!“ zu spielen. Somit werden die mit dieser Dirne bzw. dem Milieu der Prostitution generell assoziierten Eigenschaften – Scheinheiligkeit, Verstellung, Käuflichkeit, Lächerlichkeit – direkt in Beziehung zu den gegenwärtigen Verhältnissen der jungen Weimarer Republik gesetzt40, wobei auch die ‚Kultur‘ der – vermutlich patriotisch-bürgerlichen – Freier der Dirne ins Lächerliche gezogen wird.
Auch in seinen Balladen, von denen er einige nur wenige Jahre vor seinem Exil verfasste, lässt Mehring politische Botschaften durchsickern. Ihnen sind, genauso wie den Rollengedichten, so Frank Hellberg, eine „Orientierung am historischen Bänkelsang“ sowie zudem eine „Verwandtschaft zu den Bänkelsatiren Erich Kästners“ anzumerken.41 Thematisch sind v. a. eine immer expliziter geäußerte Kritik an gesellschaftlich-politischem Unrecht sowie der rechtslastigen Klassenjustiz der Weimarer Republik Schwerpunkte, aber auch generelle Fragen von moralischer Verwerflichkeit und menschlicher Unmündigkeit stehen im Mittelpunkt. An zwei Balladen Mehrings aus dem Jahr 1931, „Ballade der Arbeiterin Jenny Bohn“ und „Die Ballade von der Lehrerin Elly Maldaque“, lässt sich dies exemplarisch besonders gut darstellen. Beide Balladen behandeln Schicksale von vor Gericht verurteilten Frauen, wobei die Thematisierung der Ereignisse – wie für die Gedichtform der Ballade üblich – exemplarischen Charakter hat:
Im Mittelpunkt stehen jeweils Gerichtsurteile über Menschen, die sich einem formaljuristisch sicherlich zu rechtfertigenden Verfahren zu unterziehen hatten, das aber jeder Humanität entgegensteht und eine, an Menschlichkeit und Demokratie orientierte Rechtsprechung auf den Kopf stellt. Mehring wertet diese Ereignisse, die er Zeitungen entnommen hat, als Exempel für den demokratischen Verfall der Weimarer Republik.42
Bereits die Unterüberschriften der beiden Balladen implizieren eine Kritik am Rechtssystem – „[Jenny Bohn –] welche, weil sie nicht nähren konnte, zu Haft verurteilt ward“ und „[Elly Maldaque –] welche, kommunistischer Irrlehren bezichtigt, ins Gefängnis gesteckt wurde, wo sie verstarb im zweiten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts“. Auffallend ist an beiden Texten, v. a. der Ballade der Jenny Bohn, der im Vergleich zu Mehrings früheren Kabaretttexten auffallend düstere, stark angespannte Ton, der durch eine klare, ungeschmückte Sprache und dem Verzicht auf Metaphern und Parodie verstärkt wird. Zwar wird auch hier eine gewisse Spannung noch aufrechterhalten – den Hörer bzw. Leser interessiert das Schicksal der Frauen –, allerdings fehlt die überraschende Pointe, da der kritische Ton des Dichters bereits zu Beginn unüberhörbar ist und die Überschrift schon die wichtigsten Informationen liefert. Gegen Ende der Weimarer Republik – Mehring steht kurz vor dem Exil – ist die Wut und bittere Enttäuschung des Autors in jeder Zeile spürbar, er will jetzt eine klarere Botschaft an sein Publikum senden. Wie für die Formen des Bänkelsangs und die Ballade nicht unüblich43, findet sich in beiden Texten klar eine Moralisierung und Wertung des beschriebenen Ereignisses; die Darstellung des Einzelschicksals ist dabei repräsentativ für die gesellschaftlichen Verhältnisse und mit einem klaren Appell an den Zuhörer verbunden: „Die Jenny Bohn war schwächlich, – wog nur neunzig Pfund / Ihr habt die Kraft zu schrein und schließt den Mund!“ (Vs. 31 f.), bzw. in „Die Ballade der Lehrerin Elly Maldaque“ auch mit einem immer noch an manchen Stellen anklingenden beißend-spöttischen Unterton: „Und nun ihr Mütter lernt und rechnet nach / Ob sich die Lust in euren Betten lohnt / […] / Wollt ihr noch weiter Helferinnen sein / Um solch System mit Menschen zu beglücken?“ (Vs. 1 f., 31 f.). Das moralische Versagen des Staates wird nicht mehr nur angedeutet, sondern dem Einzelnen direkt vor Augen geführt: „Denn Jenny Bohn war schwächlich – wog nur neunzig / Pfund / Und die sie richten – sind robust gesund!“ (Vs. 23-25) bzw. „Mit etwas Rechnen, Beten und Latein / Impft sie der Staat, bis ihre Seeln verkrüppeln / Bis sie sich ducken, bis sie nicht mehr schrein / Wenn sie sich gegenseitig niederknüppeln.“ (Vs. 5-8). In beiden Balladen tritt das epische Element des Erzählers klar hervor, der sein Publikum gleich im ersten Vers direkt anspricht: „Hört, bitte, all zu!“ (Vs. 1) bzw. „Und nun ihr Mütter lernt und rechnet nach“ (Vs. 1).
5. Der vergessene Walter Mehring?
Obwohl Walter Mehrings Texte sich v. a. Anfang der zwanziger Jahre auf den Kabarettbühnen einer großen Beliebtheit erfreuten, ist der Dichter seit Beginn der Nachkriegszeit zunehmend in Vergessenheit geraten. Mehring selbst war enttäuscht von der Diskrepanz zwischen Tucholskys immer noch anhaltender Popularität und seiner recht spärlichen Anerkennung in der literarischen Öffentlichkeit seit Ende des 2. Weltkrieges.44 Verstärkt durch eine Schreibblockade, die ihn schon im amerikanischen Exil plagte, sowie einem resignativen Ohnmachtsgefühl45 nach zwei Weltkriegen, Exil, ständiger Unsicherheit und der ernüchternden Feststellung, dass er das Ausmaß der Wirkung seiner Texte und der Lyrik generell deutlich überschätzt hatte, setzte ein zunehmend verbittertes Gefühl der Isolation bei ihm ein. Bereits seit Beginn seines kabarettistischen Schaffens sah er sich wie andere Dichter mit Problemen konfrontiert, die unmittelbar an die Bedingungen der Weimarer Unterhaltungskultur geknüpft waren: Wie alle anderen Künstler, denen der Weg auf die große Bühne noch nicht ermöglicht worden war, musste er mit konkurrierenden Medien mithalten – in einer Zeit, in der der Mensch „mehr und mehr mit unterhaltungsindustrieller Fertigware abgespeist“ und „[d]ie breite Masse der Öffentlichkeit […] von der Intellektuellenkultur und ihrer Geistigkeit somit unberührt“ blieb.46 Auch wenn Mehring sich darum bemüht, seine Texte einem breiten, auch literarisch-kulturell nicht versierten Publikum zugänglich zu machen – was oft bei einem schnellen Blick auf seine Gedichte vergessen wird –, so bleibt sein Publikum doch größtenteils eine intellektuell-bürgerliche Schicht. Auch von Kästners Konzept der Gebrauchslyrik ist er mit seinem Sprachverständnis, das von einer spielerisch-intellektuellen Spracherneuerung zeugt und einen aktiven, hinterfragenden Leser verlangt, doch entfernt:
Ob als Dada-Aktion oder als Nummer im literarischen Kabarett: In dem einen wie dem anderen Fall ist Mehrings Lyrik weit entfernt von dem Konzept von ‚Gebrauchslyrik‘, das Erich Kästner Ende der 1920er Jahre propagierte. ‚Brauchbar‘ sollen nach Kästner solche Verse sein, ‚bei denen auch der literarisch unverdorbene Mensch Herzklopfen kriegt oder froh in die leere Stube lächelt.‘ […] Dazu ist [Mehrings Lyrik] zu artifiziell, zu intellektuell und zu aggressiv.47
Mehring selbst lässt sich nach seiner dadaistisch-avantgardistischen Hochphase Ende des Ersten Weltkriegs dennoch recht schnell in den Unterhaltungsbetrieb der Weimarer Republik integrieren und sieht sich zunehmend in einem Zwiespalt, da das Gelingen seiner Aufführungen genau von der Kultur und Gesellschaft abhängt, die er in seinen Texten kritisiert:
Die Grundproblematik jedes Satirikers, abhängig zu sein von der Gesellschaft, die er bekämpft, nahm für Mehring tragische Formen an. Trotzdem: Freunde und Verleger, die sich um ihn bemühten, stieß er immer wieder mit absurden Unterstellungen vor den Kopf, bis sie sich schließlich von ihm abwandten. So fand er in die Gesellschaft, deren Besserung er ja eigentlich nur wünschte, nicht mehr zurück.48
Ende der zwanziger, v. a. aber Anfang der dreißiger Jahre wirkt sich die zunehmende gesellschaftliche und politische Polarisierung auch auf die Rezeption der Texte Mehrings aus, der sich mittlerweile schon dem Theater zugewandt hatte. In einer Zeit, die von dem Erstarken reaktionärer linker und rechter Kräfte geprägt ist, sieht sich ein Walter Mehring, der zugleich nationalistische wie auch bürgerliche Kräfte aufs Schärfste kritisiert, für den allerdings auch ein Eintritt in kommunistische Organisationen nicht infrage kommt, zunehmend alleine dastehen: Diejenigen, „denen eine Identifikation mit einem politisch organisierten Kollektiv nicht möglich war, die vielmehr nur einen extremen Individualismus, oftmals ‚mit anarchischen Zügen‘, als letzte Rückzugsoption kannten“, konnten wenig „auf öffentliche Wirkung und Resonanz rechnen“.49 Von den Nationalsozialisten und Teilen des Bürgertums werden seine Texte in sehr einseitiger und voreingenommener Weise verteufelt und als Ausdruck der Wut des Dichters auf alles Religiöse und Deutsche gesehen.50 Auch in einer Nachkriegszeit, die v. a. anfänglich „mit sturem Blick nach vorn die jüngste Vergangenheit verdrängt“51, geht seine Lyrik zunehmend unter.
6. Fazit
Der Querschnitt durch das lyrische Werk Walter Mehrings kann aufgrund der Fülle und Vielfalt seiner Texte selbstverständlich nur ein Abriss bleiben – v. a. die Darstellung der Großstadt und die Verwendung von Tiersymbolik gerade in seinen späteren Texten sollte in weiteren Untersuchungen ebenfalls in den Blick gerückt werden. Es hat sich allerdings gezeigt, dass Mehring wie nur wenige andere Dichter seiner Zeit die Bedeutung und Macht, die von der Sprache ausgeht, nicht nur erkannte, sondern sich in vielfältiger Weise auch zu Nutzen machte. Sein Gedicht verlangt einen aktiven Leser, der bereit ist, seinen eigenen Erfahrungshorizont zu erweitern und der Eindrücke nicht nur auf sich einprasseln lässt, sondern Sprache, eigenes Denken und Handeln reflektieren und hinterfragen kann. Mehring bedient sich vielerlei Techniken und Formen, wobei nicht unbedingt das sprachliche Rohmaterial selbst, sondern vielmehr dessen spielerisch-künstlerische An- und Einordnung in neue Kontexte den Verfremdungseffekt bewirkt und den Leser zum Nachdenken anregen soll. In der radikalen dadaistisch-avantgardistischen Spracherneuerung, die v. a. seine frühe Lyrik prägt und auch in der Montagetechnik ihren Ausdruck findet, spiegelt sich Mehrings Bruch mit traditionellen Konventionen nach den Schrecken des Ersten Weltkrieges wider. Dabei drückt der Dichter mit seiner Sprache nicht zuletzt auch die Orientierungslosigkeit und Unsicherheiten seiner Zeit sowie den wackligen Boden, auf dem die Weimarer Republik sich befand, mit seinem genauso ‚wackligen‘ Sprachgerüst aus. Die Form der Montage, die Kombination verschiedenartigen Sprachmaterials zu einem unharmonischen Ganzen in einem verfremdeten Kontext, in dem das einzelne Element im Gesamteindruck jedoch nicht untergeht, spiegelt das Lebensgefühl des Großstadtmenschen der zwanziger Jahre wider, der sich ununterbrochen neuen Eindrücken aus Unterhaltungskultur, Medien und Politik ausgesetzt sieht. Auch mit einem schwingenden, unregelmäßigen, vorwärtstreibenden Rhythmus, der von der die Unterhaltungskultur Amerikas und Europas wesentlich beeinflussenden musikalischen Stilrichtung des Jazz geprägt ist, erreicht der Dichter ein schnelles Tempo, das von der Unberechenbarkeit, Fragilität und Schnelligkeit seiner Zeit zeugt. Mehring sendet in seiner Lyrik politische Botschaften an sein Publikum, die er oft mit nicht selten parodistischer Intention in traditionelle Formen und Untergattungen packt: So zeugen seine Texte teils von einem Gegeneinanderarbeiten von Inhalt und Form, in der die schlichte, harmonische Form in völligem Gegensatz zur behandelten Thematik des Gedichtes steht. In seinen liturgischen Chansons übt er unter Verwendung von Texten, die biblische Elemente enthalten oder in ihrem formalen Aufbau an kirchliche Gebetstexte angelehnt sind, Kritik an Religion, Machtmissbrauch und dem unkritischen Bürger. Mit seinen Rollengedichten bedient sich Mehring einer schon immer beliebten Gattung und lässt dabei Figurentypen aus verschiedensten gesellschaftlichen Randgruppen auftreten, die aus ihrer Perspektive heraus die moralische Verwerflichkeit, die Mehring in den gesellschaftlichen Zuständen erkennt, in authentischer Weise beschreiben können, wobei die mit ihrem Beruf assoziierten Eigenschaften wichtiger sind als ihre persönlichen Einzelschicksale. Am offensten formuliert Mehring seine Kritik in der Gedichtform der Ballade, hier sind seine Botschaften nun sehr direkt – er verzichtet weitgehend auf sprachliche Verfremdung – und von einem Appell an seine Leser bzw. Hörer, die er zum Handeln aufruft, gekennzeichnet. Dem Refrain lässt Mehring in seinen Texten eine wesentliche Bedeutung zukommen; so reicht schon eine kleine Veränderung im letzten Refrain aus, um weitreichende Veränderungen für das Verständnis der Pointe des Gedichtes zu bewirken. Auch in thematischer Hinsicht sind Mehrings Gedichte sehr vielfältig; im Mittelpunkt steht v. a. die individualistische Perspektive des Dichters, die sich in seiner Kritik am unmündigen, unkritischen, untertänigen Bürger sowie dem Machtmissbrauch von Staat und Kirche widerspiegelt. Auch die Sensationsgier von Presse und Bürger, der Verrat der Sozialdemokraten am Proletariat, das Wüten der Freikorps, das Fortbestehen veralteter gesellschaftlich-politischer Strukturen aus dem Kaiserreich sowie absurder Nationalismus sind Themen, die er in seiner Lyrik aufgreift und parodiert.
7. Literaturverzeichnis
Primärliteratur
Mehring, Walter: Chronik der Lustbarkeiten. Die Gedichte, Lieder und Chansons 1918-1933. Hg. v. Christoph Buchwald. Düsseldorf 1981.
Sekundärliteratur
Adamzig, Eberhard: Der Publizist Walter Mehring in der »Weltbühne«. In: Text + Kritik 78 (1983), S. 11-19.
Bader, Urs: Zeitbilder in den Gedichten Walter Mehrings. In: Text + Kritik 78 (1983), S. 1-10.
Bayerdörfer, Hans-Peter: Weimarer Republik. In: Geschichte der deutschen Lyrik vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Hg. v. Walter Hinderer. Würzburg 22001, S. 439-476.
Boussart, Monique: Die zwei Weltkriege in Walter Mehrings Lyrik. Vom avantgardistischen Cabaret zur Elegie. In: Germanica 28 (2001) [online], S. 1-11. URL: http://germanica.revues.org/2243 (Zugriff am 19.03.2019).
Eggebrecht, Axel: »Mehring war ein liberaler Antichrist«. In: Text + Kritik 78 (1983), S. 56-
64.
Florack, Ruth: Vergessen. Verbraucht? Zu Walter Mehrings ›Gebrauchslyrik‹. In: Text + Kritik 173 (2007), S. 29-41.
Hellberg, Frank: Walter Mehring. Schriftsteller zwischen Kabarett und Avantgarde. Bonn 1983 (Abhandlungen zur Kunst,- Musik- und Literaturwissenschaft, Bd. 337).
Schuhmann, Klaus: Walter Mehring: Teuflische Epiphanien. In: neue deutsche literatur (ndl) 44/507 (1996), S. 90-95.
Stein, Roger: Das deutsche Dirnenlied. Literarisches Kabarett von Bruant bis Brecht. Köln 2006 (Literatur und Leben, Bd. 67).
Strauss, Martin: Deutsche Kabarettlyrik vor 1933. Zürich 1985 (Abhandlung zur Erlangung der Doktorwürde der Philosophischen Fakultät I der Universität Zürich).
[...]
1 Urs Bader: Zeitbilder in den Gedichten Walter Mehrings. In: Text + Kritik 78 (1983), S. 1.
2 Auch Hans-Peter Bayerdörfer stellt eine „zeitliche Parallelität zum Surrealismus“ fest: „Das moderne Gedicht erreicht keinen ästhetischen Status mehr, in dem nicht die Fragwürdigkeit des Ästhetischen mitzudenken, keine Form, für die nicht ein Moment der Gebrochenheit konstitutiv wäre.“ In: Geschichte der deutschen Lyrik vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Hg. v. Walter Hinderer. Würzburg 22001, S. 451 f.
3 Frank Hellberg: Walter Mehring. Schriftsteller zwischen Kabarett und Avantgarde. Bonn 1983 (Abhandlungen zur Kunst,- Musik- und Literaturwissenschaft, Bd. 337), S. 267.
4 Vgl. Bayerdörfer 2001, S. 439 u. 453.
5 Ebd., S. 457.
6 Ebd., S. 456.
7 Ebd., S. 457.
8 Hellberg 1983, S. 29.
9 Die Vortragssituation blieb dabei auch oft fiktiv.
10 Hellberg 1983, S. 53.
11 Vgl. Martin Strauss: Deutsche Kabarettlyrik vor 1933. Zürich 1985 (Abhandlung zur Erlangung der Doktorwürde der Philosophischen Fakultät I der Universität Zürich), S. 157.
12 Hier und im Folgenden mit Versangabe unter Verwendung der Sigle CdL nach der Ausgabe von Christoph Buchwald zitiert (Chronik der Lustbarkeiten. Die Gedichte, Lieder und Chansons 1918-1933. Hg. v. Christoph Buchwald. Düsseldorf 1981). Alle Fettmarkierungen sind Hervorhebungen des Verfassers.
13 Vgl. hierzu bzw. zu „Achtung Gleisdreieck“: Hellberg 1983, S. 108.
14 Hellberg 1983, S. 78 f.
15 Vgl. ebd., S. 58.
16 Ebd., S. 68. Ähnlich auch Bayerdörfer 2001, S. 454: „Schon Ernst Bloch hat in der Montage, nicht in der Sachlichkeit, die eigentliche künstlerische Folge des Wertrelativismus gesehen, da diese mit den Einzelelementen, die aus dem Zerfall des Kosmos hervorgehen, im Modus der Möglichkeit umgehe, statt wie die Sachlichkeit die starre Fassade einer Ganzheit und Einheit auszubilden.“ Frank Hellberg bemerkt zudem, dass Mehring mit diesem Anspruch weitaus weniger konsequent verfuhr als andere bekannte Dadaisten wie Kurt Schwitters, d. h., dass sich auch manche seiner Dada-Gedichte nicht völlig einer Sinndeutung entzogen (vgl. Hellberg 1983, S. 68). Dies wird sich auch im Gedicht „Wenn der Westen aber ein Loch hat…“ zeigen, in dem zumindest eine gewisse Ausgangssituation grob erkennbar ist, allerdings dennoch kein harmonischer Gesamteindruck entsteht.
17 Hellberg 1983, S. 82.
18 Vgl. ebd.
19 Vgl. ebd., S. 80 f.
20 Monique Boussart: Die zwei Weltkriege in Walter Mehrings Lyrik. Vom avantgardistischen Cabaret zur Elegie. In: Germanica 28 (2001) [online], S. 6. URL: http://germanica.revues.org/2243 (Zugriff am 19.03.2019).
21 Vgl. Hellberg 1983, S. 82.
22 Ebd., S. 80.
23 Hellberg 1983, S. 91. Vgl. auch S. 87-90 für weitere Analyseansätze zum Gedicht „Salto Mortale“.
24 Vgl. ebd., S. 96.
25 Abgesehen von einem unreinen Reim in „verkünd’gen“ – „München“ (Vs. 19 f.) und „Hülsen“ – „Wilson“ (Vs. 25 f.).
26 Bader 1983, S. 3.
27 Vgl. Hellberg 1983, S. 97.
28 Vgl. Florack 2007, S. 37.
29 Hellberg 1983, S. 99.
30 Ebd., S. 98.
31 Vgl. Stein 2006, S. 355.
32 Vgl. Bayerdörfer 2001, S. 452.
33 Strauss 1985, S. 173.
34 Vgl. Hellberg 1983, S. 117.
35 Stein 2006, S. 369.
36 Vgl. Florack 2005, S. 35. Hierzu auch Hellberg 1983, S. 35 f.: Die „Einheit von Wort, Musik und Bild“ sowie die Tatsache, dass das „Publikum […] visuell und akustisch angesprochen w[ird]“, verbinden Bänkelsang und Kabarettchanson miteinander. Von der Kommunikationssituation her sind beide Formen vergleichbar: „Auch das literarische Chanson setzt neben der Musik und dem Text die Gestik des Sängers ein, die natürlich wesentlich flexibler, variationsreicher und ausdrucksvoller ist.“
37 Strauss 1985, S. 154.
38 Ebd., S. 155.
39 Bader 1983, S. 2.
40 Zu weiteren Interpretationsansätzen zur Bedeutung der „Unschuldsphäre“ vgl. Stein 2006, S. 359.
41 Hellberg 1983, S. 141.
42 Ebd.
43 Vgl. ebd., S. 142.
44 Vgl. Axel Eggebrecht: »Mehring war ein liberaler Antichrist«. In: Text + Kritik 78 (1983), S. 61.
45 Vgl. Bader 1983, S. 10.
46 Bayerdörfer 2001, S. 449.
47 Florack 2007, S. 37.
48 Bader 1983, S. 8.
49 Bayerdörfer 2001, S. 467.
50 Vgl. Bader 1983, S. 10.
51 Hellberg 1983, S. 16.
- Arbeit zitieren
- Julian Tomic (Autor:in), 2019, Sprache, Techniken und Themen in der Lyrik Walter Mehrings (1896-1981) zur Zeit der Weimarer Republik, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1601839