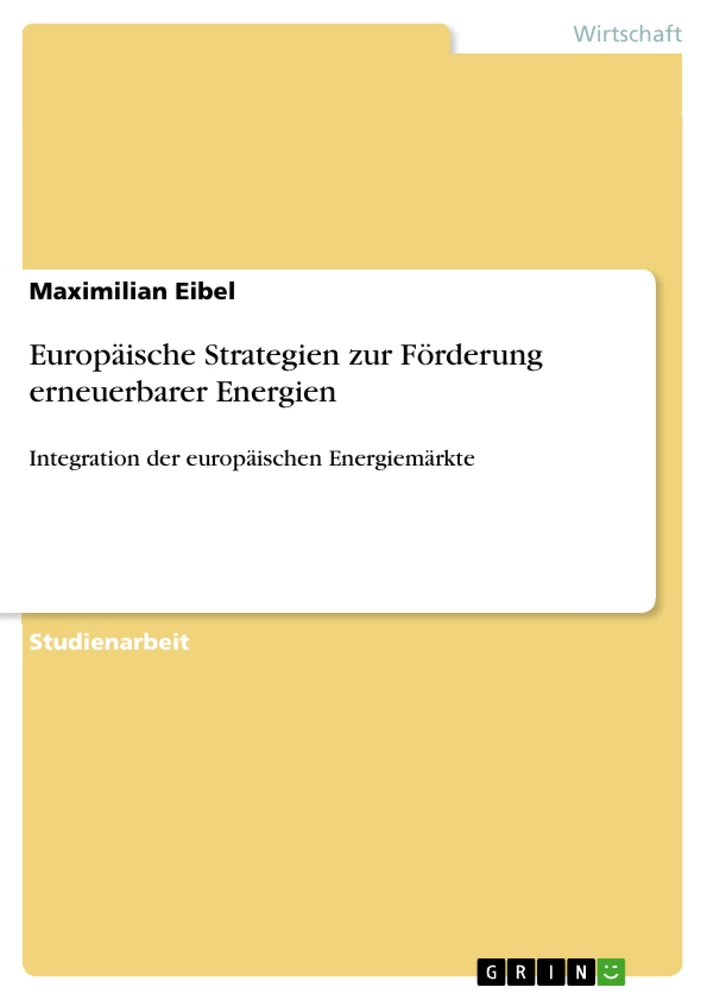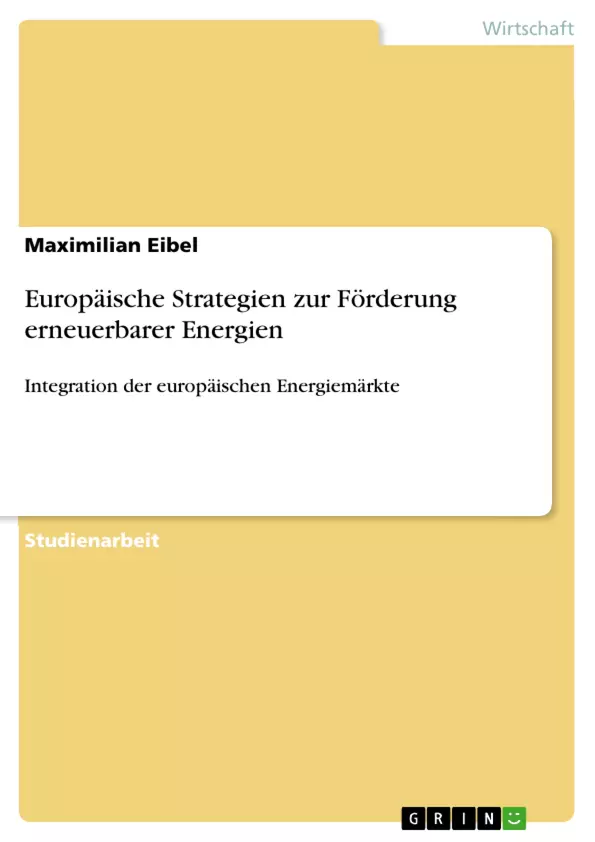Mit dem Ausbau und der Weiterentwicklung regenerativer Energien eröffnen sich der EU eine Vielzahl volkswirtschaftliche Vorteile.
Schon heute ist Europa in der Entwicklung neuer Technologien führend und arbeitet auf die Verwirklichung selbstgesteckter Ziele hin. Die EU strebt einen Anteil erneuerbarer Energien von 20 % bis zum Jahr 2020 an. Trotz gemeinsamer Bemühungen ist die Erfüllung dieses Ziels fraglich, da es an einheitlichen Maßnahmen mangelt.
In dieser Hausarbeit geben wir einen Einblick in die verschiedenen Ansätze, Umsetzungen und Ergebnisse zur Förderung erneuerbarer Energien in der Europäischen Union.
Im Mittelpunkt stehen hierbei die Untersuchung der jeweiligen Instrumente und ihrer Ausführungen auf ihre Anreizkompatibilität. Einführend beschäftigen wir uns exemplarisch mit dem Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (EEG) von 2000 als Beispiel nationalen Rechts. Das EEG ist insofern von Interesse, als es nationale Bestrebungen und europäische Zielsetzungen miteinander verbindet. Zum Zeitpunkt seines Entstehens verkörperte es rein nationales Recht, erst seit 2004 stellt es europäisches Recht dar.
Anschließend vergleichen wir die konventionellen Energieträger mit den erst relativ neuen regenerativen Energien. Hierbei legen wir besonderes Augenmerk auf die staatlichen Fördermaßnahmen, welche enorme Unterschiede zwischen den verschiedenen Energieträgern aufweisen. Nach dem Vergleich der verschiedenen Energieträger wenden wir uns der direkten Förderung erneuerbarer Energien zu. Hierfür stellen wir die Subventionsgrundmodelle, welche aus dem Einspeisungs-, dem Quoten- und dem Ausschreibungsmodell besteht, vor. Anschließend folgt eine Beurteilung dieser Subventionsregime in Bezug auf ihre ökonomischen Konsequenzen.
Abschließend beschäftigen wir uns noch mit dem europäischen Emissionshandelssystem, dass die Reduzierung von Treibhausgasen vorsieht, indem es eine bestimmte Obergrenze für den Ausstoß festlegt. Der Emissionshandel ist als indirekte Fördermaßnahme der erneuerbaren Energien zu verstehen, da bei der Erzeugung von Strom durch fossile Energieträger nun erstmals auch die externen Kosten mit einbezogen werden. Der Ablauf dieses Systems und auch seine Konsequenzen für den Endverbraucher sollen hier dargestellt werden.
Ob es Europa, auch mit Blick auf die globale Erwärmung, schaffen wird eine Energiewende einzuleiten, hängt in größtem Maße an der Effizienz seiner Fördermaßnahmen ab.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (EEG)
- Das EEG als nationale Umsetzung bestehenden europäischen Rechts
- Perspektiven und Roll-Back auf die europäische Ebene
- Forschungsförderungen fossiler und erneuerbaren Energien
- Formen der Förderungen in Europa
- Einspeisemodelle
- Quotenmodelle
- Förderung in Europa
- Vergleich der Regime
- Mitteilungen der Kommission vom 27.10.2004
- Europäischer Emissionshandel – indirekte Förderung erneuerbarer Energien
- Theorie des Emissionshandels
- Funktion und Ablauf des europäischen Emissionshandelsystem
- Folgen für die Verbraucher am Beispiel der „, Windfall Profits”
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Förderung erneuerbarer Energien in der Europäischen Union. Sie untersucht die verschiedenen Ansätze, Umsetzungen und Ergebnisse und analysiert die Anreizkompatibilität der eingesetzten Instrumente.
- Das Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (EEG) als Beispiel nationaler Rechtsvorschriften
- Vergleich der Fördermaßnahmen für konventionelle und regenerative Energieträger
- Direkte Förderung erneuerbarer Energien durch Subventionsmodelle (Einspeisung, Quoten, Ausschreibungen)
- Der europäische Emissionshandel als indirekte Fördermaßnahme
- Die Effizienz der Fördermaßnahmen im Hinblick auf die Energiewende
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Ausgangssituation der europäischen Energieversorgung dar und verdeutlicht die Notwendigkeit der Förderung erneuerbarer Energien. Das Kapitel über das EEG beschreibt die Entwicklung und Inhalte des Gesetzes, welches als Beispiel für nationale Umsetzung europäischer Rechtsvorschriften dient. Im Anschluss werden konventionelle und regenerative Energieträger verglichen, wobei ein Schwerpunkt auf staatliche Fördermaßnahmen liegt.
Das Kapitel über Formen der Förderung in Europa befasst sich mit den Subventionsgrundmodellen für erneuerbare Energien, wie Einspeisemodellen, Quotenmodellen und Ausschreibungen. Die ökonomischen Konsequenzen dieser Modelle werden analysiert. Abschließend wird das europäische Emissionshandelssystem als indirekte Fördermaßnahme der erneuerbaren Energien dargestellt, einschließlich seiner Funktionsweise und Folgen für den Endverbraucher.
Schlüsselwörter
Erneuerbare Energien, Europäische Union, Energiepolitik, EEG, Förderung, Subventionen, Emissionshandel, Anreizkompatibilität, Energiewende
Häufig gestellte Fragen
Welches Ziel verfolgt die EU beim Ausbau erneuerbarer Energien?
Die EU strebte (zum Zeitpunkt der Arbeit) einen Anteil von 20 % erneuerbarer Energien bis zum Jahr 2020 an, um volkswirtschaftliche Vorteile zu sichern und das Klima zu schützen.
Was ist das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)?
Das EEG ist ein deutsches Gesetz zur Förderung von Ökostrom. Es garantiert Erzeugern feste Einspeisevergütungen und Vorrang bei der Netzeinspeisung und dient als Vorbild für europäisches Recht.
Welche Subventionsmodelle gibt es in Europa?
Man unterscheidet primär zwischen Einspeisemodellen (feste Vergütung), Quotenmodellen (verpflichtende Anteile) und Ausschreibungsmodellen (Wettbewerb um Förderhöhe).
Wie funktioniert der europäische Emissionshandel?
Es wird eine Obergrenze für Treibhausgase festgelegt. Unternehmen müssen für ihren Ausstoß Zertifikate erwerben. Dies verteuert fossile Energien und fördert indirekt regenerative Alternativen.
Was sind „Windfall Profits“?
Zufallsgewinne, die entstehen, wenn Energieunternehmen die Kosten für (gratis erhaltene) Emissionszertifikate an die Endverbraucher weitergeben, ohne dass ihnen tatsächliche Kosten entstanden sind.
- Citation du texte
- Maximilian Eibel (Auteur), 2008, Europäische Strategien zur Förderung erneuerbarer Energien , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/160200