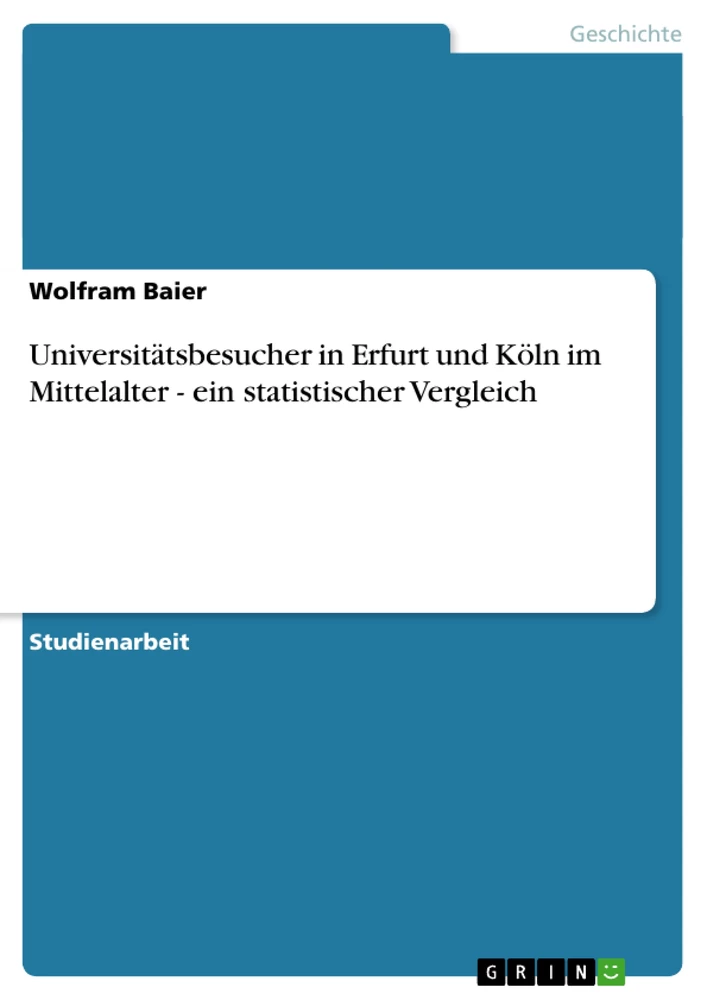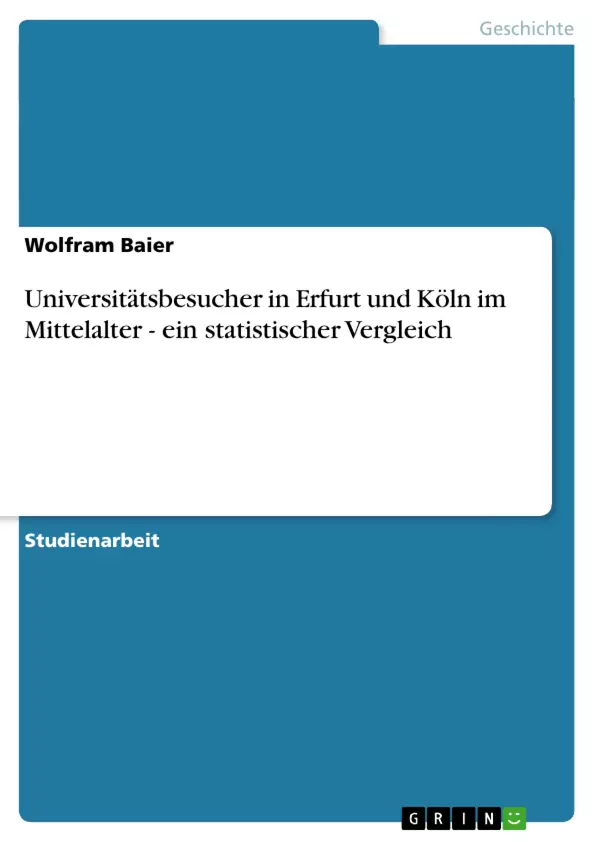„Die Frequenz einer Universität ist das getreue Spiegelbild ihrer historischen Entwicklung. (...) Demzufolge bildet die Frequenz eine der Hauptgrundlagen, auf der jede Untersuchung aufbauen muß, die sich die Erforschung irgendeiner Universitätsgeschichte zum Ziele gesetzt hat.“
Mit diesen Worten leitet Horst Rudolf Abe, Erfurter Universitätshistoriker, seine Frequenzuntersuchung des Universitätsbesuchs der mittelalterlichen Hochschule Erfurt ein. Sein Zahlenmaterial werde ich nur am Rande verwenden, da er nicht alle Hochschulen des Reiches miteinbezieht. Die neueren und umfassenderen Ergebnisse und Daten von Rainer Christoph Schwinges bilden die Grundlage dieser Arbeit. Auf das Zahlenmaterial von Eulenburg, der zum Ende des 19. Jh. die erste umfassende Frequenzuntersuchung vornahm, wird verzichtet, weil Schwinges aufgrund elektronischer Datenverarbeitung die genaueren Daten vorweist.
Die wichtigsten und vollständigsten Quellen, um den Universitätsbesuch zu ermitteln, sind die Rektoratsmatrikeln. Die Immatrikulation oder auch Intitulation der Studenten in Einschreibelisten war ein formaler und konstitutioneller Akt, der vom Rektor vorgenommen wurde: nach einem Eid, der sich dem sozialen Status des Besuchers anpaßte, erfolgte die Gebührenzahlung (intitulatura) und die namentliche Eintragung in das Matrikelbuch (matricula, album oder registrum).
Für Köln und Erfurt sind glücklicherweise diese Allgemeinen Matrikeln überliefert und ediert. Doch ist ein kritischer Umgang mit diesen Quellen nötig, da Schreiber die Namen ungenau, mal verschieden oder gar nicht notierten; auch sind Diener, Würdenträger oder Familienangehörige eingetragen worden, so daß es schwierig ist, die exakte Zahl der Studenten, ihre soziale oder räumliche Herkunft zu erfassen.
Ein Ziel dieser Arbeit ist, das vorhandene Zahlenmaterial zu den mittelalterlichen Universitäten Köln, gegründet 1388, und Erfurt, gegründet 1392, zu sammeln und die Frequenzen vergleichend gegenüberzustellen. Das alleine ist aber sicherlich nicht ausreichend, denn die frequentielle Intensität von Hochschulen ist ein Gradmesser ihrer jeweiligen Bedeutung, demzufolge muß „auch der geistige Aktionsradius dieser Universitäten entsprechend unterschiedlich genannt werden“ (Abe). Das andere Ziel lautet daher, die Immatrikulationszahlen auf wirtschaftliche, soziale, politische und geographische Aspekte im Umfeld der Universitäten zu beziehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Universitätsstädte Erfurt und Köln
- Die Universitätsbesucher in Köln und Erfurt
- Die Immatrikulationsfrequenzen
- Interpretation der Frequenzen und konjunkturelle Prozesse
- Köln und Erfurt im Kontext der Reichsfrequenz
- Räumliche Herkunft der Erfurter und Kölner Studenten
- Schluß
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit hat das Ziel, die Universitätsbesucher der mittelalterlichen Hochschulen Köln und Erfurt anhand der Immatrikulationszahlen zu vergleichen und zu analysieren. Dabei soll die frequentielle Intensität der beiden Hochschulen als Gradmesser ihrer jeweiligen Bedeutung betrachtet werden. Des Weiteren soll die räumliche Herkunft der Studierenden untersucht werden, um Rückschlüsse auf wirtschaftliche, soziale, politische und geographische Aspekte im Umfeld der Universitäten zu ziehen.
- Frequenzunterschiede der Universitäten Köln und Erfurt
- Konjunkturelle Prozesse und ihre Auswirkungen auf die Immatrikulationsfrequenzen
- Räumliche Herkunft der Studenten als Indikator für das Einzugsgebiet der Universitäten
- Vergleich der Frequenzentwicklungen von Köln und Erfurt im Kontext der Reichsuniversitäten
- Bedeutung der beiden Hochschulen im Kontext der geistigen und wirtschaftlichen Entwicklung des Mittelalters
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Frequenzuntersuchung von mittelalterlichen Universitäten ein und erläutert die verwendeten Quellen und Methoden. Kapitel zwei stellt die Universitätsstädte Erfurt und Köln im Kontext ihrer wirtschaftlichen und politischen Bedeutung im späten Mittelalter vor. Kapitel drei analysiert die Immatrikulationsfrequenzen der beiden Hochschulen, interpretiert sie anhand konjunktureller Prozesse und setzt sie in Relation zur Frequenzentwicklung aller Reichsuniversitäten. Schließlich werden in Kapitel vier die Ergebnisse der Arbeiten von Schwinges zum Thema der räumlichen Herkunft der Studenten in Köln und Erfurt verglichen.
Schlüsselwörter
Immatrikulationsfrequenz, Universitätsbesucher, mittelalterliche Hochschule, Köln, Erfurt, Reichsuniversitäten, Studenten, räumliche Herkunft, wirtschaftliche Entwicklung, soziale Entwicklung, politische Entwicklung, geographische Aspekte, konjunkturelle Prozesse, Quellenkritik, Matrikel, Schwinges, Abe.
Häufig gestellte Fragen
Warum sind Rektoratsmatrikeln wichtige Quellen für die Universitätsgeschichte?
Sie dokumentieren formal die Immatrikulation der Studenten und geben Aufschluss über deren Namen, Herkunft und sozialen Status.
Wie unterschieden sich die Gründungsjahre der Universitäten Köln und Erfurt?
Köln wurde 1388 gegründet, während Erfurt im Jahr 1392 folgte.
Welche Probleme gibt es bei der statistischen Auswertung mittelalterlicher Matrikel?
Schreiber notierten Namen oft ungenau oder unvollständig; zudem wurden teilweise auch Diener oder Würdenträger eingetragen, die keine Studenten waren.
Was sagt die „frequentielle Intensität“ über eine Universität aus?
Sie gilt als Gradmesser für die jeweilige Bedeutung und den geistigen Aktionsradius einer Hochschule im Mittelalter.
Wessen Daten bilden die Grundlage für diesen statistischen Vergleich?
Die Arbeit stützt sich primär auf die neueren und umfassenderen Datenbestände von Rainer Christoph Schwinges.
- Quote paper
- Wolfram Baier (Author), 2002, Universitätsbesucher in Erfurt und Köln im Mittelalter - ein statistischer Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/16021