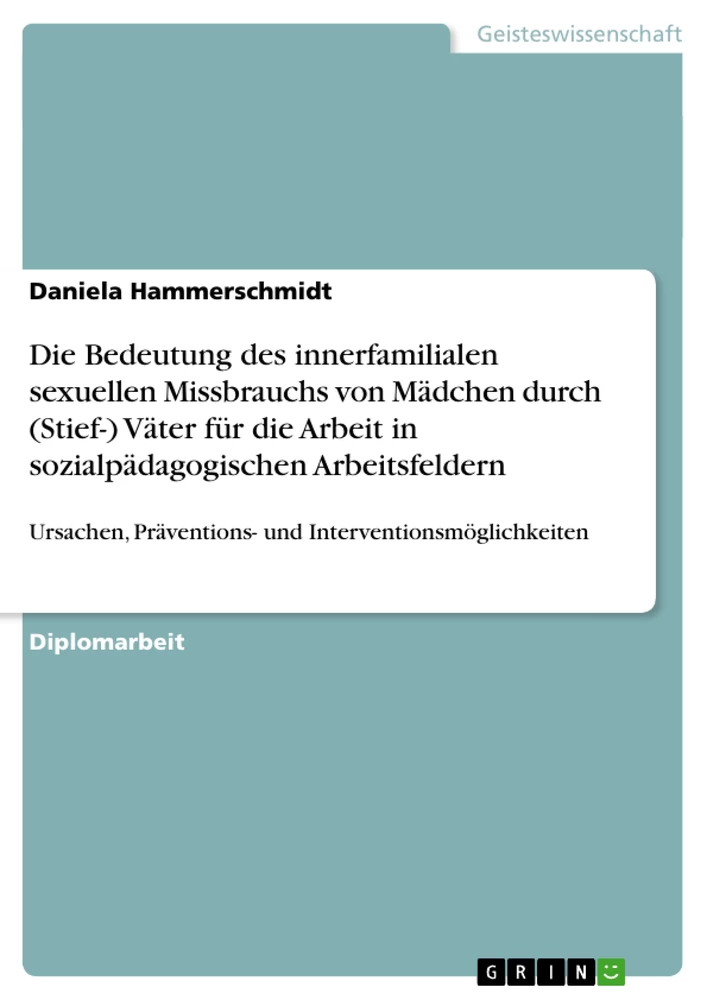Der sexuelle Missbrauch von Kindern ist lange ein Tabuthema gewesen. Erst seit Beginn der 1980er Jahre ist die Problematik infolge der Frauenbewegung und den damit verbundenen Äußerungen betroffener Frauen zunehmend zum Gegenstand
gesellschaftlicher, wissenschaftlicher und politischer Diskussion geworden. Sowohl in der Wissenschaft als auch in der Gesellschaft setzt sich seither auf Basis zahlreicher Studien verstärkt die Erkenntnis durch, dass der sexuelle Missbrauch von Kindern insbesondere eine Problematik des sozialen Nahbereichs darstellt; die Täter sind in den meisten Fällen den Kindern nicht fremd, sondern stammen aus deren sozialen und familialen Umfeld.
Doch auch wenn der sexuelle Missbrauch von Kindern in den letzten Jahrzehnten zunehmend in der Öffentlichkeit diskutiert wird, zeigen sich nach wie vor Unsicherheiten im Umgang mit dieser Problematik. Der Verdacht auf Missbrauch stellt das professionelle Helfersystem vor große Herausforderungen. Diese können die Aufdeckung eines
sexuellen Missbrauchs erschweren und somit dazu führen, dass die Hilfe für betroffene Opfer sogar ausbleibt. Eigene Erfahrungen haben bei mir zur Erkenntnis geführt, dass selbst in sozialpädagogischen Arbeitsfeldern bis heute noch nicht von einer völligen
Enttabuisierung im Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch gesprochen werden kann: Mangelndes
Wissen, eigene Ängste und Befürchtungen sowie strukturelle Bedingungen der jeweiligen Institutionen stehen einer Hilfe für die Opfer teilweise entgegen.
Aufgrund dieser Problematik beschäftige ich mich in der vorliegenden Arbeit mit der Bedeutung des sexuellen Missbrauchs von Kindern für die Arbeit in sozialpädagogischen Arbeitsfeldern. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf dem nnerfamilialen sexuellen Missbrauch von Mädchen durch (Stief-)Väter, da gerade der Missbrauch innerhalb familiärer Strukturen für die Opfer mit einem besonders schwer
wiegenden Vertrauensverlust und mit starken Ambivalenzen dem Täter gegenüber einhergeht. Doch auch für die soziale Arbeit ergeben sich in diesem Zusammenhang besondere Herausforderungen. Die Konzentration des Themas auf den sexuellen Missbrauch von Mädchen durch deren (Stief-)Väter soll keineswegs die Bedeutung von Jungen als Opfer oder Frauen als Täterinnen negieren; diese Schwerpunktsetzung dient vielmehr der Eingrenzung des komplexen Themenbereiches.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung in die Problematik des sexuellen Missbrauchs
- Einleitung
- Definition
- Begriffliche Abgrenzung
- Differenzierung der Definitionen hinsichtlich der Bedeutungsreichweite
- Kategorisierungsversuche im Hinblick auf unterschiedliche Blickwinkel und Bedeutungsschwerpunkte
- Gemeinsame Elemente
- Fazit und für die Arbeit relevante Definition
- Ursachen sexuellen Missbrauchs - Erklärungsmodelle
- Traditionelle Erklärungsansätze
- Grundannahmen
- Bewertung und Kritik traditioneller Erklärungsansätze
- Familiendynamische Ansätze
- Grundannahmen
- Bewertung und Kritik familiendynamischer Erklärungsansätze
- Feministisches Ursachenverständnis
- Patriarchale Gesellschaftsstrukturen, Geschlechtsrollen und sexuelle Gewalt
- Bewertung und Kritik des feministischen Ursachenverständnisses
- Modell der vier Voraussetzungen nach David Finkelhor
- Motivation
- Innere Hemmungen
- Äußere Hemmungen
- Widerstand des Kindes
- Schlussfolgerungen und Bewertung
- Drei-Perspektiven-Modell sexueller Gewalt
- Handlungsmotivation und tatbeeinflussende Repräsentationen
- Kosten- Nutzen-Kalkulation
- Tabellarische Übersicht
- Verhältnis zwischen patriarchalischer Gesellschaftsstruktur, Individuum und sexuellem Missbrauch
- Epidemiologie sexuellen Missbrauchs von Kindern
- Inzidenz und Dunkelziffer
- Prävalenz
- Forschungsmethodische Probleme
- Wichtige Prävalenzstudien
- Fazit
- Umstände und Hintergründe sexuellen Missbrauchs von Kindern
- Bekanntschaftsgrad zwischen Opfern und Tätern
- Dauer bei innerfamilialem und außerfamilialem sexuellen Missbrauch
- Art der sexuellen Übergriffe
- Alter der Opfer
- Soziale Hintergründe
- Schichtzugehörigkeit
- Elterliche Bildung
- Regionale Herkunft
- Familiäre Hintergründe
- Regeln und Einstellungen innerhalb der Familie
- Täterstrategien
- Kontaktaufnahme und Auswahl der Opfer
- Emotionale Zuwendung und körperliche Gewalt
- Strategien der sexuellen Annährung
- Täuschung der Wahrnehmung des Opfers
- Sexueller Missbrauch als Geheimnis
- Isolation und Schuldzuweisung
- Psychodynamik des Opfers
- Vertrauensverlust
- Sprachlosigkeit
- Schuld- und Schamgefühle
- Angst und Ohnmacht
- Die Beziehung zur Mutter - Ein Exkurs ins mütterliche Erleben innerfamilialen sexuellen Missbrauchs
- Konfrontation mit dem Missbrauch
- Soziale und ökonomische Konsequenzen
- Wahrnehmung des Missbrauchs
- Eigene Gewalt- und Missbrauchserfahrungen
- Beziehung zwischen Opfer und Mutter
- Erwartungen an die Mütter
- Beziehung zwischen Opfer und Geschwistern
- Intervention bei sexuellem Missbrauch
- Voraussetzungen zur Intervention
- Leitlinien und Vorgehen
- Umgang mit dem betroffenen Kind
- Das Gespräch mit dem Kind
- Fazit
- Prävention
- Ebenen der Prävention
- Konsequenzen bisheriger Überlegungen für die Präventionsarbeit
- Ursachen sexuellen Missbrauchs von Kindern
- Risikofaktoren
- Zielgruppen und Zielrichtungen
- Präventionsarbeit mit Kindern
- Wandel der Präventionskonzepte
- Vorbedingungen präventiver Arbeit mit Kindern
- Zentrale Themenbereiche und Ziele präventiver Arbeit
- Sexualerziehung und Thematisierung des Missbrauchs
- Wirksamkeit der Prävention
- Ergebnisse der Evaluationsstudien von Präventionsprojekten mit Kindern Tabellarische Übersicht
- Meta-Analyse
- Zusammenfassung der Evaluationsergebnisse zur Wirksamkeit der Prävention mit Kindern
- Ausblick
- Kritik an Präventionsprogrammen mit Kindern
- Präventive Elternbildung
- Grundlagen der Elternbildung
- Inhalte und Ziele der Elternbildung
- Strukturelle und institutionelle Anforderungen
- Täterprävention
- Inhalte und Ziele der Täterprävention
- Perspektiven der Prävention
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Bedeutung des innerfamilialen sexuellen Missbrauchs von Mädchen durch (Stief-)Väter für die Arbeit in sozialpädagogischen Arbeitsfeldern. Ziel der Arbeit ist es, das Thema aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten, die Ursachen des Missbrauchs zu analysieren und Präventions- sowie Interventionsmöglichkeiten aufzuzeigen.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs "sexueller Missbrauch"
- Analyse verschiedener Erklärungsmodelle für sexuellen Missbrauch
- Epidemiologie sexuellen Missbrauchs von Kindern, insbesondere die Prävalenz und Inzidenz
- Umstände und Hintergründe des sexuellen Missbrauchs von Kindern
- Psychodynamik des Opfers und die Auswirkungen des Missbrauchs auf die Entwicklung des Kindes
Zusammenfassung der Kapitel
- Einführung in die Problematik des sexuellen Missbrauchs: Dieses Kapitel behandelt die Definition und Abgrenzung des Begriffs "sexueller Missbrauch" und diskutiert verschiedene Kategorisierungsversuche sowie relevante Definitionen für die Arbeit mit betroffenen Kindern und Familien.
- Ursachen sexuellen Missbrauchs - Erklärungsmodelle: Hier werden verschiedene Erklärungsmodelle für sexuellen Missbrauch vorgestellt, darunter traditionelle Erklärungsansätze, familiendynamische Ansätze, das feministische Ursachenverständnis sowie das Modell der vier Voraussetzungen nach David Finkelhor. Zudem wird das Drei-Perspektiven-Modell sexueller Gewalt diskutiert.
- Epidemiologie sexuellen Missbrauchs von Kindern: Dieses Kapitel befasst sich mit der Inzidenz und Dunkelziffer sowie der Prävalenz sexuellen Missbrauchs von Kindern. Es werden relevante Forschungsmethodische Probleme und Prävalenzstudien beleuchtet.
- Umstände und Hintergründe sexuellen Missbrauchs von Kindern: Hier werden die Umstände und Hintergründe des sexuellen Missbrauchs von Kindern im Detail untersucht, insbesondere der Bekanntschaftsgrad zwischen Opfern und Tätern, die Dauer des Missbrauchs, die Art der sexuellen Übergriffe, das Alter der Opfer und die sozialen sowie familiären Hintergründe.
- Täterstrategien: Dieses Kapitel befasst sich mit den Strategien von Tätern, wie sie Kontakt zu ihren Opfern aufnehmen, emotionale Zuwendung und Gewalt einsetzen, die Wahrnehmung der Opfer täuschen und den Missbrauch geheim halten.
- Psychodynamik des Opfers: In diesem Kapitel werden die psychischen Auswirkungen des sexuellen Missbrauchs auf das Opfer beschrieben, darunter Vertrauensverlust, Sprachlosigkeit, Schuld- und Schamgefühle, Angst und Ohnmacht. Zudem wird die Beziehung zwischen Opfer und Mutter sowie Opfer und Geschwistern beleuchtet.
- Intervention bei sexuellem Missbrauch: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den Voraussetzungen, Leitlinien und dem Vorgehen bei Interventionen im Falle von sexuellem Missbrauch. Der Umgang mit dem betroffenen Kind und das Gespräch mit dem Kind werden detailliert dargestellt.
- Prävention: Das letzte Kapitel widmet sich der Präventionsarbeit im Bereich des sexuellen Missbrauchs von Kindern. Es werden verschiedene Ebenen der Prävention, die Ursachen des Missbrauchs, Risikofaktoren und Zielgruppen sowie die Wirksamkeit der Prävention diskutiert. Zudem werden die Themenfelder der Präventionsarbeit mit Kindern, präventive Elternbildung und Täterprävention behandelt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themen sexueller Missbrauch, innerfamiliale Gewalt, Prävention, Intervention, Kinder, Familie, Täter, Opfer, Psychodynamik, Trauma, Sozialpädagogik, pädagogische Arbeit, Geschlechterrollen, patriarchale Strukturen.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist innerfamilialer sexueller Missbrauch so schwer aufzudecken?
Missbrauch im sozialen Nahbereich ist oft mit einem starken Vertrauensverlust und Ambivalenzen gegenüber dem Täter verbunden. Mangelndes Wissen und Ängste im Helfersystem erschweren die Aufdeckung zusätzlich.
Was sind die vier Voraussetzungen nach David Finkelhor?
Finkelhors Modell nennt: 1. Motivation des Täters, 2. Überwindung innerer Hemmungen, 3. Überwindung äußerer Hemmungen und 4. Überwindung des Widerstands des Kindes.
Welche Strategien nutzen Täter beim Missbrauch?
Täter nutzen oft emotionale Zuwendung, Täuschung der Wahrnehmung des Opfers, Isolation und die Stilisierung des Missbrauchs als gemeinsames "Geheimnis".
Wie wirkt sich Missbrauch auf die Psychodynamik des Opfers aus?
Typische Folgen sind Sprachlosigkeit, massive Schuld- und Schamgefühle, Ohnmachtserfahrungen sowie ein tiefgreifender Verlust des Urvertrauens.
Was ist das Ziel der Präventionsarbeit mit Kindern?
Prävention zielt darauf ab, die emotionale Kompetenz von Kindern zu stärken, sie über ihre Rechte aufzuklären und ihnen zu vermitteln, dass sie "Nein" sagen dürfen und Hilfe erhalten.
- Quote paper
- Daniela Hammerschmidt (Author), 2010, Die Bedeutung des innerfamilialen sexuellen Missbrauchs von Mädchen durch (Stief-) Väter für die Arbeit in sozialpädagogischen Arbeitsfeldern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/160229