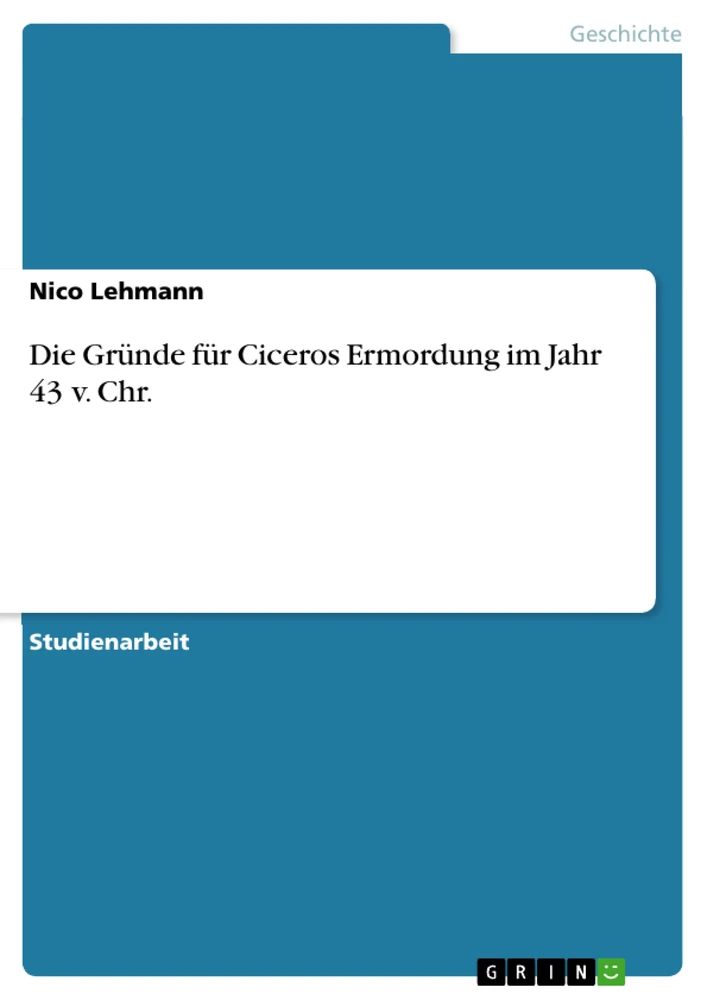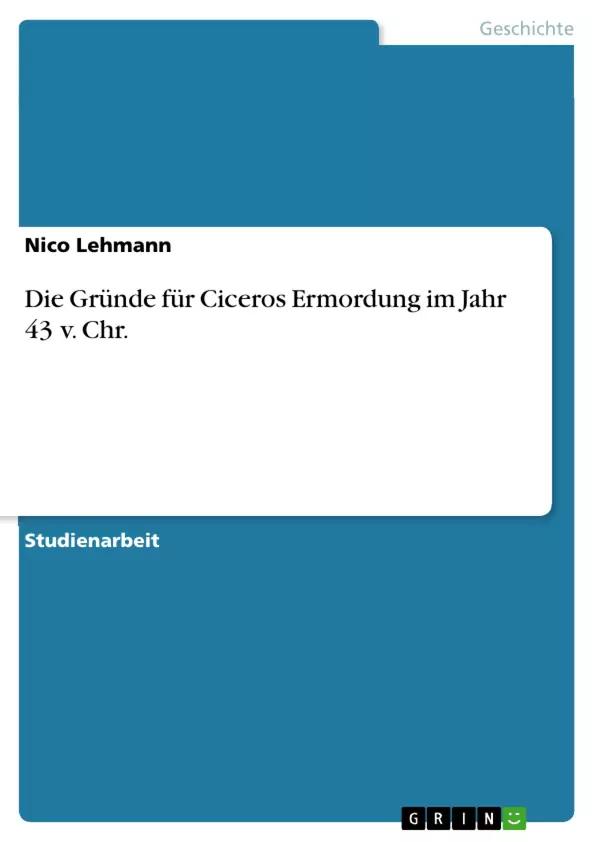Nach der Ermordung Caesars an den Iden des März 44 v. Chr. entstand im Römischen Reich gewissermaßen ein Machtvakuum. Die uralten republikanischen Strukturen und die Vorherrschaft der Nobilität waren von Caesar gebrochen. Er vereinte als dictator die Machtelemente des Staates in seiner Hand. Nach dem Tod des erbitterten Feindes Ciceros rangen entschiedene Verfechter der Republik, wie M. Brutus oder C. Cassius, gegen die caesarianische Partei, die sich zunächst uneins war. Um die Republikaner jedoch besiegen zu können, vereinten sich die einflussreichsten von ihnen, namentlich M. Antonius, M. Lepidus und C. Octavius, der spätere Kaiser Augustus, zum zweiten Triumvirat.
Als die römische Republik in den letzten Atemzügen lag betrat auch Cicero aus der vita contemplativa heraus wieder die politische Bühne. Zunächst unterstützte er Mark Anton, von dem er sich aber nach einigen symbolischen Bekenntnissen von diesem zu Caesar und spätestens nach seinem Einmarsch in Italien entfremdete. Der Kampf wurde von Cicero erbittert geführt. In Zeiten, in denen insbesondere die Gunst der Veteranen Caesars ein entscheidendes Kriterium der Macht darstellte, sparte er kaum mit schmählicher Agitation gegen Mark Anton.
Scheinbar paradox wechselte Cicero die Fronten und protegierte Caesars testamentarischen Erben, C. Octavius oder später Octavian. Ihn glaubte er für die Sache der Republik einspannen zu können, auch sah er in ihm die einzige Chance, Mark Anton in Italien eine schlagkräftige Truppe entgegenzusetzen- Brutus und Cassius waren im Osten gebunden. Octavian jedoch war nicht der beeinflussbare Jüngling, für den ihn Cicero hielt. Diese dramatische Fehleinschätzung zeigte sich rasch. Zwar kämpfte er bei Mutina unter dem Banner der Republik gegen Antonius, das Kräftegleichgewicht der Heere des Lepidus, Antonius und Octavian ließ die drei jedoch einen Pakt- das zweite Triumvirat- schließen. Eine der wichtigsten Programmpunkte dieser quasi Militärdiktatur war das Ausschreiben von Proskriptionen. Sie dienten der Aufbesserung der Finanzen der Triumvirn und mindestens im selben Maße der Ausschaltung von politischen Gegnern. Auch Cicero fiel diesem Morden zum Opfer. Trotz dass er sich bis zuletzt aufopferungsvoll vor dem machtlosen Senat für Octavian verbürgte, war er auf einer Geheimliste derer verzeichnet, die noch vor Ausstellung der offiziellen Listen zu töten war.
Die Motive für Ciceros Proskribieren, von allen 3 Triumvirn ausgehend, versucht die vorliegende Arbeit zu klären
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Offizieller, präventiver und symbolischer Aspekt
- Persönliche Motive des M. Antonius und M. Aemilius Lepidus
- Persönliche Motive Octavians
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Motive der römischen Triumvirn für die Ermordung Ciceros im Jahr 43 v. Chr. und stellt die Frage, ob Ciceros Tod eher eine Konsensentscheidung der Triumvirn oder ein Alleingang von Mark Anton war.
- Analyse der offiziellen Gründe für die Proskriptionen, wie sie in den Quellen überliefert sind
- Untersuchung der persönlichen Motive von Antonius, Lepidus und Octavian
- Besondere Berücksichtigung der Rolle Octavians
- Bewertung der Bedeutung von Ciceros Ermordung für die römische Republik
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung skizziert den historischen Kontext und die Situation nach Caesars Ermordung. Die Bildung des Triumvirats und die Herausforderungen, denen sich die Triumvirn gegenüber sahen, werden vorgestellt. Die Ermordung Ciceros im Zuge der Proskriptionen wird als zentrale Zäsur des römischen Staates beschrieben.
Hauptteil
Offizieller, präventiver und symbolischer Aspekt
Dieser Abschnitt analysiert die offiziellen Gründe für die Proskriptionen, die von den Triumvirn veröffentlicht wurden. Es wird gezeigt, dass die offiziellen Gründe nicht ausreichen, um die Proskriptionen vollständig zu erklären, da sie die finanziellen und persönlichen Motive der Triumvirn verschleiern.
Persönliche Motive des M. Antonius und M. Aemilius Lepidus
Dieser Abschnitt befasst sich mit den persönlichen Motiven von Antonius und Lepidus. Es wird untersucht, inwieweit persönliche Feindschaften und Rivalitäten eine Rolle bei Ciceros Ermordung spielten.
Persönliche Motive Octavians
Dieser Abschnitt untersucht die Rolle Octavians bei der Proskription. Es wird kritisch hinterfragt, inwieweit Octavian an Ciceros Ermordung beteiligt war und welche Rolle er bei der Entscheidung für die Proskriptionen spielte.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Arbeit sind die Proskriptionen der römischen Triumvirn, die Ermordung Ciceros, die Rolle von Antonius, Lepidus und Octavian, sowie die politische und soziale Situation in der späten römischen Republik. Schlüsselbegriffe sind: Triumvirat, Proskription, politisches Motiv, persönliches Motiv, Symbolkraft, Res Publica.
Häufig gestellte Fragen
Warum wurde Cicero im Jahr 43 v. Chr. ermordet?
Cicero wurde im Zuge der Proskriptionen des zweiten Triumvirats ermordet. Die Triumvirn (Antonius, Octavian, Lepidus) nutzten diese Listen, um politische Gegner auszuschalten und ihre Finanzen aufzubessern.
Welche Rolle spielte Mark Anton bei Ciceros Tod?
Mark Anton war Ciceros erbittertster Feind. Cicero hatte ihn in seinen "Philippischen Reden" scharf angegriffen. Die Ermordung Ciceros war eine zentrale Forderung von Antonius im Pakt des Triumvirats.
Warum schützte Octavian (Augustus) Cicero nicht?
Obwohl Cicero Octavian zuvor protegiert hatte, opferte Octavian ihn dem politischen Bündnis mit Antonius. Dies entlarvte Ciceros Fehleinschätzung, Octavian für die Sache der Republik instrumentalisieren zu können.
Was waren die "Proskriptionen"?
Proskriptionen waren öffentliche Listen von Personen, die für vogelfrei erklärt wurden. Wer auf der Liste stand, durfte getötet werden, und sein Vermögen fiel an den Staat bzw. die Triumvirn.
Welche Bedeutung hatte Ciceros Tod für die Römische Republik?
Sein Tod markiert symbolisch das Ende der freien Republik. Als einer der letzten großen Verteidiger des Senats und der republikanischen Freiheit fiel er der aufkommenden Militärdiktatur zum Opfer.
- Quote paper
- Nico Lehmann (Author), 2010, Die Gründe für Ciceros Ermordung im Jahr 43 v. Chr., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/160241