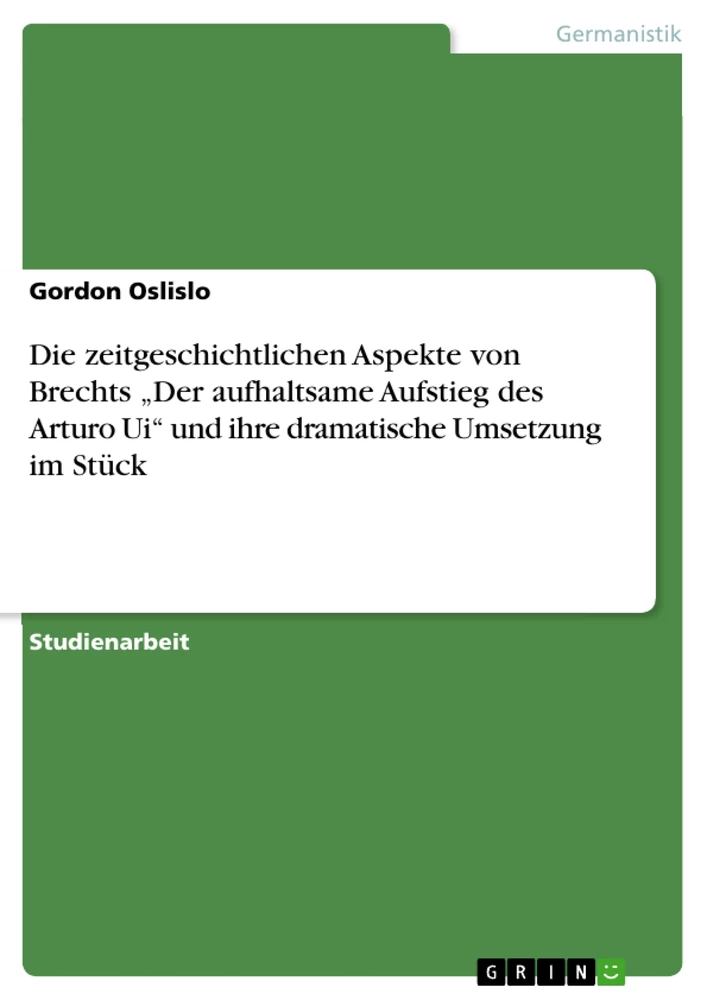„Brecht überspringt die Kluft zwischen Bildungssprache und Alltagssprache, zwischen Literatur und Publikum. Unbekümmert und kalkuliert zugleich. Der Versuch volkstümlich zu schreiben, ist Teil seiner List, die Wahrheit zu verbreiten.“1 Mit dem lange Zeit unbedeutenden, im Schatten bekannterer Werke stehenden, Stück „Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui“ versucht Brecht die nationalsozialistische Zeitgeschichte auf die Bühne zu bringen und für jedermann zugänglich zu machen. Es geht ihm jedoch weniger um die bloße Identifikation mit der Vergangenheit. Vielmehr sollen durch verschiedenste Methoden des epischen Theaters Zuschauer und Leser zum Denken animiert werden. In dieser Arbeit soll nun auf diese Methoden eingegangen werden. Zunächst werden das Stück und seine Entstehung in den historischen Kontext gesetzt und anschließend auf die Umsetzung der zeitgeschichtlichen Aspekte im Werk hin untersucht. Dabei wird die Form der Parabel, der Satire, und die Verfremdung (als Gangstermilieu und Historienfarce) von Bedeutung sein. Im weiteren Verlauf dieser Hausarbeit sollen zwei Textbeispiele die epischen und episierenden Elemente, die Brecht verwendete, und die tatsächliche Einarbeitung der Historie in den Text belegen. Im Schlussteil soll resümiert werden ob und wie es Brecht gelungen ist, die nationalsozialistische Vergangenheit in den UI einzubetten. Darüberhinaus soll auf offene Fragen verwiesen werden und eine kritische Zusammenfassung dessen, was erarbeitet worden ist, erfolgen.
Inhaltsverzeichnis
- Zu Thema und Aufgabenstellung der Arbeit
- Das Stück und seine Entstehung im historischen Kontext
- Parallelen des Stücks zum Gangstermilieu
- Parallelen zur nationalsozialistischen Zeitgeschichte
- Die dramatische Umsetzung der Historie im Stück
- Gangsterhistorie
- Parabel
- Satire
- Satire nach Kurt Tucholsky
- Textbeispiele
- Prolog
- Speicherbrandprozess
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der dramatischen Umsetzung zeitgeschichtlicher Aspekte in Bertolt Brechts Stück „Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui“. Das Werk soll in den historischen Kontext seiner Entstehung eingebettet und auf die Methoden des epischen Theaters untersucht werden, mit denen Brecht die nationalsozialistische Zeitgeschichte auf die Bühne bringt und den Zuschauer zum Denken anregt.
- Parallelen zwischen dem Gangstermilieu der 1930er Jahre und dem Aufstieg des Nationalsozialismus
- Die Rolle der Parabel und Satire in Brechts Stück
- Die Verwendung von Verfremdungseffekten, insbesondere durch das Gangstermilieu und die Historienfarce
- Die Einarbeitung der Historie in den Text anhand von Beispielen
- Die Frage, ob und wie Brecht die nationalsozialistische Vergangenheit in „Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui“ gelungen ist einzubetten
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel widmet sich der Thematik und Aufgabenstellung der Arbeit. Im zweiten Kapitel wird das Stück „Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui“ in seinen historischen Kontext eingeordnet und auf die Parallelen zum Gangstermilieu der 1930er Jahre sowie zum Aufstieg des Nationalsozialismus eingegangen. Das dritte Kapitel analysiert die dramatische Umsetzung der Historie im Stück, wobei insbesondere die Verwendung von Parabel, Satire und Verfremdungseffekten im Fokus steht. Hier werden auch zwei Textbeispiele, der Prolog und der Speicherbrandprozess, genauer betrachtet. Schließlich soll das vierte Kapitel ein Fazit ziehen und offene Fragen und eine kritische Zusammenfassung der erarbeiteten Punkte liefern.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen „Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui“, Bertolt Brecht, episches Theater, Parabel, Satire, Verfremdung, Gangstermilieu, Nationalsozialismus, Zeitgeschichte und Historienfarce. Die Analyse fokussiert auf die dramatische Umsetzung der Historie im Stück und die Verwendung von epischen und episierenden Elementen, um den Zuschauer zum kritischen Denken anzuregen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema von Brechts „Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui“?
Das Stück ist eine Parabel auf den Aufstieg Adolf Hitlers und des Nationalsozialismus, verkleidet als Gangstergeschichte im Chicago der 1930er Jahre.
Welche Methoden des epischen Theaters nutzt Brecht hier?
Brecht nutzt Verfremdungseffekte (V-Effekte), Satire und die Form der Historienfarce, um den Zuschauer zur kritischen Distanz und zum Denken anzuregen.
Was bedeutet der Begriff „aufhaltsam“ im Titel?
Er unterstreicht Brechts Überzeugung, dass der Aufstieg des Faschismus kein Schicksal war, sondern durch politisches Handeln hätte verhindert werden können.
Welche historischen Parallelen werden im Stück gezogen?
Der „Karfioltrust“ steht für die Großindustrie, der „Speicherbrandprozess“ für den Reichstagsbrand und Arturo Ui direkt für Hitler.
Warum wählte Brecht ein Gangstermilieu als Setting?
Um die NS-Größen zu entlarven und ihre Taten als gewöhnliche Kriminalität im großen Stil darzustellen, statt sie heroisch zu verklären.
- Quote paper
- B.A. Gordon Oslislo (Author), 2008, Die zeitgeschichtlichen Aspekte von Brechts „Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui“ und ihre dramatische Umsetzung im Stück, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/160248