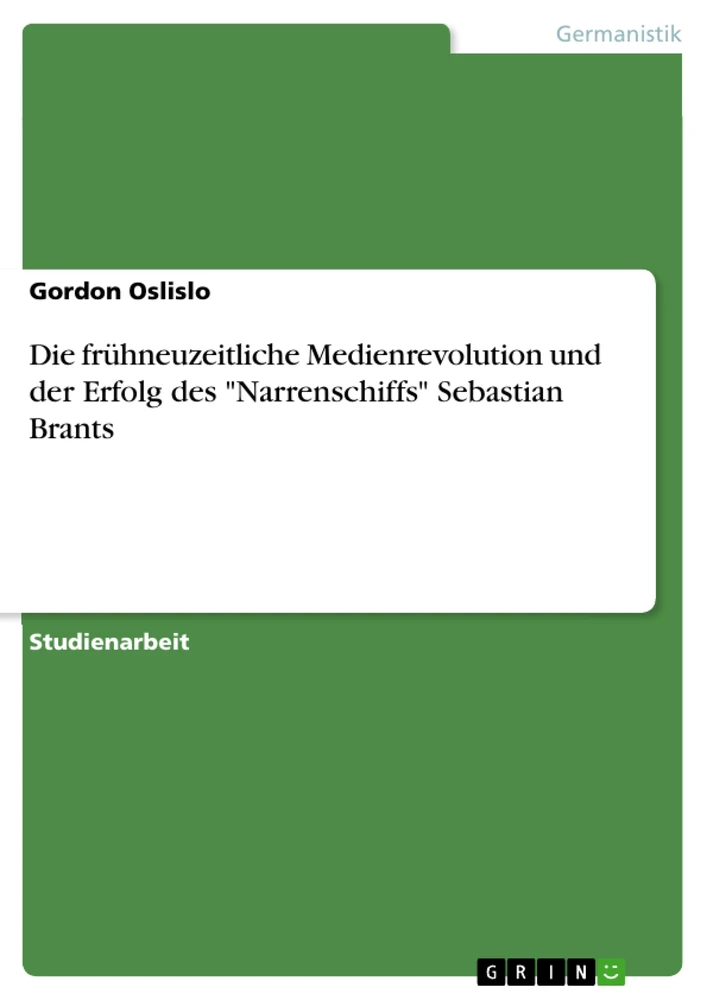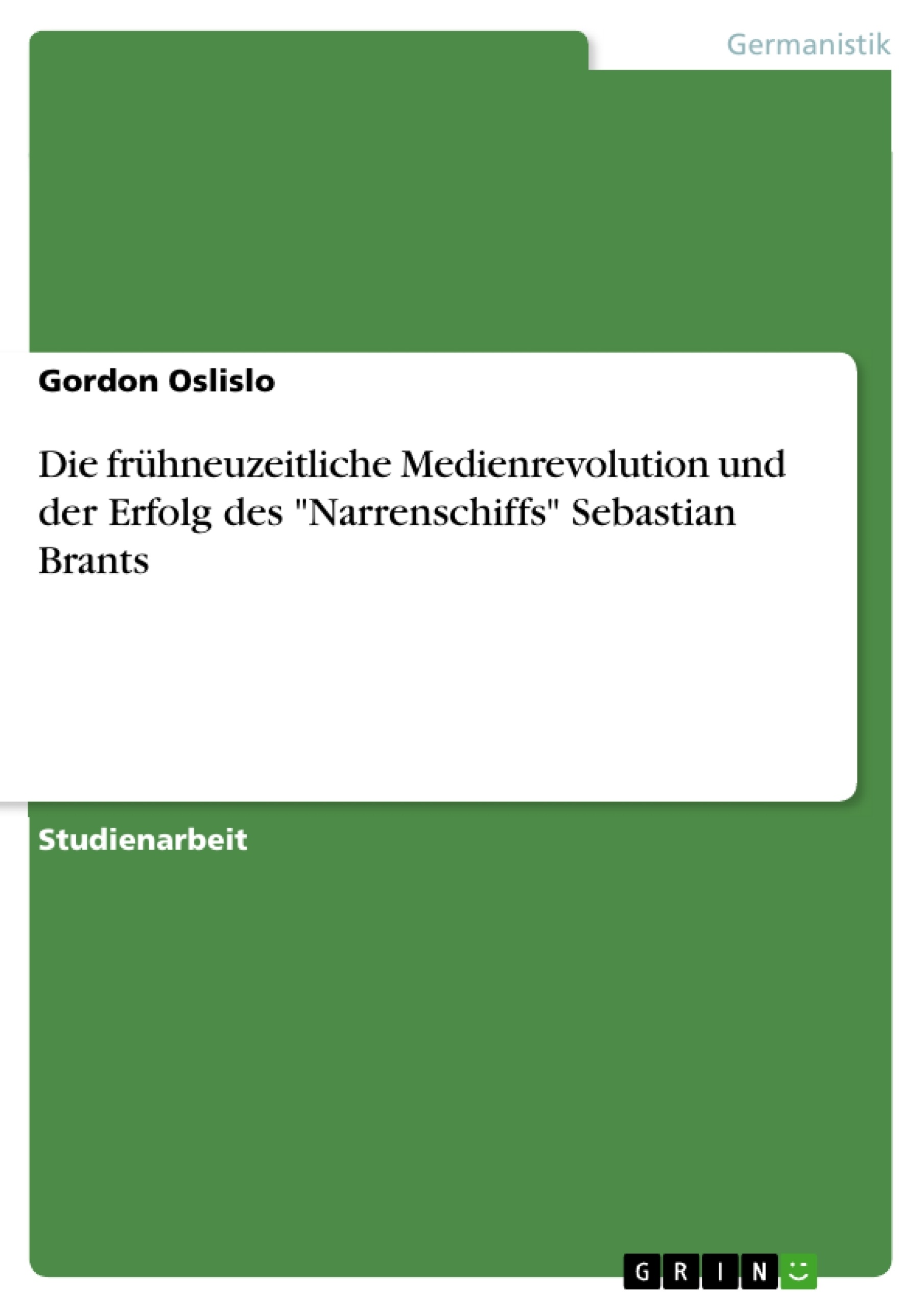Reduzieren wir die mediale Landschaft unserer Gegenwart, entsteht das Bild von einer frühneuzeitlichen Kommunikationssituation – einer Lebenswelt ohne Internet, Fernsehen, Rundfunk, Kino und Telefon. Durch die Einbeziehung des Gedruckten in die personale Kommunikation stellt diese Kommunikationssituation in ihrem zeitgeschichtlichen Kontext dennoch eine Zeit neuer medial gebotener Möglichkeiten dar.1
Ziel dieser Arbeit soll es sein, diese frühneuzeitliche „Medienrevolution“ zu untersuchen und den Erfolg des Narrenschiffs, eines der erfolgreichsten deutschsprachigen Werke der damaligen Zeit, zum Teil als deren Resultat zu bestimmen. Im ersten Abschnitt der Arbeit soll zunächst ein theoretischer Rahmen geschaffen werden, indem auf Definitionen relevanter Begriffe, den historischen Kontext und determinierende Bedingungen für den medialen Umbruch eingegangen werden soll. Anschließend erfolgt die Hinwendung zum neuen Medium, dem Buchdruck, wobei in gebotener Vereinfachung, der Übergang zwischen den zwei wichtigen Kommunikationssystemen der westlichen Welt voneinander abzugrenzen ist: dem mittelalterlichen Schreiben und dem frühneuzeitlichen Drucken. Zudem sollen die unmittelbar involvierten Handlungsrollen des Druckers, Autors und des Publikums unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen Beziehungen zueinander beschrieben und die Rezeption der neuen Medien in ihren Grundzügen charakterisiert werden. Im vierten Passus der Arbeit wird die Verknüpfung zum Narrenschiff des Sebastian Brant vollzogen, das sowohl entstehungsgeschichtlich als auch inhaltlich kurz umrissen wird. Im Folgenden wird die Rezeption des Werkes betrachtet, um letztlich zu untersuchen, ob der Erfolg des Narrenschiffs aus der medialen Umwälzung resultiert und zugleich zu prüfen, welche Variablen den Erfolg des Werkes zusätzlich hervorrufen. Ferner wird ein Ausblick gegeben, in dem markante Erkenntnisse zusammengefasst werden, das „neue Medium“ kritisch beleuchtet und auf offene Fragen verwiesen werden soll.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretisches
- 2.1 Definitionen_
- 2.2 Kontext und Bedingungen_
- 3. Das neue Medium
- 3.1 Der Buchdruck
- 3.2 Drucker - Autor - Publikum
- 3.3 Rezeption: Lesen – Hören - Sehen_
- 4. Das Narrenschiff Sebastian Brants
- 4.1 Die Rezeption des Narrenschiffs_
- 4.2 Der Erfolg des Narrenschiffs
- 5. Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Ziel dieser Arbeit ist es, die frühneuzeitliche „Medienrevolution“ zu untersuchen und den Erfolg des Narrenschiffs, eines der erfolgreichsten deutschsprachigen Werke der damaligen Zeit, zum Teil als deren Resultat zu bestimmen. Dabei wird die Rolle des Buchdrucks als neues Medium und seine Auswirkungen auf die Kommunikation im Fokus stehen.
- Definitionen von Kommunikation und Medium
- Der historische Kontext und die Bedingungen des medialen Umbruchs
- Die Bedeutung des Buchdrucks als neues Medium
- Die Rolle von Drucker, Autor und Publikum in der Rezeption des neuen Mediums
- Die Rezeption und der Erfolg des Narrenschiffs im Kontext der medialen Umwälzung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel liefert eine Einleitung in die Thematik der frühneuzeitlichen Medienrevolution und stellt den Erfolg des Narrenschiffs als Untersuchungsobjekt vor. Das zweite Kapitel widmet sich der theoretischen Einordnung der Thematik, indem es Definitionen von Kommunikation und Medium sowie den historischen Kontext und die bestimmenden Bedingungen für den medialen Umbruch beleuchtet. Das dritte Kapitel betrachtet den Buchdruck als neues Medium, seine Rolle im Übergang von mittelalterlicher Handschrift zur frühneuzeitlichen Druckkultur und die Interaktion zwischen Drucker, Autor und Publikum.
Schlüsselwörter
Frühneuzeitliche Medienrevolution, Buchdruck, Kommunikation, Rezeption, Narrenschiff, Sebastian Brant, Erfolg, Autor, Publikum, Drucker, Mediengeschichte, Humanismus.
- Quote paper
- B.A. Gordon Oslislo (Author), 2009, Die frühneuzeitliche Medienrevolution und der Erfolg des "Narrenschiffs" Sebastian Brants, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/160249