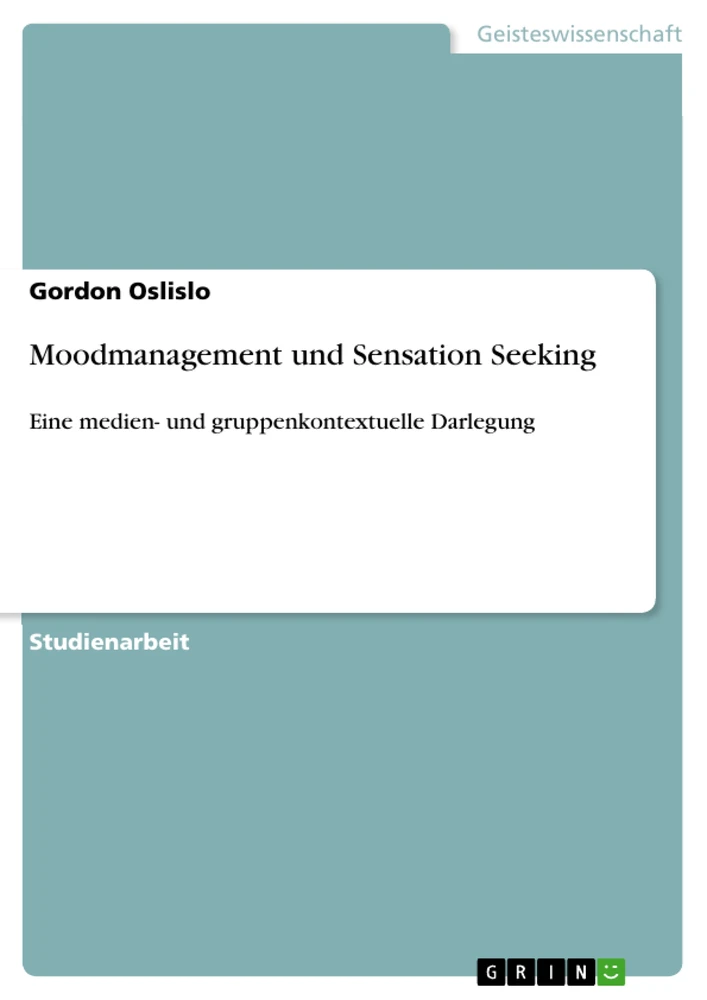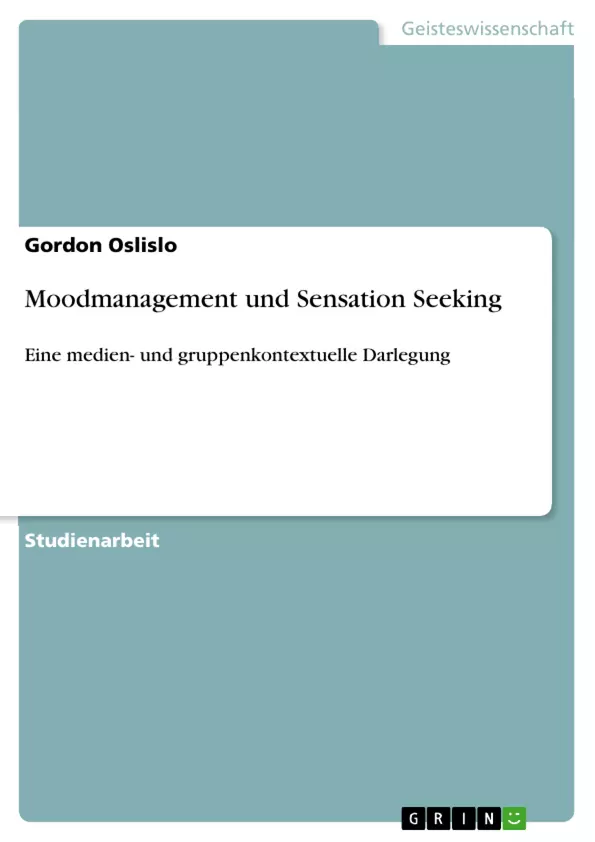Wer kennt das nicht: ein spannendes Buch in der Hand, ein fröhlich stimmendes Lied im Radio oder einen packenden Thriller im Fernsehen. Unabhängig davon, welches Medium betrachtet wird, steht eines fest: Der Mensch nutzt sie aus verschiedensten Gründen, die sowohl Merkmale des Medienangebots als auch des Rezipienten betreffen, und er erlebt dabei unterschiedliche Gefühlszustände – Emotionen, die durch bewusst gesuchte oder unbewusst erfahrene Reize ausgelöst werden. Herauszufinden, auf welche Art und Weise dies geschieht, ist Aufgabe der Differenziellen Psychologie unter Zuhilfenahme weiterer
kommunikationswissenschaftlicher Erkenntnisse. Zur Erklärung dieser Fragestellung gibt es viele Ansätze, die aus den unterschiedlichsten
Disziplinen stammend, kognitionspsychologische, entwicklungsbiologische und emotionspsychologische Explanationen liefern. Ziel dieser Arbeit ist es insofern das „Moodmanagement-“ und das „Sensation-Seeking-“ Konzept als zwei dieser Auffassungen in theoretischer Weise zu behandeln und zu verdeutlichen, welche Bedeutung Stimmungsregulierung und Reizkonsum sowie Reizsuche für interpersonale und gruppenkontextuelle Kommunikation, aber auch für eine medienbezogene Rezeption von Angeboten haben. Zunächst wird die Theorie des Moodmanagements vorgestellt. In einem vorhergehenden Schritt werden jedoch zentrale Begriffe definiert und in einen Gesamtzusammenhang eingeordnet. Nach der theoretisch fundierten Darlegung des Ansatzes wird inhaltlich überleitend das Sensation-Seeking- Konzept dargelegt. Auch hier erfolgt vorab eine definitorische Behandlung zentraler Begriffe. Anschließend werden beide Theorien miteinander in Bezug gesetzt, um eine etwaige Relevanz, Überschneidungen und Unterschiede zu verdeutlichen.
Nachfolgend werden sie zudem, in einen auf persönliche und medienvermittelte Kommunikation bezogenen Kontext, eingeordnet. Dies geschieht unter Einbeziehung der Theorie der emotionalen Ansteckung von Elaine Hatfield und wird durch eine Studie von Ramanathan und McGill untermauert. Eine abschließende Zusammenfassung und ein Ausblick bilden den Schlusspunkt dieser Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Moodmanagement
- Definitorisches - Stimmung & Emotion
- Die Theorie des Moodmanagements
- Sensation-Seeking
- Definitorisches - Reiz & Wahrnehmung
- Die Theorie des Sensation Seeking
- Einordnung & Transfer der Theorien
- Beziehung der Ansätze zueinander
- Gruppenkontextuelle Übertragung
- Fazit & Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit widmet sich der theoretischen Untersuchung des "Moodmanagement-" und des "Sensation-Seeking-" Konzepts. Das Ziel ist es, die Bedeutung von Stimmungsregulierung und Reizkonsum bzw. Reizsuche für verschiedene Kommunikationskontexte zu verdeutlichen, insbesondere im Hinblick auf interpersonale und gruppenkontextuelle Kommunikation sowie die medienbezogene Rezeption von Angeboten.
- Die Bedeutung von Stimmungsregulierung im Kontext von Mediennutzung
- Die Rolle des Sensation Seekings für Rezeption und Kommunikation
- Die Beziehung zwischen Moodmanagement und Sensation Seeking
- Die Anwendung der Theorien in Gruppenkontexten
- Der Einfluss von Stimmungen auf die Auswahl von Medieninhalten
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der emotionalen Medienwirkungen ein und erläutert den Zusammenhang zwischen Mediennutzung, Gefühlszuständen und der differenziellen Psychologie.
- Moodmanagement: Dieses Kapitel definiert die zentralen Begriffe Stimmung und Emotion und ordnet sie in den Gesamtkontext der Affekte ein. Anschließend wird die Theorie des Moodmanagements von Dolf Zillmann vorgestellt, die den Einfluss von Stimmungen auf die selektive Zuwendung zu Medieninhalten erklärt.
- Sensation-Seeking: In diesem Kapitel werden die Begriffe Reiz und Wahrnehmung definiert. Anschließend wird die Theorie des Sensation Seekings dargestellt, die die Suche nach neuen und intensiven Reizen beschreibt.
- Einordnung & Transfer der Theorien: Dieses Kapitel setzt die beiden Theorien des Moodmanagements und des Sensation Seekings in Beziehung zueinander. Es werden mögliche Überschneidungen und Unterschiede der Ansätze herausgestellt und die Anwendung der Theorien in einem gruppenkontextuellen Rahmen untersucht.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Arbeit umfassen die Konzepte des Moodmanagements und des Sensation Seekings, die Rolle von Emotionen und Stimmungen bei der Mediennutzung, die Bedeutung von Reizen und Wahrnehmung, sowie die Anwendung der Theorien in interpersonellen und gruppenkontextuellen Kommunikationssettings.
- Arbeit zitieren
- B.A. Gordon Oslislo (Autor:in), 2010, Moodmanagement und Sensation Seeking, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/160251