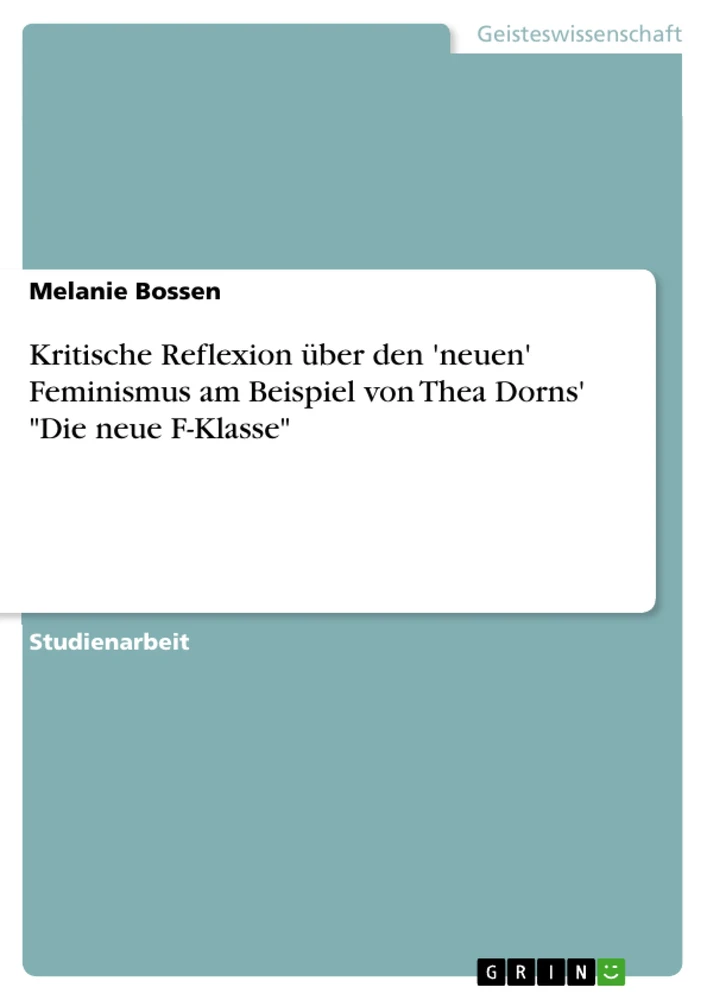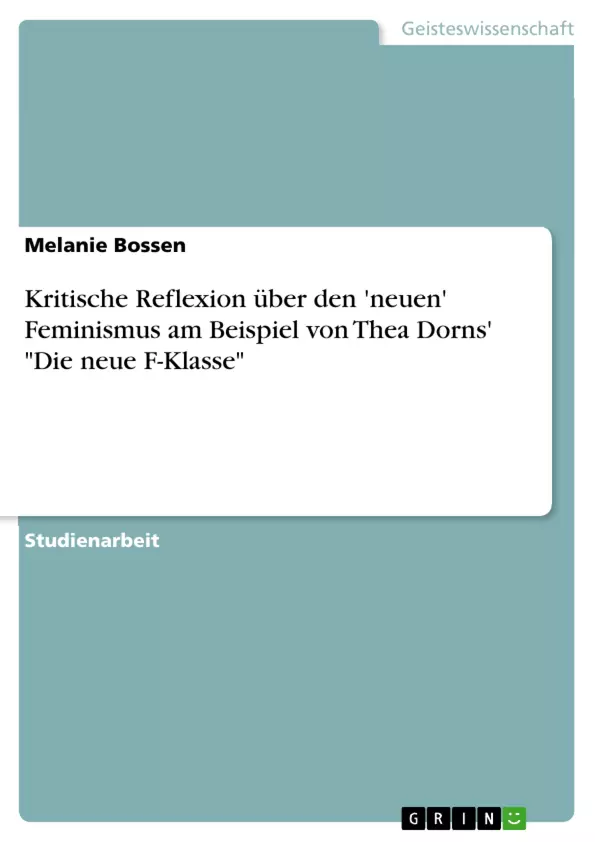Sieht man sich in der deutschen Medienlandschaft um, kann man den Diskussionen über einen neuen Feminismus nicht entgehen. Viele Frauen möchten sich Gehör verschaffen und rufen diesen neuen Feminismus aus, der in seiner Erscheinungsform sehr variabel ist. Man liest zum Beispiel über eine deutschtürkische Doktorandin und Rapperin, die sich selbst Lady Bitch Ray nennt und „als Gesamtkunstwerk wahrgenommen werden [will], das um jeden Preis in den Kampf für die weibliche Emanzipation eintritt.“ Sie möchte „die noch immer ‚als Opfer erzogenen‘ Frauen aus der Tyrannei des Patriarchats ins gelobte Land der vaginalen Selbstbestimmung [...] führen“ . Dafür hat sie 10 Gebote ihres eigens ernannten "Vagina Styles" aufgestellt, unter deren Anleitung sich Frauen emanzipieren können.
Eine andere Frau, die in diesem Jahr die Aufmerksamkeit der Medien auf sich gezogen hat, ist Charlotte Roche mit ihrem Roman "Feuchtgebiete". In ihrem Roman, der gleichzeitig ob seiner vulgären Sprache verrissen und dennoch auf Platz 1 der Spiegel-Bestseller liste kletterte, spricht die Hauptprotagonistin locker und selbstbewusst über ihr Sexualverhalten und ihre Körperausscheidungen. Auf die Frage, warum Mädchen ein verkrampftes Verhältnis zu ihren Exkrementen hätten, antwortet Roche: „Ich bezweifle immer mehr, dass diese ganzen Sachen, mit denen Frauen Probleme haben, von den Männern kommen, wie das der Feminismus gerne behauptet. Entweder sie machen sich die Probleme selber oder sie werden dazu von ihren Müttern erzogen.“
Man spricht über Pop-Feminismus, Lipstick-Feminismus, Wellness-Feminismus, Feminismus 2.0 und Bücher, die für einen neuen Feminismus eintreten überschwemmen den Markt. Allen gemeinsam ist die kritische Haltung dem alten Feminismus gegenüber.
In den Fokus meiner Arbeit stelle ich das von Thea Dorn geschriebene Buch "Die neue F-Klasse. Wie die Zukunft von Frauen gemacht wird.", welches sich in den Kanon des selbst ernannten "neuen" Feminismus einreiht.
Im Fokus dieser kritischen Würdigung stehen folgende Fragen: Thea Dorn distanziert sich in ihrem Buch vom "alten" Feminismus. Dabei fällt jedoch auf, dass ihre Forderungen eindeutig feministisch sind. Doch kann man Dorns Anleitung zur Emanzipation als feministisch betrachten? Inwieweit ist es problematisch, dass Dorn ihr Buch ausschließlich an Frauen mit dem Wunsch nach Führungspositionen adressiert? Liegt in der fehlenden Solidarität für andere Frauen bereits das Scheitern dieses neuen Feminismus?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Überblick
- Die Zweite (west-)deutsche Frauenbewegung in Deutschland
- Thea Dorns neue F-Klasse. Eine Zusammenfassung
- Kritische Würdigung
- Feminismus – Nein, danke?
- Emanzipation nur durch Karriere?
- Keine für alle und alle für sich?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Thea Dorns Buch "Die neue F-Klasse. Wie die Zukunft von Frauen gemacht wird" und setzt es in Bezug zum aktuellen Diskurs um einen "neuen Feminismus". Die Arbeit beleuchtet Dorns Kritik am "alten" Feminismus und untersucht, ob ihre Position tatsächlich als feministisch bezeichnet werden kann.
- Der aktuelle Diskurs um den "neuen Feminismus" im Kontext der Zweiten (west-)deutschen Frauenbewegung
- Thea Dorns Kritik am "alten" Feminismus und ihre Vision einer neuen feministischen Strategie
- Die Frage, ob Dorns Ansatz tatsächlich feministisch ist und ob er die Anliegen aller Frauen repräsentiert
- Die Kritik an Dorns Fokus auf Karriere und Leadership und die fehlende Solidarität mit anderen Frauen
- Die Relevanz von Dorns Buch für die aktuelle Debatte um Geschlechterrollen und Emanzipation
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die aktuelle Debatte um einen "neuen Feminismus" vor und führt in das Thema der Arbeit ein. Sie präsentiert verschiedene Beispiele für aktuelle feministische Strömungen und beleuchtet die kritische Haltung gegenüber dem "alten" Feminismus.
Kapitel 1 bietet einen Überblick über die Zweite (west-)deutsche Frauenbewegung, die in den späten 60er Jahren entstand. Es werden die wichtigsten Themen, Akteure und Entwicklungen dieser Bewegung beleuchtet, wobei der Fokus auf die Entstehung des Radikalfeminismus liegt.
Kapitel 1.2 fasst Thea Dorns Buch "Die neue F-Klasse" zusammen und stellt die wichtigsten Argumente und Positionen des Buches dar.
Schlüsselwörter
Feminismus, neue Frauenbewegung, Thea Dorn, "Die neue F-Klasse", Emanzipation, Karriere, Leadership, Solidarität, Geschlechterrollen, Kritik, "alter" Feminismus.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Thea Dorn unter der "neuen F-Klasse"?
Dorn beschreibt damit eine Generation von Frauen, die Führungspositionen anstreben und sich dabei bewusst vom "alten" Feminismus distanzieren.
Warum kritisiert Thea Dorn den "alten" Feminismus?
Sie sieht im traditionellen Feminismus oft eine Opferrolle verankert, die moderne, karriereorientierte Frauen eher abschreckt als stärkt.
Ist Thea Dorns Ansatz tatsächlich feministisch?
Obwohl sie feministische Forderungen stellt, wird kritisiert, dass ihr Fokus auf Karriere und Elite die Solidarität mit anderen Frauen vernachlässigt.
Was ist "Pop-Feminismus" oder "Lipstick-Feminismus"?
Dies sind moderne Strömungen, die Weiblichkeit, Konsum und Selbstbestimmung betonen, oft im Kontrast zum radikalen Feminismus der 60er/70er Jahre.
Welche Rolle spielt die Karriere in Dorns Emanzipationskonzept?
Für Dorn ist der Aufstieg in Führungspositionen (Leadership) der zentrale Weg zur weiblichen Selbstbestimmung in der heutigen Gesellschaft.
- Citar trabajo
- Melanie Bossen (Autor), 2008, Kritische Reflexion über den 'neuen' Feminismus am Beispiel von Thea Dorns' "Die neue F-Klasse", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/160259