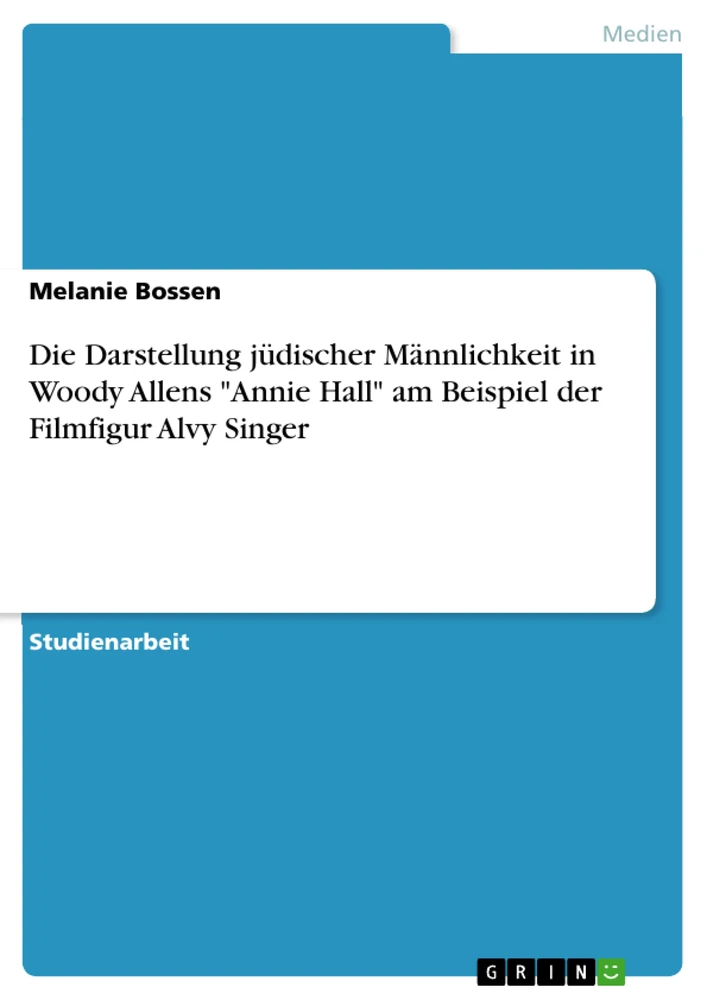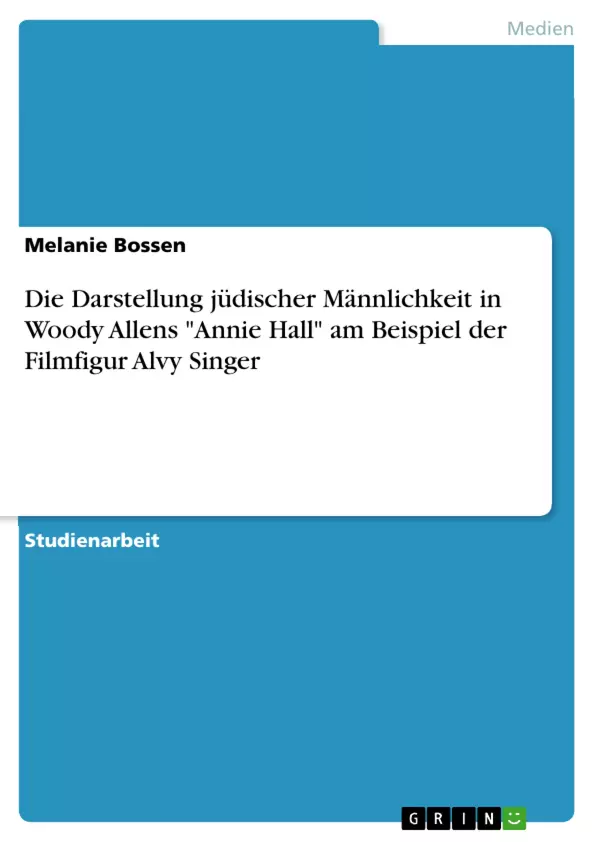Im Jahr 1977 erschien "Annie Hall" unter der Regie von Woody Allen, der zusammen mit Marshall Brickman auch das Drehbuch zum Film schrieb. "Annie Hall" ist der erste Film von Allens so genannter New-York-Trilogie, zu der auch seine Filme "Manhattan" (1979) und "Stardust Memories" (1980) zählen.
Dass Filme keine authentischen Abbildungen der Realität sind, steht außer Frage. Und doch möchte dieses Medium dem Betrachter die Illusion von Realität vermitteln. Bei der Konstruktion und Reproduktion von Geschlechterstereotype spielen Film und Fernsehen eine nicht zu unterschätzende Rolle, da sie Massenmedien sind und somit eine große Anzahl von Menschen erreichen. Geschlecht wird tagtäglich in Interaktionsprozessen hergestellt und so kann auch das Betrachten eines Filmes als ein Faktor im Prozess des Doing Gender gesehen werden.
Die männliche Hauptfigur des Films "Annie Hall" ist der jüdische Komiker Alvy Singer. In meiner Arbeit werde ich diese durch Woody Allen dargestellte Männlichkeit analysieren. Dabei beziehe ich mich unter Anderem auf das Konzept von Robert W. Connell, welches im Kapitel 2.3 Männlichkeiten näher erläutert wird.
Bei der Untersuchung des Charakters Alvy Singer entstehen dabei folgende Fragen: Welche Charaktereigenschaften besitzt diese Figur und wie grenzen sich deren Charaktereigenschaften von stereotypen männlichen Eigenschaften ab? Ist die Figur Alvy Singer ein neuer Entwurf von Männlichkeit oder dient er nur der Festigung der hegemonialen Männlichkeit?
Ein nicht zu ignorierender Faktor bei der Analyse Alvy Singers ist sein jüdischer Hintergrund. Innerhalb historischer Prozesse wurden männliche Juden zu einem „Anti-Typus der modernen Maskulinität“ und ich möchte es vermeiden, einige der Charaktereigenschaften Alvy Singers in den Bereich des unmännlichen zu rücken. Alvy Singer ist ein Männlichkeitsentwurf unter vielen und sein jüdischer Hintergrund ist dabei ein prägendes Element seines Charakters.
Bei der Analyse des Filmes bzw. der Dialoge der Filmfiguren erwies sich die deutsche Fassung des Drehbuches von Woody Allen und Marshall Brickman als problematisch, da die Dialoge teilweise sehr von denen der Originalfassung des Filmes abweichen. Ich habe nur die Beschreibung der Orte und der Bewegungen der Figuren aus der deutschen Drehbuchfassung übernommen. Die Dialoge sind die der Originalfassung des Filmes.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Filminhalt
- Die Darstellung jüdischer Männlichkeit in Woody Allens Film Annie Hall am Beispiel der Filmfigur Alvy Singer
- Jüdischkeit
- Geschlechterstereotype
- Männlichkeiten
- Alvy Singer
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Darstellung jüdischer Männlichkeit in Woody Allens Film Annie Hall anhand der Figur Alvy Singer. Sie untersucht, wie diese Darstellung mit stereotypen männlichen Eigenschaften interagiert und ob sie einen neuen Entwurf von Männlichkeit präsentiert oder zur Festigung der hegemonialen Männlichkeit beiträgt.
- Die Konstruktion von Jüdischkeit und Männlichkeit als kultursoziologische Konstrukte
- Die Rolle von Geschlechtsstereotypen im Film und in der Medienlandschaft
- Die Darstellung von Männlichkeit im Kontext jüdischer Identität
- Die Analyse der Charaktereigenschaften von Alvy Singer im Vergleich zu stereotypen männlichen Eigenschaften
- Die Frage, ob Alvy Singer eine neue Form von Männlichkeit repräsentiert oder die hegemoniale Männlichkeit festigt
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt den Film Annie Hall vor und erläutert die Relevanz der Analyse der Darstellung jüdischer Männlichkeit in einem filmischen Kontext.
- Das Kapitel „Filminhalt" gibt eine Zusammenfassung der Handlung von Annie Hall und stellt die Hauptfiguren vor, insbesondere Alvy Singer.
- Das Kapitel „Die Darstellung jüdischer Männlichkeit in Woody Allens Film Annie Hall am Beispiel der Filmfigur Alvy Singer" untersucht die Konstruktion von Jüdischkeit und Männlichkeit. Es beleuchtet die verschiedenen Definitionen von Jüdischkeit und stellt diese in Bezug zu dem Konzept der Männlichkeit.
Schlüsselwörter
Jüdische Männlichkeit, Annie Hall, Woody Allen, Alvy Singer, Geschlechterstereotype, Männlichkeitsentwurf, Hegemoniale Männlichkeit, Doing Gender, Jüdischkeit, Film, Kultursoziologie, Konstruktivismus.
- Citation du texte
- Melanie Bossen (Auteur), 2008, Die Darstellung jüdischer Männlichkeit in Woody Allens "Annie Hall" am Beispiel der Filmfigur Alvy Singer, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/160269