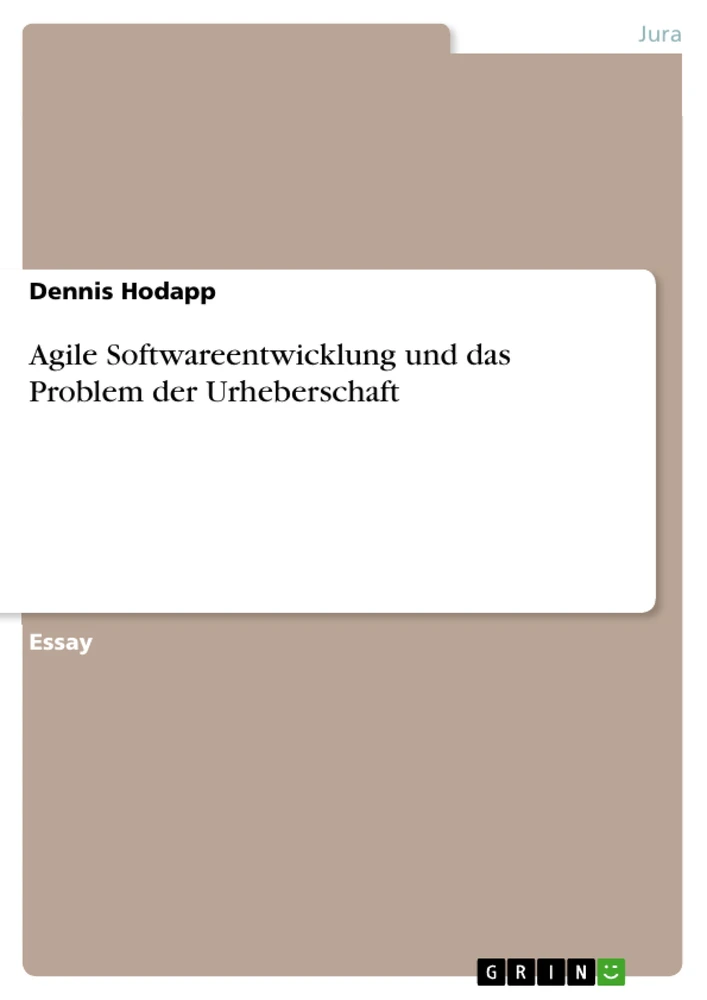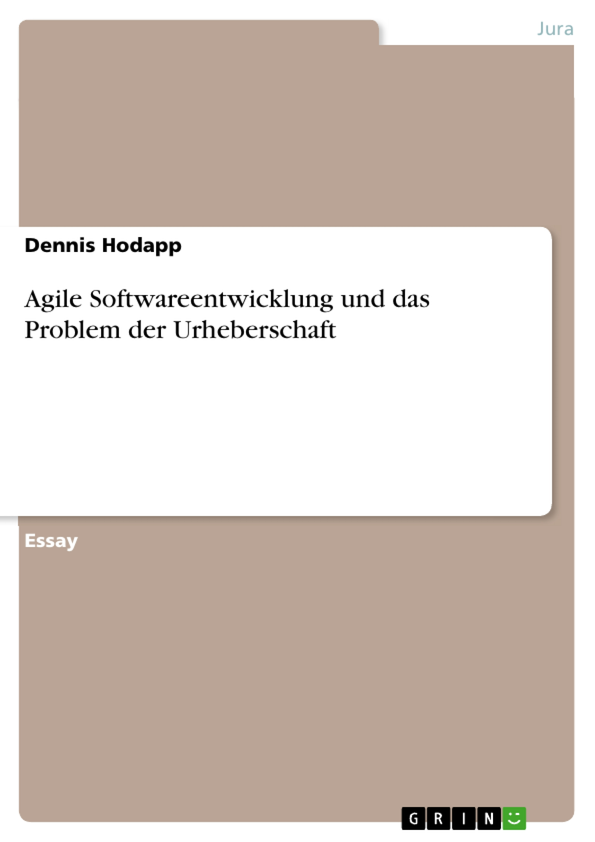In der vorliegenden Arbeit wird das Problem der Urheberschaft in der agilen Softwareentwicklung, mit Schwerpunkt Miturheberschaft des Auftraggebers, diskutiert.
Heutzutage wird agile Softwareentwicklung in vielen Unternehmen eingesetzt. Dabei steht die Benutzerakzeptanz im Mittelpunkt. Was zur Folge hat, dass in der agilen Softwareentwicklung ein iterativer Entwicklungsprozess stattfindet und der Auftraggeber dabei oft eingebunden wird. Die Rechtsprechung steht nun vor dem Problem, dass die Applikation nicht von einzelnen Leuten, sondern von qualifizierten Teams mit unterschiedlichen Rollen und zusätzlichen Team externen Rollen wie u.a. dem Auftraggeber, entwickelt wird.
Das angesprochene Problem besteht in der Frage, ob ein Anspruch externen Rollen, wie u.a. an eine Miturheberschaft an der Anwendung fundiert ist und der Beitrag dieser Rolle zwingend eine Programmierleistung enthalten muss.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Einführung in die Thematik
- 1.2 Problemstellung und Zielsetzung
- 1.3 Methodischer Aufbau der Arbeit
- 2 Hauptteil
- 2.1 Miturheberschaft angestellter Programmierer
- 2.2 Miturheberschaft des Auftraggebers
- 2.3 Ableitbare Probleme
- 2.4 Zweckübertragungslehre
- 3 Schluss
- 3.1 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Problem der Urheberschaft bei agiler Softwareentwicklung, insbesondere die Frage der Miturheberschaft des Auftraggebers. Ziel ist es, die rechtlichen Herausforderungen zu beleuchten, die sich aus der kollaborativen und iterativen Natur agiler Prozesse ergeben.
- Miturheberschaft angestellter Programmierer im Kontext agiler Methoden
- Miturheberschaft des Auftraggebers bei agiler Softwareentwicklung
- Rechtliche Probleme im Zusammenhang mit der Miturheberschaft
- Analyse der Zweckübertragungslehre im Kontext der agilen Softwareentwicklung
- Bewertung der rechtlichen Situation anhand von Gerichtsurteilen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses einführende Kapitel beschreibt die Herausforderungen der Urheberschaftsfrage in der agilen Softwareentwicklung. Der iterative Entwicklungsprozess und die enge Einbindung des Auftraggebers führen zu Unsicherheiten bezüglich der urheberrechtlichen Ansprüche. Es wird die zentrale Fragestellung nach der Miturheberschaft externer Rollen, insbesondere des Auftraggebers, und der Notwendigkeit einer Programmierleistung für einen solchen Anspruch eingeführt. Die Problemstellung wird klar definiert und die methodische Vorgehensweise der Arbeit skizziert, inklusive der verwendeten Recherchemethoden und Quellen.
2 Hauptteil: Der Hauptteil befasst sich eingehend mit der Miturheberschaft in der agilen Softwareentwicklung. Kapitel 2.1 analysiert die Miturheberschaft angestellter Programmierer im Lichte des Urheberrechtsgesetzes (§ 69a Abs. 1-5 UrhG und § 8 Abs. 1 UrhG), wobei die Bedeutung der schöpferischen Leistung und der gemeinsamen Zielsetzung im Team betont wird. Kapitel 2.2 widmet sich der komplexeren Frage der Miturheberschaft des Auftraggebers, die von der Größe seines Beitrags zum Gesamtprojekt abhängt und zu Einzelfallentscheidungen führt. Kapitel 2.3 beleuchtet die daraus resultierenden rechtlichen Probleme, während Kapitel 2.4 einen Exkurs zur Zweckübertragungslehre unternimmt, um weitere Aspekte der Urheberschaft im Kontext agiler Projekte zu erörtern. Der gesamte Hauptteil bietet eine umfassende Analyse der rechtlichen Grundlagen und ihrer Anwendung in der Praxis.
Schlüsselwörter
Agile Softwareentwicklung, Urheberschaft, Miturheberschaft, Auftraggeber, Programmierer, Urheberrechtsgesetz (UrhG), Zweckübertragungslehre, Rechtsprechung, Softwareentwicklung, Kollaboration.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Fokus dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Problem der Urheberschaft bei agiler Softwareentwicklung, insbesondere die Frage der Miturheberschaft des Auftraggebers. Ziel ist es, die rechtlichen Herausforderungen zu beleuchten, die sich aus der kollaborativen und iterativen Natur agiler Prozesse ergeben.
Welche Themen werden in dieser Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen:
- Miturheberschaft angestellter Programmierer im Kontext agiler Methoden
- Miturheberschaft des Auftraggebers bei agiler Softwareentwicklung
- Rechtliche Probleme im Zusammenhang mit der Miturheberschaft
- Analyse der Zweckübertragungslehre im Kontext der agilen Softwareentwicklung
- Bewertung der rechtlichen Situation anhand von Gerichtsurteilen
Was ist die zentrale Fragestellung der Einleitung?
Die zentrale Fragestellung der Einleitung ist die Miturheberschaft externer Rollen, insbesondere des Auftraggebers, und die Notwendigkeit einer Programmierleistung für einen solchen Anspruch.
Womit befasst sich der Hauptteil der Arbeit?
Der Hauptteil befasst sich eingehend mit der Miturheberschaft in der agilen Softwareentwicklung. Er analysiert die Miturheberschaft angestellter Programmierer, die Miturheberschaft des Auftraggebers, die daraus resultierenden rechtlichen Probleme und die Zweckübertragungslehre.
Welche Gesetze werden im Zusammenhang mit der Miturheberschaft angestellter Programmierer erwähnt?
Im Zusammenhang mit der Miturheberschaft angestellter Programmierer werden das Urheberrechtsgesetz (§ 69a Abs. 1-5 UrhG und § 8 Abs. 1 UrhG) erwähnt.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Relevante Schlüsselwörter sind: Agile Softwareentwicklung, Urheberschaft, Miturheberschaft, Auftraggeber, Programmierer, Urheberrechtsgesetz (UrhG), Zweckübertragungslehre, Rechtsprechung, Softwareentwicklung, Kollaboration.
- Quote paper
- Dennis Hodapp (Author), 2020, Agile Softwareentwicklung und das Problem der Urheberschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1602939