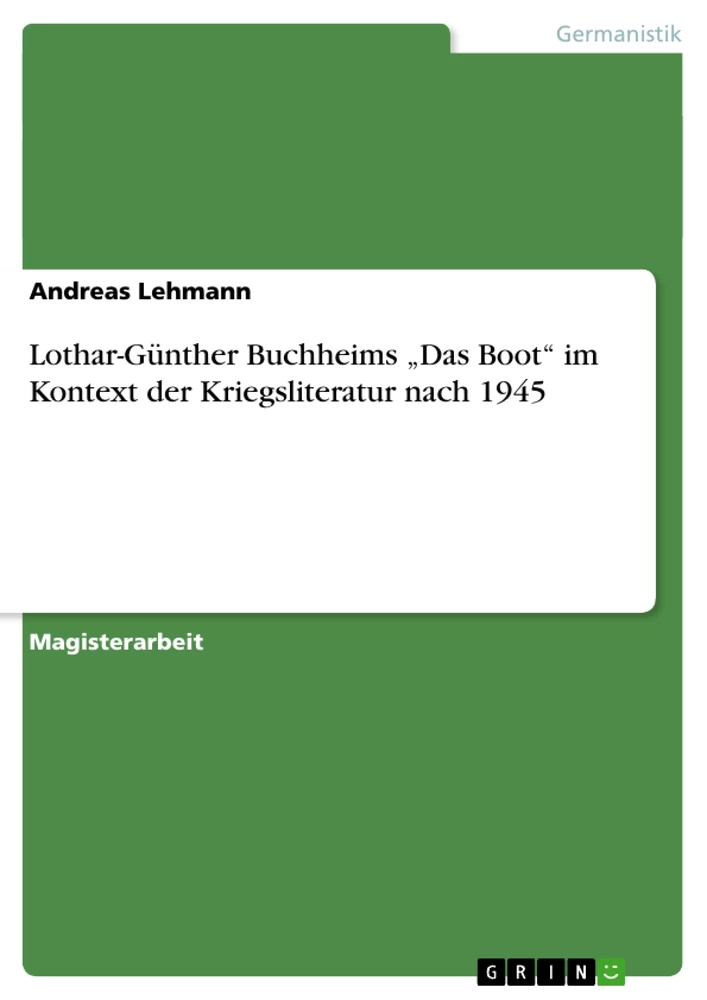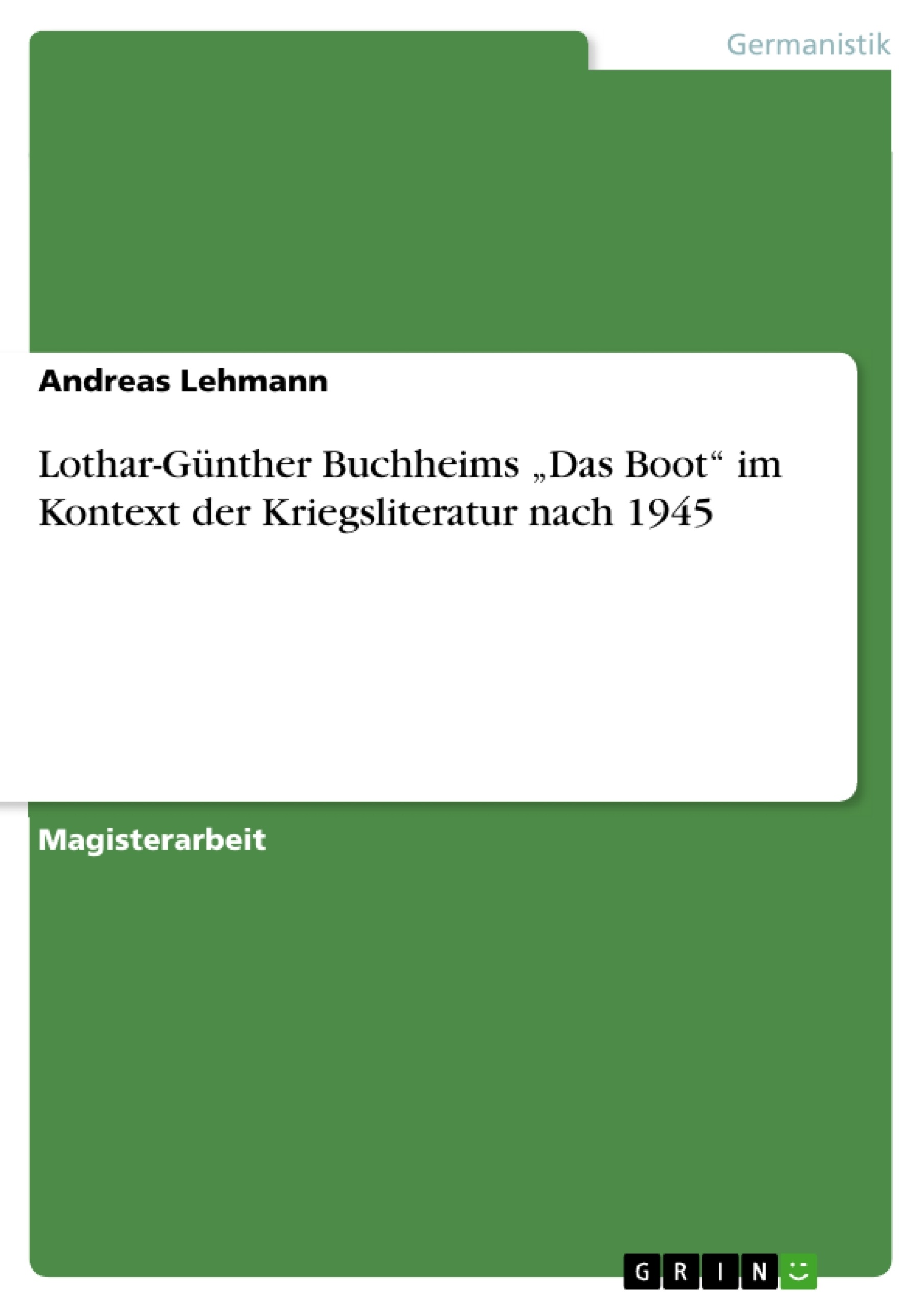Lothar-Günther Buchheims Das Boot, 1973 erschienen, ist zunächst als Roman gekennzeichnet, d. h. ein Kernbereich, in den das Buch einzuordnen und in dem es zu behandeln ist, ist die Kriegsprosa nach 1945, und zwar in der Hauptsache die deutsche Kriegsprosa nach 1945. Einen weiteren Bereich der Literatur, in den Das Boot aufgrund seiner speziellen Thematik fällt, stellt die sog. ‚U-Boot-Literatur’ dar.
Die Bandbreite ist enorm. Sie reicht von historiographischen und technisch-wissenschaftlichen Arbeiten (maritimer Fachliteratur) bis zu populärwissenschaftlichen Büchern und erstreckt sich bis in die ‚Niederungen’ der sog. ‚Landserhefte’.
Die Bedeutung von Buchheims Boot für diesen Literaturbereich wird ein wesentlicher Aspekt dieser Arbeit sein.
Zunächst soll in einem knappen Exkurs die Frage geklärt werden, ob Das Boot als erster Teil einer angeblichen Trilogie, gewissermaßen isoliert von den anderen beiden Teilen, untersucht werden kann.
Dann soll kurz auf die grundsätzlichen Probleme bei der Kategorisierung in Kriegsliteratur bzw. Anti-Kriegsliteratur eingegangen werden.
In einem nächsten Schritt wird Das Boot dann mit der Kriegsprosa nach 1945 in Zusammenhang gebracht. Dazu sollen Motive, Hauptströmungen und Kontinuitäten innerhalb dieses thematischen Teilbereichs herausgestellt und der Roman auf Entsprechungen bzw. Divergenzen untersucht werden.
In diesem Rahmen wird auch auf die wesentlichen Unterschiede der west- und ostdeutschen Kriegsprosa in dieser durch den Systemgegensatz, den ‚Kalten Krieg’, geprägten Ära eingegangen werden.
Außerdem sollen die Hauptkritikpunkte, mit denen sich Das Boot immer wieder konfrontiert sieht, erörtert werden.
Ein weiteres Kapitel wird sich mit der Gattungsfrage des Romans beschäftigen, die bislang in der Forschung noch nicht hinreichend beantwortet wurde.
Der Fokus wird sich dabei auf dokumentarische Literatur im weiteren und den ‚Dokumentarroman’ im engeren Sinne richten.
Der letzte Abschnitt beschäftigt sich dann mit der Stellung, die Das Boot innerhalb der U-Boot-Literatur einnimmt.
Dabei soll neben der heftigen Debatte, die der Roman auslöste, auch beleuchtet werden, inwieweit das Werk Buchheims im Schatten seines Autors bzw. dessen Ruf steht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Untersuchungsbereich - Begriffsbestimmung
- 1.2. Forschungslage
- 1.3. Methodik - Ziel der Untersuchung
- 2. Grundsätzliche Feststellungen
- 2.1. Exkurs: Das Boot - Teil einer Trilogie?
- 2.2. Kriegs- und Antikriegsbücher
- 3. Die Kriegsprosa nach 1945
- 3.1. BRD und DDR – Kriegsliteratur im Zerrspiegel der Politik
- 3.2. Beschreibungskonventionen der Kriegsprosa
- 3.2.1. Nie wieder Krieg! Kriegsnaturalismus als Zukunftsmahnung
- 3.2.2. Der deutsche Soldat als Opfer - die Nazis alleinige Täter
- 3.2.3. Unfähige Führung
- 3.3. Ansatzpunkte der Kritik
- 3.3.1. Ausblenden von Politik
- 3.3.2. Heldenverehrung – Technikglorifizierung?
- 4. Dokumentarliteratur
- 4.1. Dokumentarisches – subjektiviert
- 4.2. Der Dokumentarroman
- 4.2.1. Faktizität
- 4.2.2. Subjektivität
- 5. U-Boot-Literatur
- 5.1. Zur Entstehung
- 5.2. Arten und Tendenzen
- 5.3. Die,Buchheim-Debatte'
- 5.3.1. Wahrheit und Wirklichkeit
- 5.3.2. Der Mythos Dönitz
- 5.4. Das Werk im Schatten des Autors
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert Lothar-Günther Buchheims Roman „Das Boot“ im Kontext der deutschen Kriegsprosa nach 1945 und beleuchtet die spezifischen Aspekte der U-Boot-Literatur. Sie untersucht, wie Buchheims Werk die Erfahrungen und Folgen des Zweiten Weltkriegs verarbeitet und welche Rolle es in der Auseinandersetzung mit der deutschen Vergangenheit spielt.
- Die Entwicklung der Kriegsprosa in der BRD und DDR nach 1945
- Die Darstellung von Kriegserfahrungen und -folgen in der Literatur
- Die Rolle der U-Boot-Literatur im Kontext der Kriegsliteratur
- Die spezifischen Charakteristika von Buchheims „Das Boot“ im Vergleich zu anderen Werken der U-Boot-Literatur
- Die Rezeption von Buchheims Roman und die „Buchheim-Debatte“
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Untersuchungsgegenstand, die Forschungslage und die Methodik der Arbeit vor. Kapitel 2 befasst sich mit grundsätzlichen Feststellungen zu Kriegs- und Antikriegsbüchern sowie der Frage, ob Buchheims „Das Boot“ Teil einer Trilogie ist. Kapitel 3 analysiert die Kriegsprosa nach 1945, insbesondere die Darstellungskonventionen und Kritikpunkte. Kapitel 4 behandelt die Dokumentarliteratur, insbesondere den Dokumentarroman und seine spezifischen Merkmale. Kapitel 5 befasst sich mit der U-Boot-Literatur, ihrer Entstehung, ihren Arten und Tendenzen sowie der „Buchheim-Debatte“.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Kriegsprosa, U-Boot-Literatur, Lothar-Günther Buchheim, „Das Boot“, Zweiter Weltkrieg, deutsche Nachkriegsliteratur, Kriegserfahrungen, Kriegsfolgen, Dokumentarroman, „Buchheim-Debatte“.
- Quote paper
- Andreas Lehmann (Author), 2005, Lothar-Günther Buchheims „Das Boot“ im Kontext der Kriegsliteratur nach 1945, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/160297