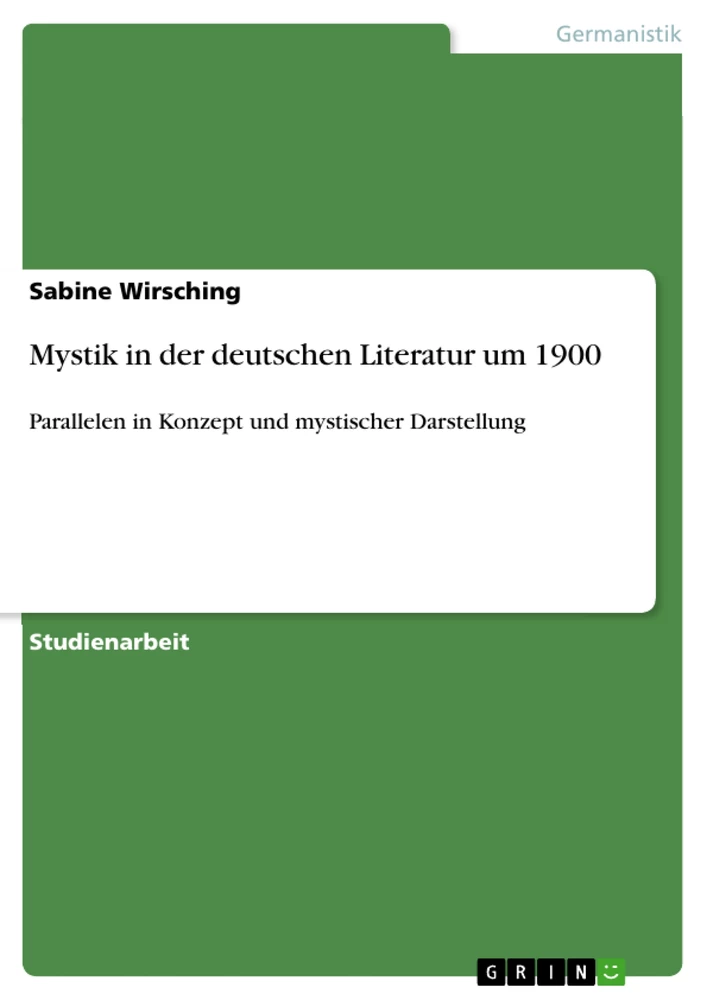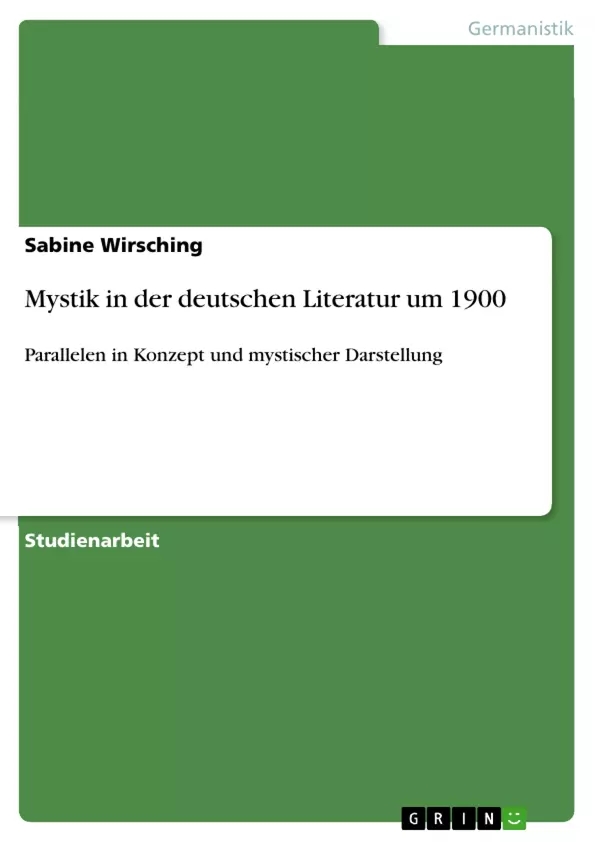Die Geschichte des gedruckten Buches ist inzwischen rund 550 Jahre alt. Die heutige Vermarktungsstruktur und der aktuelle Stand einer Medien- und Informationsgesellschaft bedingen und fördern einander. Doch diesen Status besaß Deutschland im ausgehenden Mittelalter noch längst nicht. Folglich stellt sich die Frage, wie die Literaturvermarktung zu Beginn der Frühen Neuzeit eigentlich aussah: Welche Entwicklungen führten zur Erfindung des Buchdrucks? Welche Überlegungen standen am Anfang seiner Entwicklung? Auf welchen altbewährten Grundlagen baute der Buchdruck auf? Welche Faktoren trugen zu seiner Entwicklung als Massenmedium bei, und welche Strukturen entstanden während dieser Zeit? Wie veränderte sich das Buch durch die massenhafte Herstellung? Die vorliegende Arbeit möchte mit einer Übersicht durch in die Forschungsliteratur zum Thema und ihrer Interpretation hinsichtlich der Fragestellung Einblick in diese Problematik geben. Die ersten Kapitel sind der Einführung in die historische Situation des Buchdrucks gewidmet: In Kapitel 2 wird zunächst die Erfindung des Buchdrucks thematisiert. Das Kapitel 3 beschäftigt sich den zeitgenössischen Begleitumständen des Drucks. Die strukturellen Voraussetzungen in Form der Handschrift werden in Kapitel 4 untersucht. In den nachfolgenden Kapiteln findet die Analyse der frühen Literaturvermarktung statt: Kapitel 5 thematisiert die vermarktungsorientierte Gestaltung des gedruckten Buches; ergänzend werden in Kapitel 6 die negativen Auswirkung der massenhaften
Buchproduktion in Form des Raubdrucks sowie rechtliche Gegenmaßnahmen behandelt. In Kapitel 7 wird im Anschluss die Entwicklung der Werbemittel beschrieben. Mit den an der Vermarktung beteiligten Berufsgruppen und deren Entwicklung beschäftigt sich Kapitel 8; zum Abschluss wird in Kapitel 9 der vermarktungstechnische Wechsel vom ambulanten zum stationären Handel erörtert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- Thematik und Ziel der Hausarbeit
- 2. Inhalt und Aufbau der Novellen
- 2.1. Joseph Freiherr von Eichendorff „Das Marmorbild“ (1819)
- 2.2. Heinrich Mann „Das Wunderbare\" (1896)
- 3. Die Hauptfiguren
- 3.1. Die Protagonisten und ihre Ausgangssituationen
- 3.2. Die Frauenfiguren
- 4. Die mystischen Erfahrungen und ihre Konsequenzen
- 4.1. Das Erlebnis der Begegnung
- 4.2. Die Erkenntnis aus der Begegnung
- 5. Die Nebenfiguren und ihr Beitrag zur mystischen Erfahrung
- 6. Kurze Darstellung der sprachlichen und thematischen Analogien
- 7. Schlussbemerkung
- Zusammenfassung und Einschätzung des Vergleichs
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Vergleich der Novellen „Das Marmorbild“ von Joseph Freiherr von Eichendorff und „Das Wunderbare“ von Heinrich Mann. Das zentrale Thema der Arbeit sind die Parallelen in Bezug auf die Darstellung mystischer Erfahrungen und deren Einfluss auf die Protagonisten. Dabei wird untersucht, wie die Begegnung mit dem Übernatürlichen das Leben der Hauptfiguren prägt und welche Ähnlichkeiten sich im Konzept und der Anlage der Figuren sowie in der Konzeption der mystischen Begegnungen finden.
- Parallelen in der Darstellung mystischer Erfahrungen
- Der Einfluss von mystischen Begegnungen auf die Protagonisten
- Ähnlichkeiten in der Figurenanlage und -konzeption
- Thematische und sprachliche Analogien im Aufbau der Novellen
- Die Rezeption von Eichendorffs „Das Marmorbild“ in Manns „Das Wunderbare“
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Hausarbeit führt in die Thematik und Zielsetzung ein. Es stellt die beiden Novellen kurz vor und erläutert die zentrale These der Arbeit: Beide Novellen zeichnen sich durch eine mystische Erfahrung der Protagonisten aus, die im Folgenden genauer untersucht werden soll.
Kapitel 2 gibt einen Überblick über den Inhalt und Aufbau der beiden Novellen. Im Fokus stehen die Handlungsstränge, die Figuren und die zentrale Thematik der mystischen Begegnung.
Das dritte Kapitel analysiert die Hauptfiguren der beiden Novellen, wobei der Fokus auf die Protagonisten und ihre Ausgangssituationen sowie die Frauenfiguren liegt. Die Analyse befasst sich mit den Charakteren, ihren Motivationen und dem Einfluss der mystischen Erfahrung auf ihre Entwicklung.
Kapitel 4 beleuchtet die mystischen Erfahrungen selbst. Es untersucht die Begegnung der Protagonisten mit dem Übernatürlichen, die Art und Weise, wie diese Erfahrungen dargestellt werden, und die daraus resultierenden Erkenntnisse und Konsequenzen für die Figuren.
Kapitel 5 widmet sich den Nebenfiguren und ihrem Beitrag zur mystischen Erfahrung. Es zeigt, wie die Nebenfiguren die Handlung und die Erfahrungen der Protagonisten beeinflussen.
Im sechsten Kapitel werden die sprachlichen und thematischen Analogien zwischen den beiden Novellen dargelegt. Hier werden Gemeinsamkeiten im Stil, in der Sprache und in der Gestaltung der Umgebung untersucht.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter der Arbeit sind: Mystik, Begegnung, Erfahrung, Protagonist, Figur, Eichendorff, Mann, "Das Marmorbild", "Das Wunderbare", Romantische Literatur, Jahrhundertwende, Parallelen, Analogien, Figurendarstellung, Konzeption.
Häufig gestellte Fragen
Welche Werke werden in dieser Arbeit verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Novellen "Das Marmorbild" von Joseph von Eichendorff und "Das Wunderbare" von Heinrich Mann.
Was ist das zentrale Thema des Vergleichs?
Im Mittelpunkt steht die Darstellung mystischer Erfahrungen und deren Einfluss auf die Protagonisten der beiden Erzählungen.
Welche Parallelen gibt es zwischen Eichendorff und Mann?
Es finden sich Ähnlichkeiten in der Figurenanlage, der Konzeption der mystischen Begegnungen sowie sprachliche und thematische Analogien.
Wie wird das Übernatürliche in den Novellen dargestellt?
Beide Autoren nutzen die Begegnung mit dem Übernatürlichen als Wendepunkt für die Erkenntnis und Entwicklung ihrer Hauptfiguren.
In welchem literarischen Kontext stehen die Werke?
Die Arbeit beleuchtet den Übergang von der Romantik (Eichendorff) zur Literatur der Jahrhundertwende um 1900 (Mann).
- Arbeit zitieren
- Sabine Wirsching (Autor:in), 2007, Mystik in der deutschen Literatur um 1900, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/160324