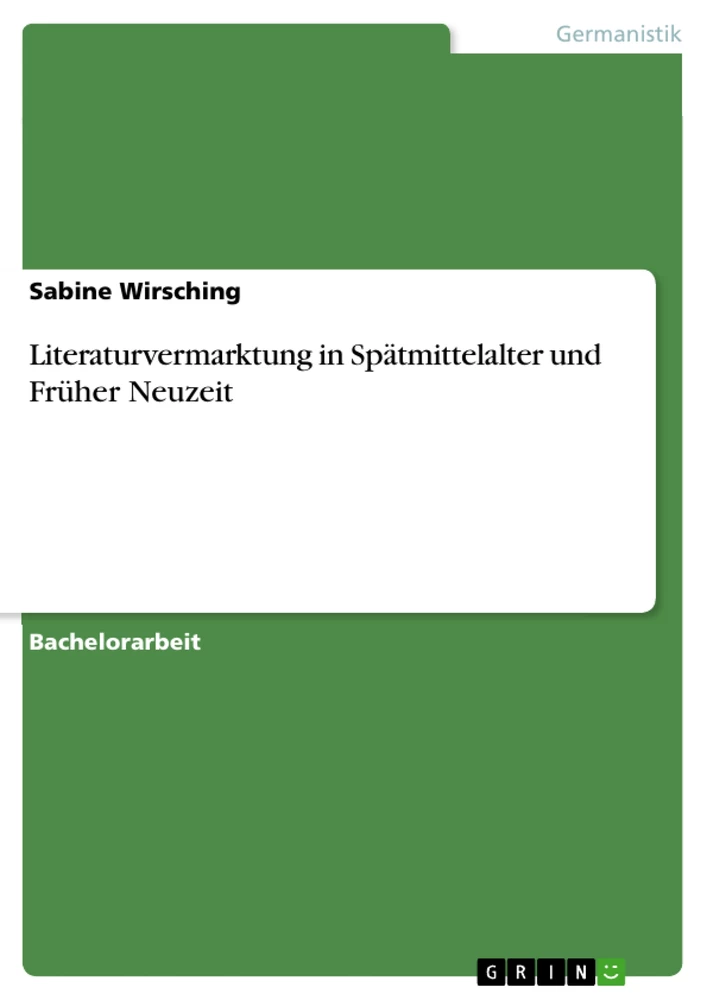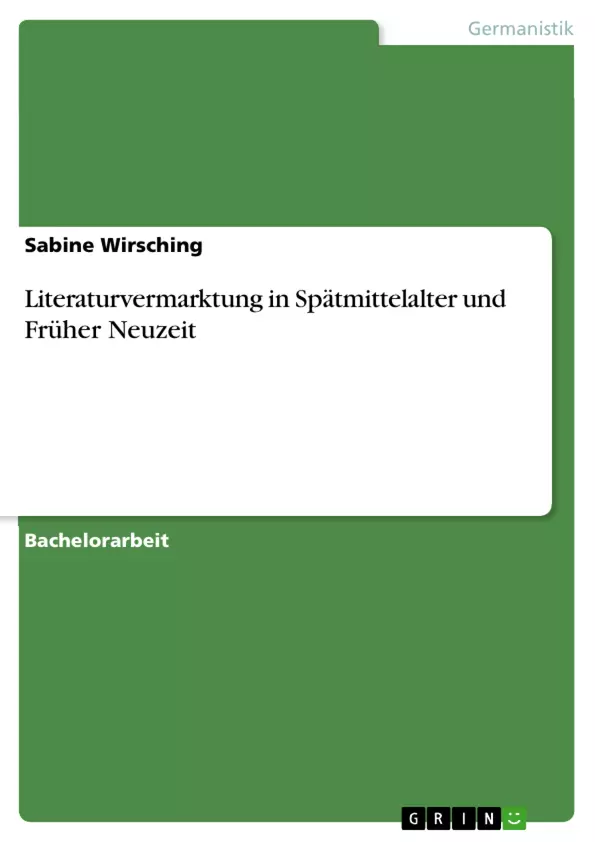Im 21. Jahrhundert empfindet es der Leser als alltäglich, dass ihm nicht nur in fast jeder
Stadt mindestens eine gut sortierte Buchhandlung zur Verfügung steht, sondern dass er
darüber hinaus über das Internet rund um die Uhr bestellen kann, was sein Herz begehrt.
Selbstverständlich erscheint ihm ebenso die Vielfalt der Bücher, die er in Bibliotheken
ausleihen, in Antiquariaten günstig gebraucht erwerben oder online sogar in elektronischer
Form herunterladen kann. Genauso natürlich nutzt er verschiedene Medien, um
Neuerscheinungen und Katalogtitel zu bibliographieren.
Buchhandel und –produktion sind in Deutschland allgegenwärtig, und das Buch ist
auch in Haushalten ohne literarische Interessen ein ständiger Begleiter – beispielsweise
in Form des Koch- oder Schulbuchs. In jeder städtischen Einkaufszone gehören große
Buchhandelsketten zum Erscheinungsbild, und die Verlage rücken ihre Erzeugnisse auf
den großen Messen in Frankfurt und Leipzig durch geschickte Publicitymaßnahmen in
den Fokus der Öffentlichkeit. Auch wenn heute vielfach über den Rückgang der Lesebegeisterung
geklagt und das Internet zunehmend als Informationsquelle genutzt wird –
das Buch und seine Vermarktung haben ihren festen Platz in unserem Alltag.
Die Geschichte des gedruckten Buches ist inzwischen rund 550 Jahre alt. Die heutige
Vermarktungsstruktur und der aktuelle Stand einer Medien- und Informationsgesellschaft
bedingen und fördern einander. Doch diesen Status besaß Deutschland im ausgehenden
Mittelalter noch längst nicht. Folglich stellt sich die Frage, wie die Literaturvermarktung
zu Beginn der Frühen Neuzeit eigentlich aussah: Welche Entwicklungen
führten zur Erfindung des Buchdrucks? Welche Überlegungen standen am Anfang seiner
Entwicklung? Auf welchen altbewährten Grundlagen baute der Buchdruck auf?
Welche Faktoren trugen zu seiner Entwicklung als Massenmedium bei, und welche
Strukturen entstanden während dieser Zeit? Wie veränderte sich das Buch durch die
massenhafte Herstellung? Die vorliegende Arbeit möchte mit einer Übersicht durch in
die Forschungsliteratur zum Thema und ihrer Interpretation hinsichtlich der Fragestellung
Einblick in diese Problematik geben.
Inhaltsverzeichnis
- Zur Fragestellung
- Die Erfindung des Buchdrucks
- Die historische Situation als Marktgrundlage
- Der Humanismus und das gesteigerte Bildungsbedürfnis
- Die Reformation und das Religionsbedürfnis der Massen
- Die Handschrift als Vorbild und Basis des Buchdrucks
- Herstellung und Gestaltung
- Vertrieb und Vermarktung
- Werbewirksame Gestaltung des gedruckten Buches
- Titel und Titelblatt
- Vorrede und Dedikation
- Themen und Inhalte
- Illustration
- Drucker- und Verlagssignete
- Weitere Merkmale der der Druckgestaltung
- Raubdrucke und Privilegien
- Werbemittel
- Bücheranzeigen - Einzelprospekte und Sammelverzeichnisse
- Kataloge
- „Zur Literatur Gehörige“ – Vermarktende Berufszweige
- Textproduktion: Die Autoren
- Personalunion in der Vermarktung: Die Drucker-Verleger
- Die Entwicklung des Verlagswesens: Differenzierung in Drucker und Verleger
- Vertreibende Berufe: Buchführer, Kommissionäre und Sortimenter
- Der Vertrieb - Von Messen und Märkten zum stationären Handel
- Der ambulante Verkauf am Beispiel der Frankfurter Buchmesse
- Vertrieb zwischen den Messen – Die Entwicklung des stationären Buchhandels
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit der Literaturvermarktung im Spätmittelalter und der Frühen Neuzeit. Sie analysiert die Entwicklungen, die zur Erfindung des Buchdrucks führten, die strukturellen Voraussetzungen, welche den Buchdruck als Massenmedium ermöglichten, sowie die Veränderungen, die das Buch durch die Massenproduktion erfuhr.
- Die Erfindung des Buchdrucks als Reaktion auf das steigende Bildungs- und Religionsbedürfnis
- Die Rolle der Handschrift als Vorbild und Basis für den Buchdruck
- Die Gestaltung des gedruckten Buches als Marketinginstrument
- Die Herausforderungen des Raubdrucks und die Entwicklung von Schutzmechanismen
- Die Entwicklung von Werbemitteln und Berufsgruppen in der Literaturvermarktung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel behandelt die Fragestellung und den historischen Kontext der Arbeit. Kapitel zwei beleuchtet die Erfindung des Buchdrucks durch Johannes Gutenberg und die Gründe für diese Entwicklung. Kapitel drei analysiert die zeitgenössischen Begleitumstände, darunter den Einfluss von Humanismus und Reformation auf das Bildungs- und Religionsbedürfnis. Kapitel vier befasst sich mit der Handschrift als Grundlage des Buchdrucks. Kapitel fünf beleuchtet die vermarktungsorientierte Gestaltung des gedruckten Buches mit Fokus auf Titel, Titelblatt, Vorrede, Dedikation, Themen, Illustration, Drucker- und Verlagssignete sowie weiteren Gestaltungsmerkmalen.
Schlüsselwörter
Literaturvermarktung, Buchdruck, Spätmittelalter, Frühe Neuzeit, Handschrift, Raubdruck, Werbemittel, Buchhandel, Verlagswesen, Frankfurter Buchmesse
Häufig gestellte Fragen
Was waren die Voraussetzungen für die Erfindung des Buchdrucks?
Entscheidend waren das durch Humanismus und Reformation gesteigerte Bildungs- und Religionsbedürfnis sowie die technischen Grundlagen, die teilweise auf der Handschriftenproduktion basierten.
Wie wurde das gedruckte Buch als Marketinginstrument gestaltet?
Durch die Einführung von Titelblättern, Vorreden, Dedikationen (Widmungen), Illustrationen sowie Drucker- und Verlagssigneten wurde das Buch optisch und inhaltlich für Käufer attraktiver gemacht.
Welche Rolle spielten Raubdrucke in der Frühen Neuzeit?
Raubdrucke waren eine große Herausforderung für Verleger. Als Schutzmechanismen entwickelten sich Privilegien, die Druckern exklusive Rechte an bestimmten Texten einräumten.
Welche Werbemittel entstanden für den Buchhandel?
Es wurden Bücheranzeigen, Einzelprospekte, Sammelverzeichnisse und erste Kataloge genutzt, um Neuerscheinungen bekannt zu machen.
Wie veränderte sich der Buchvertrieb historisch?
Der Vertrieb wandelte sich vom ambulanten Verkauf auf Messen (wie der Frankfurter Buchmesse) hin zur Entwicklung eines stationären Buchhandels mit spezialisierten Berufen wie Buchführern und Sortimentern.
- Quote paper
- Sabine Wirsching (Author), 2008, Literaturvermarktung in Spätmittelalter und Früher Neuzeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/160326