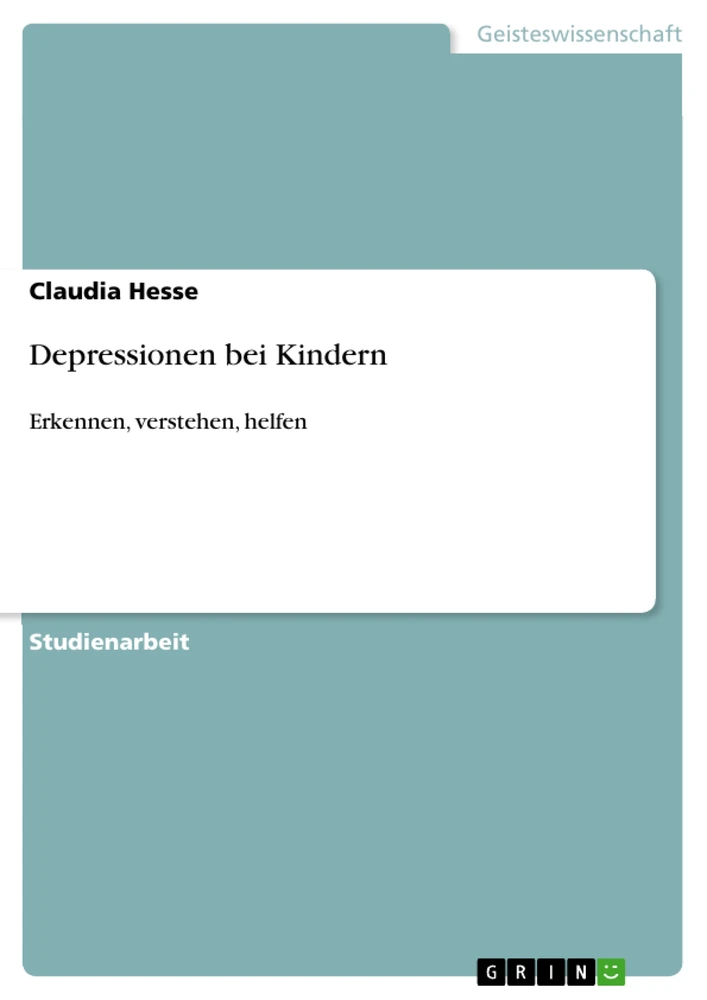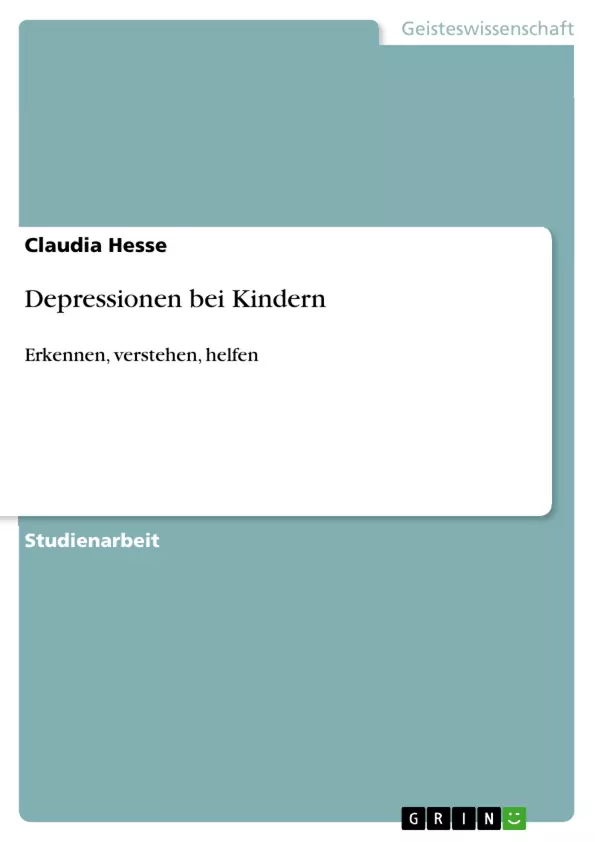1 Einleitung
„Da wachsen Kinder auf an Fensterstufen – und wissen nicht, daß (sic!) draußen Blumen rufen – an einem Tag voll Weite, Glück und Wind – und müssen Kind sein und sind traurig Kind.“
Anhand dieses Zitats von Rainer Maria Rilke soll verdeutlicht werden, von welch großer Bedeutung es ist, sich mit dem Phänomen Depressionen bei Kindern zu befassen.
Lange wurde die Ansicht vertreten, dass keine Depressionen im klinischen Sinne aufgrund der unzureichenden kognitiven Reife auftreten können, da die Abweichungen zu einer Erwachsenendepression sich erheblich von der des Kindes unterscheiden. Erst in den letzten Jahren wurde diese These durch Forschung in diesem Bereich widerlegt, Depressionen wurden bei Kindern als eigenständiges Krankheitsbild anerkannt. Es ist ein wertvoller Beitrag, wenn es den Sozialpädagogen gelingt, die aus den Depressionen resultierenden Suizidversuche gänzlich zu verhindern.
Ziel der vorliegenden Hausarbeit ist es, sich mit dem Thema ‚Depressionen‘ bei Kindern auseinanderzusetzen. Schwerpunkt bildet dabei die Erörterung des genannten Themas, der mit den nachfolgenden Fragestellungen verknüpft werden soll: was kennzeichnet Kinder mit depressiven Störungen? Welche Ursachen und Auslöser sind für die Entstehung depressiver Störungen verantwortlich? Mit welchem Behandlungs- und Präventionsprogramm kann die Soziale Arbeit einschreiten, um diese Problematik zu mindern und/oder gänzlich zu verhindern?
Zunächst erfolgt eine Definition des Begriffes ‚Depression‘ bei Kindern. Außerdem wird dargelegt, wie sich die Depression von Kindern zu Erwachsenen unterscheidet. Nachfolgend werden die entwicklungsspezifischen Symptome aufgezeigt. Zudem soll deutlich werden, woraus sich Depressionen entwickeln. Es gibt mehrere psychologisch-therapeutische Behandlungsansätze – in dieser Hausarbeit werden die Spieltherapie und Verhaltenstherapie thematisiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Depressionen bei Kindern
- Definition Depression
- Klassifikation klinischer Störungsbilder
- Entwicklungsspezifische Symptomatik
- Im Kleinkindalter (1 - 3 Jahre)
- Im Vorschulalter (3 - 6 Jahre)
- Im Schulalter (ab 6 Jahre)
- Ätiologie der Kindheitsdepression
- Spieltherapie
- Kognitive Verhaltenstherapie
- Kognitives Umstrukturieren
- Entspannungstraining
- Angenehme Aktivitäten planen
- Problemlösungsfähigkeiten trainieren
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich mit dem Thema Depressionen bei Kindern und untersucht die verschiedenen Aspekte dieser psychischen Störung. Dabei werden die spezifischen Merkmale depressiver Störungen bei Kindern im Vergleich zu Erwachsenen erörtert, sowie die Ursachen und Auslöser dieser Krankheit analysiert. Im Fokus steht insbesondere die Rolle der Sozialen Arbeit bei der Behandlung und Prävention von Depressionen im Kindesalter.
- Definition und Klassifikation von Depressionen bei Kindern
- Entwicklungsspezifische Symptome depressiver Störungen im Kindesalter
- Ätiologie der Kindheitsdepression: Ursachen und Auslöser
- Psychologische Behandlungsansätze: Spieltherapie und kognitive Verhaltenstherapie
- Rolle der Sozialen Arbeit bei der Prävention und Intervention von Depressionen bei Kindern
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Relevanz der Thematik anhand eines Zitates von Rainer Maria Rilke und setzt den historischen Kontext der Diskussion um Depressionen im Kindesalter. Anschließend wird die Zielsetzung der Hausarbeit definiert und die relevanten Fragestellungen formuliert.
Kapitel 2 befasst sich mit der Definition und Klassifikation von Depressionen bei Kindern. Es werden die charakteristischen Symptome einer depressiven Störung, wie Niedergeschlagenheit, Lustlosigkeit und Schlafstörungen, erläutert. Darüber hinaus werden die verschiedenen Klassifikationssysteme, wie ICD-10 und DSM-IV, vorgestellt und die Unterschiede in der Symptomatik zwischen Erwachsenen und Kindern beleuchtet.
Kapitel 2.3 setzt sich mit der Entwicklungsspezifischen Symptomatik von Depressionen bei Kindern auseinander. Hier werden die unterschiedlichen Erscheinungsformen der Krankheit in Abhängigkeit vom Alter des Kindes, von der Kleinkindphase bis zum Schulalter, detailliert betrachtet.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter der Hausarbeit sind: Depression, Kinder, Entwicklungsspezifische Symptomatik, Ätiologie, Spieltherapie, Kognitive Verhaltenstherapie, Soziale Arbeit, Prävention, Intervention.
Häufig gestellte Fragen
Können Kinder klinische Depressionen haben?
Ja, Depressionen bei Kindern sind heute als eigenständiges Krankheitsbild anerkannt, auch wenn sich die Symptome von denen Erwachsener unterscheiden können.
Wie äußert sich eine Depression bei Kleinkindern (1-3 Jahre)?
Symptome können hier Spielunlust, verminderte Mimik, verstärktes Weinen oder auch Ess- und Schlafstörungen sein.
Was sind die Ursachen für Depressionen im Kindesalter?
Die Ätiologie ist vielfältig und umfasst genetische Faktoren, belastende Lebensereignisse, familiäre Probleme oder Traumata.
Wie hilft Spieltherapie bei depressiven Kindern?
Spieltherapie ermöglicht es Kindern, ihre Gefühle und Konflikte symbolisch auszudrücken, die sie verbal oft noch nicht formulieren können.
Welche Rolle spielt die Soziale Arbeit bei diesem Thema?
Sozialpädagogen leisten einen wertvollen Beitrag durch Präventionsprogramme, Beratung der Eltern und Interventionen zur Vermeidung von Suizidversuchen.
- Citation du texte
- Claudia Hesse (Auteur), 2010, Depressionen bei Kindern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/160329