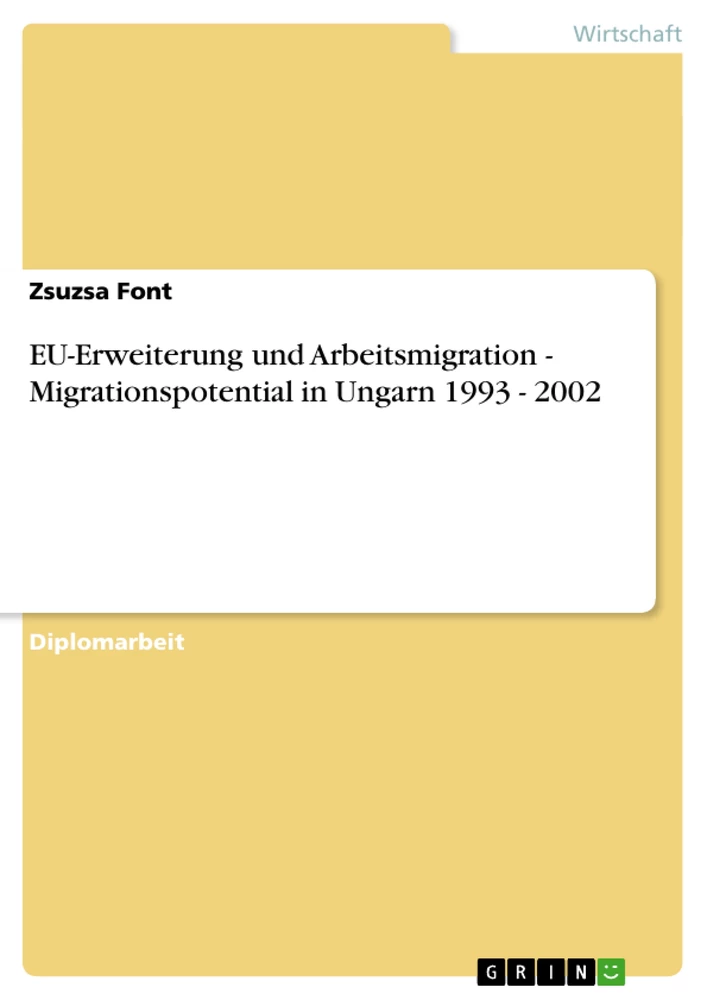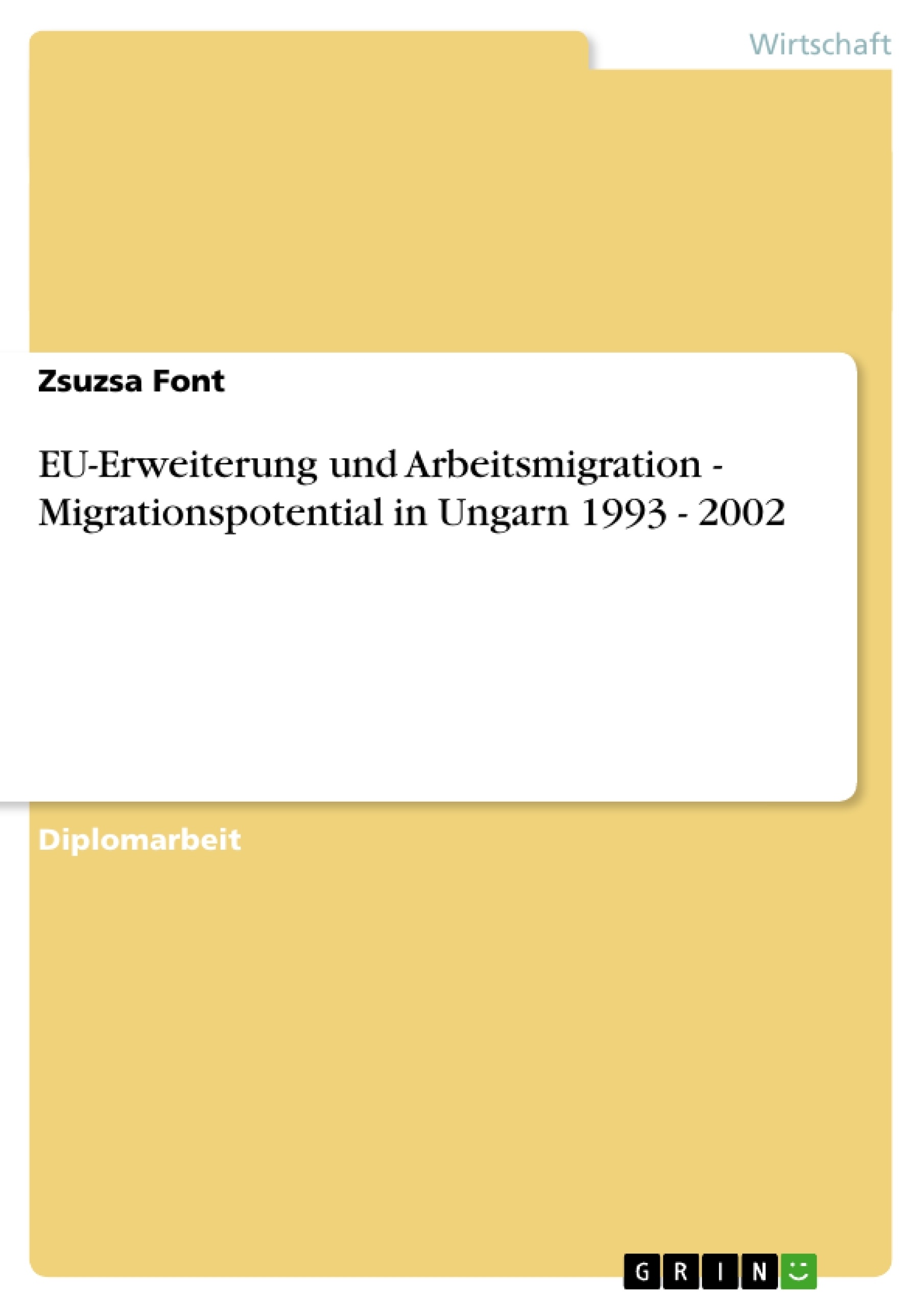[...] Mit der Vollmitgliedschaft erhalten die
Beitrittskandidaten nach Übergangsfristen die vier Grundfreiheiten des gemeinsamen
Marktes: freier Verkehr von Waren, Kapital, Dienstleistungen und Personen. Der freie
Personenverkehr wird im Osten und Westen Europas als besonders wichtiger
Verhandlungsgegenstand gesehen.
In den bisherigen EU-Ländern herrscht trotz der Übergangsfristen Angst darüber, dass
nach dem Wegfall rechtlicher Migrationsschranken1 die Lage auf den westeuropäischen
Arbeitsmärkten weiter verschärft und die mögliche Magnetwirkung des umfangreichen
Angebots an staatlich bereitgestellten Gütern und Sozialleistungen der Marktwirtschaften
der EU zu einer Massenwanderung von Ost- nach Westeuropa führe.
Auf Seiten der Beitrittskandidaten hingegen besteht die Hoffnung, den westeuropäischen
Arbeitsmarkt zu erschließen und dadurch die heimischen Arbeitsmarktprobleme zu
mildern. Die Beitrittskandidaten befürchten aber, dass die Abwanderung vor allem
hochqualifizierte Arbeitskräfte betreffen könnte.(Nö. Grenzland News S.18.)
Diese Arbeit beschäftigt sich mit Schätzungen des Migrationspotentials2 im Zuge der EUOsterweiterung.
Im Fokus steht das Migrationspotential Ungarns.
Es werden zunächst der Stand der Beitrittsverhandlungen und dann die wichtigsten
Migrationstheorien dargestellt. Des Weiteren wird ein Überblick über die Ergebnisse
ausgewählter Befragungen und strukturelle Schätzungen im Thema Migration nach der
EU-Erweiterung präsentiert.
Das vierte Kapitel der Arbeit, das sich mit dem Migrationspotential Ungarns beschäftigt
basiert hauptsächlich auf zwei Quellen. Dies sind zum einen die Ergebnisse der
Mehrthemenbefragungen des TARKI Forschungsinstitutes aus den Jahren 2000, 2001 und
20023. Zum anderen ist dies die Abschlussstudie des Ungarischen Haushaltspanels (HHP) aus dem Jahre 1998. (Sik E. 1998; 133-152) Die Ergebnisse dieser Erhebungen werden
ausführlich dargestellt, miteinander verglichen und abschließend in einem Fazit
zusammengefasst.
1 Migration bedeutet alle Wanderungsbewegungen von Menschen – Individuen oder Gruppen, die ihren
bisherigen Wohnsitz längerfristig oder dauerhaft wechseln, unabhängig von den Motiven oder Ursachen,
welche die Verlagerung des Wohnsitzes zugrunde liegen (Koch 2001)
2 Migrationspotential ist ein Proportionszeiger, mit dem gezeigt wird, wie viel Prozent der Bevölkerung
eine Migration plant ( Sik 1998; 133)
3 1. Tarki 2000; 10-11 2. Tarki 2001 3. Bernat A. Tarki 2002; 3-21
Inhaltsverzeichnis
- I. EINLEITUNG.
- 1. DER STAND DER BEITRITTSVERHANDLUNGEN.
- 2. ÜBERGANGSFRIST BEI DER ARBEITSNEHMERFREIZÜGIGKEIT.
- II. THEORETISCHE ANSÄTZE ZUR ERKLÄRUNG VON MIGRATION.
- 1. KLASSISCHE ERKLÄRUNGSANSÄTZE IN DER MIGRATIONSFORSCHUNG
- 1.1. Makroökonomische Ansätze..
- 1.2. Neoklassische Mikroökonomische Theorien
- 2. DIE NEUE MIGRATIONSÖKONOMIE
- 2.1. Neuere Ansätze in der Migrationsforschung..
- 2.1.1. Transnationale Migration.
- 2.1.2. Migrationssysteme
- 2.1.3. Soziale Netzwerke
- 2.1.4. Soziales Kapital...
- 3. ZUSAMMENFASSUNG DER THEORIEN, ALLGEMEIN BEEINFLUSSENDE FAKTOREN DER MIGRATION.
- III. ERGEBNISSE INTERNATIONALER ERHEBUNGEN IM THEMA MÖGLICHE MIGRATION NACH DER EU- ERWEITERUNG
- 1. QUANTITATIVE ÖKONOMETRISCHE BERECHNUNGEN..
- 2. BEFRAGUNGEN.
- IV. MIGRATIONSPOTENTIAL IN UNGARN 1993 - 2002
- 1. DIE QUELLEN
- 1.1 Das Ungarische Haushaltspanel...
- 1.2. Mehrthemenbefragungen des TARKI Institutes
- 1.2.1. Die CEORG Erhebungen in den Jahren 2000 und 2001
- 1.2.2. Erhebung des TARKI Institutes im Jahre 2002.
- 2. ERGEBNISSE DER ERHEBUNGEN.
- 2.1. Ergebnisse des HHPs..
- 2.1.1. Migrationspotential in Ungarn in den Jahren 1993, 1994 und 1997.
- 2.1.2. Die relevante Bevölkerung...
- 2.1.3. Charakteristika möglicher Migranten...
- 2.1.3.1. Alter...
- 2.1.3.2. Geschlecht..
- 2.1.3.3. Qualifikation.
- 2.1.3.4. Berufstätigkeit, wirtschaftliche Aktivität.
- 2.1.3.5. Gesellschaftliche Züge.
- 2.1.3.6. Das Migrationsnetzwerk.
- 2.1.3.7. Andere migrationsbeeinflussende Faktoren.
- 2.1.4. Mögliche Zielländer.
- 2.1.5. Zusammenhang zwischen der Richtung des Migrationnetzwerkes und der Auswahl des möglichen Ziellandes.
- 2.2. Ergebnisse des TARKI Institutes bezüglich Ungarn.
- 2.2.1. Migrationspotential in Ungarn in den Jahren 2000, 2001 und 2002.
- 2.2.2. Perspektiven des Dableibens...
- 2.2.3. Strukturmerkmale möglicher Migranten.
- 2.2.4. Mögliche Zielländer..
- 3. GEMEINSAMKEITEN UND UNTERSCHIEDE IN DEN ERHEBUNGEN.
- 3.1. Die Fragestellung und die Antwortmöglichkeiten......
- 3.1.1. Bei dem Haushaltspanel.........
- 3.1.2. Bei den TARKI - Erhebungen.
- 3.2. Kategorien der Migrationsdauer.
- 3.3. Die Altersuntergrenze.
- 3.4. Vergleich der Ergebnisse.
- 3.4.1. Das Migrationspotential.
- 3.4.2. Charakteristika potentieller Migranten
- 3.4.3. Mögliche Zielländer.
- 4. VERGLEICH DES MIGRATIONSPOTENTIALS IN UNGARN MIT DEM MIGRATIONSPOTENTIAL IN TSCHECHIEN UND POLEN.
- 4.1. Interesse an Arbeitsmigration.....
- 4.2. Dauer des möglichen Aufenthaltes....
- 4.3. Mögliche Zielländer.....
- V. WEITERE FAKTOREN, DIE DAS MIGRATIONSPOTENTIAL BEI BEFRAGUNGEN BEEINFLUSSEN – AM BEISPIEL VON DER ERHEBUNG VON FASSMANN.
- 5.1. Die Fragestellung.
- 5.2. Aktivitäten hinsichtlich der Migration
- 5.3. Mögliche Zielländer.
- 5.4. Transformierung des Bestandes in einer „,Flow-Aussage“.
- 5.5. Fassmanns Erhebung..
- VI. ZUSAMMENFASSUNG..
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Thema der Arbeitsmigration im Kontext der EU-Erweiterung, wobei der Fokus auf das Migrationspotenzial Ungarns zwischen 1993 und 2002 liegt. Ziel ist es, die möglichen Migrationsströme aus Ungarn in die EU-15-Staaten zu analysieren und die wichtigsten Faktoren, die diese Migration beeinflussen, zu identifizieren.
- Theoretische Ansätze zur Erklärung von Migration
- Migrationspotenzial in Ungarn anhand von Erhebungsdaten
- Vergleich des Migrationspotenzials Ungarns mit Tschechien und Polen
- Einflussfaktoren auf das Migrationspotenzial
- Analyse der möglichen Zielländer
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, in der der Stand der Beitrittsverhandlungen und die Übergangsregelung für die Freizügigkeit von Arbeitnehmern erläutert werden. Anschließend werden theoretische Ansätze zur Erklärung von Migration vorgestellt, wobei sowohl klassische als auch neuere Ansätze, wie z.B. die neue Migrationsökonomie, betrachtet werden. Im dritten Kapitel werden Ergebnisse internationaler Erhebungen zum Thema mögliche Migration nach der EU-Erweiterung vorgestellt. Das vierte Kapitel analysiert das Migrationspotenzial in Ungarn anhand von Daten des Ungarischen Haushaltspanels und des TARKI Institutes, wobei insbesondere die Charakteristika möglicher Migranten und die möglichen Zielländer untersucht werden. Im fünften Kapitel werden weitere Faktoren, die das Migrationspotenzial beeinflussen, am Beispiel der Erhebung von Fassmann betrachtet. Die Arbeit endet mit einer Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit Themen wie EU-Erweiterung, Arbeitsmigration, Migrationspotenzial, Ungarn, Tschechien, Polen, theoretische Ansätze, quantitative ökonometrische Berechnungen, Befragungen, Haushaltspanel, TARKI Institut, CEORG Erhebung, Migrationsnetzwerk, Zielländer, Einflussfaktoren.
Häufig gestellte Fragen
Wie hoch war das Migrationspotenzial in Ungarn zwischen 1993 und 2002?
Die Arbeit analysiert Daten des TARKI-Instituts und des Haushaltspanels, um den Prozentsatz der ungarischen Bevölkerung zu schätzen, der eine Abwanderung in die EU plante.
Was waren die Hauptgründe für die Angst vor Massenwanderung in der EU?
In Westeuropa fürchtete man eine Verschärfung der Lage auf den Arbeitsmärkten und eine "Magnetwirkung" der Sozialsysteme nach dem Wegfall von Migrationsschranken.
Welche Merkmale hatten potenzielle ungarische Migranten?
Die Analyse zeigt, dass vor allem jüngere, männliche und oft hochqualifizierte Personen ein höheres Interesse an Arbeitsmigration zeigten.
Welche Länder waren die bevorzugten Zielorte für Ungarn?
Die Studie untersucht die beliebtesten Zielländer innerhalb der EU-15, wobei geografische Nähe und bestehende soziale Netzwerke eine große Rolle spielten.
Was befürchteten die Beitrittskandidaten selbst bei der Migration?
Es bestand die Sorge vor einem "Brain Drain", also dem Verlust hochqualifizierter Arbeitskräfte, die für den heimischen Aufbau wichtig gewesen wären.
- Arbeit zitieren
- Zsuzsa Font (Autor:in), 2003, EU-Erweiterung und Arbeitsmigration - Migrationspotential in Ungarn 1993 - 2002, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/16034