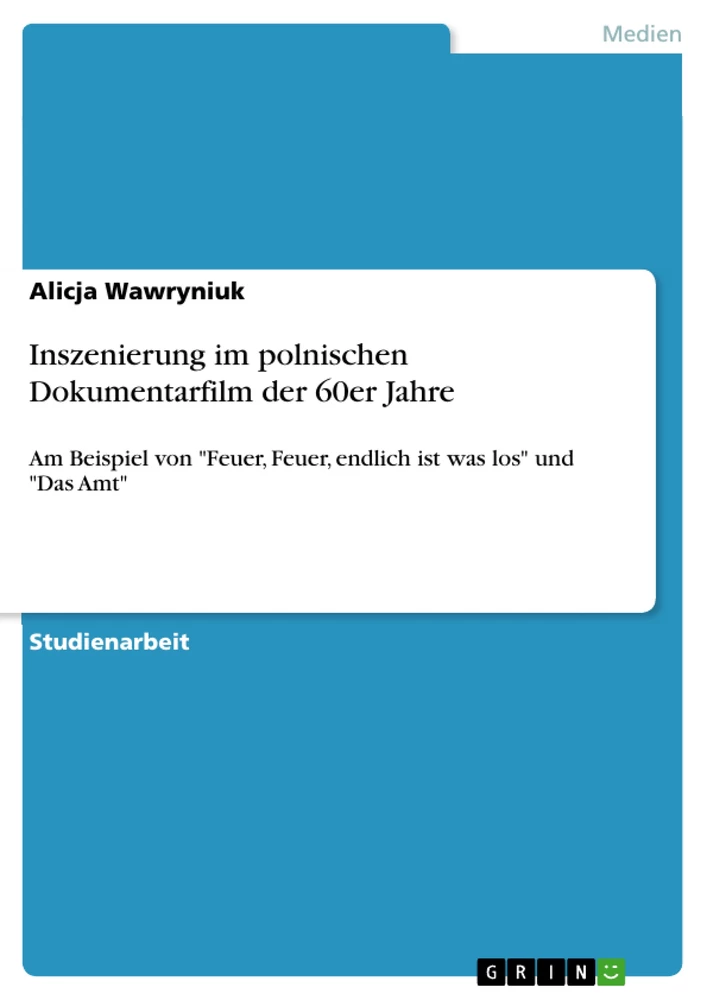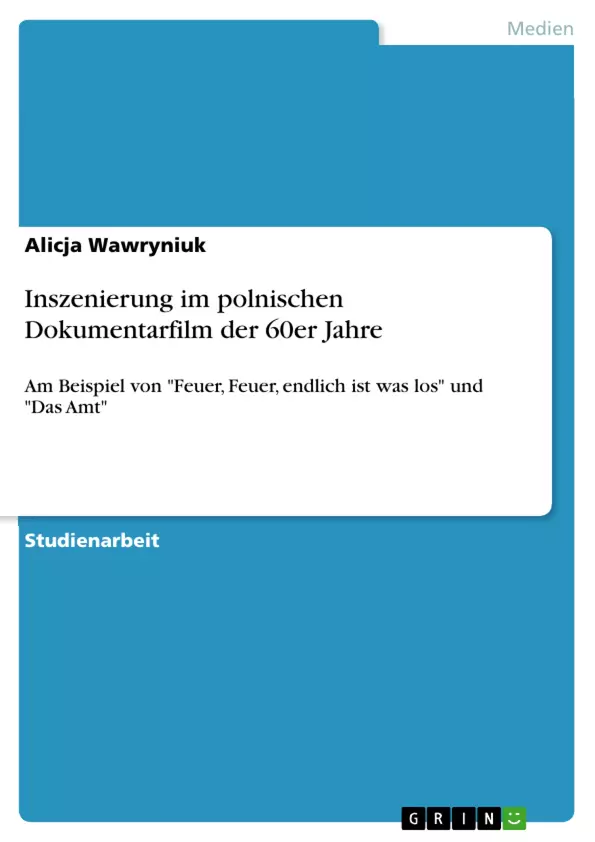Der polnische Dokumentarfilm strebte schon immer an, sich von einer Reportage zu unterscheiden. Krzysztof Kieślowski und Marek Piwowski verdienen einen Vergleich, weil sie mit dem Dokumentarfilm ihre Karriere begannen, während zum Beispiel Krzysztrof Zanussi im Spielfilm debütierte. Laut Hans-Joachim Schlegel gäbe es eine enge Beziehung zwischen den beiden Gattungen.
Sowohl „Feuer, Feuer, endlich ist was los“ (Pożar, pożar, nareszcie coś się dzieje, 1967) von Marek Piwowski als auch „Das Amt“ (Urząd, 1966) von Krzysztof Kieślowski kommen aus der zweiten Hälfte der 60er Jahre, die in Polen wie auch in vielen osteuropäischen Ländern etwas Neues versprachen und zu bedeutenden Veränderungen und Reformen führten. Beide Filme sind in der Tradition des inszenierten Dokumentarfilms entstanden.
Gleichzeitig beschreiben sie die gesellschaftliche Situation der 60er Jahre in Polen. Sie zeigen, wie schwierig und kompliziert Dinge gemacht werden, die viel einfacher zu lösen sind.
Inhaltsverzeichnis
- Zum Geleit
- 1. Historischer Rahmen des polnischen Dokumentarfilms der 60er Jahre
- 2. Inszenierung im polnischen Dokumentarfilm der 60er Jahre?
- 3. „Feuer, Feuer, endlich ist was los“, 1967.
- 3.1 Beschreibung
- 3.2 Eine Art Satire
- 4. „Das Amt“ (Urząd), 1966.
- 4.1 Die Handlung
- 4.2 Die Wirklichkeit beschreiben
- 5. Schlußwort
- 6. Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert die Inszenierung im polnischen Dokumentarfilm der 60er Jahre am Beispiel von „Feuer, Feuer, endlich ist was los“ von Marek Piwowski und „Das Amt“ von Krzysztof Kieślowski. Sie untersucht, wie die beiden Filme die gesellschaftliche Situation der 60er Jahre ironisieren und die traditionelle Inszenierungsform des Dokumentarfilms erweitern.
- Die Rolle der Inszenierung im polnischen Dokumentarfilm der 60er Jahre
- Der Einsatz von Montage und Ironie zur Darstellung der gesellschaftlichen Realität
- Der Einfluss des politischen und gesellschaftlichen Umfelds auf die Filmgestaltung
- Der Vergleich der Inszenierungstechniken von Piwowski und Kieślowski
- Die Bedeutung des "Point of View" im Dokumentarfilm
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet den historischen Rahmen des polnischen Dokumentarfilms der 60er Jahre und stellt die beiden untersuchten Filme vor. Sie betont, dass der polnische Dokumentarfilm sich von einer reinen Reportage abheben wollte und dass die beiden Regisseure Kieślowski und Piwowski mit ihrem Werk den inszenierten Dokumentarfilm prägten.
Kapitel 1 beleuchtet den historischen Rahmen des polnischen Dokumentarfilms der 60er Jahre. Es beschreibt die politischen Veränderungen in Polen und den Einfluss des Stalinismus auf die Filmindustrie. Die Entwicklung des Dokumentarfilms im Kontext der politischen und gesellschaftlichen Veränderungen wird beleuchtet.
Kapitel 2 beschäftigt sich mit der Frage der Inszenierung im polnischen Dokumentarfilm der 60er Jahre. Es wird erörtert, wie sich die Inszenierung im Dokumentarfilm von der im Spielfilm unterscheidet und welche Rolle der "Point of View" des Regisseurs spielt.
Kapitel 3 analysiert den Film "Feuer, Feuer, endlich ist was los" von Marek Piwowski. Es werden die Beschreibung des Films, die Verwendung von Satire und der Einsatz von Montage als Mittel der Inszenierung erörtert.
Kapitel 4 beleuchtet den Film "Das Amt" von Krzysztof Kieślowski. Es werden die Handlung des Films, die Darstellung der polnischen Bürokratie und der Einsatz von Montage als Mittel der Inszenierung vorgestellt.
Schlüsselwörter
Inszenierung, polnischer Dokumentarfilm, 60er Jahre, Montage, Ironie, gesellschaftliche Situation, politische Veränderungen, "Feuer, Feuer, endlich ist was los", "Das Amt", Marek Piwowski, Krzysztof Kieślowski, "Point of View".
Häufig gestellte Fragen
Welche Regisseure stehen im Mittelpunkt dieser Analyse zum polnischen Film?
Die Arbeit vergleicht die frühen Dokumentarfilmwerke von Krzysztof Kieślowski und Marek Piwowski.
Welche Filme werden in der Hausarbeit untersucht?
Untersucht werden „Das Amt“ (Urząd, 1966) von Kieślowski und „Feuer, Feuer, endlich ist was los“ (1967) von Piwowski.
Was ist das Besondere am polnischen Dokumentarfilm der 60er Jahre?
Er strebte danach, mehr als eine bloße Reportage zu sein, und nutzte Inszenierung, Montage und Ironie, um die gesellschaftliche Realität darzustellen.
Wie wird die polnische Bürokratie in diesen Filmen dargestellt?
Die Filme zeigen auf satirische Weise, wie einfache Probleme durch bürokratische Hürden unnötig verkompliziert werden.
Welchen Einfluss hatte das politische Umfeld auf die Filme?
Die Filme entstanden in einer Zeit des Wandels nach dem Stalinismus, in der neue künstlerische Ausdrucksformen und gesellschaftliche Kritik möglich wurden.
- Quote paper
- M.A. Alicja Wawryniuk (Author), 2002, Inszenierung im polnischen Dokumentarfilm der 60er Jahre, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/160341