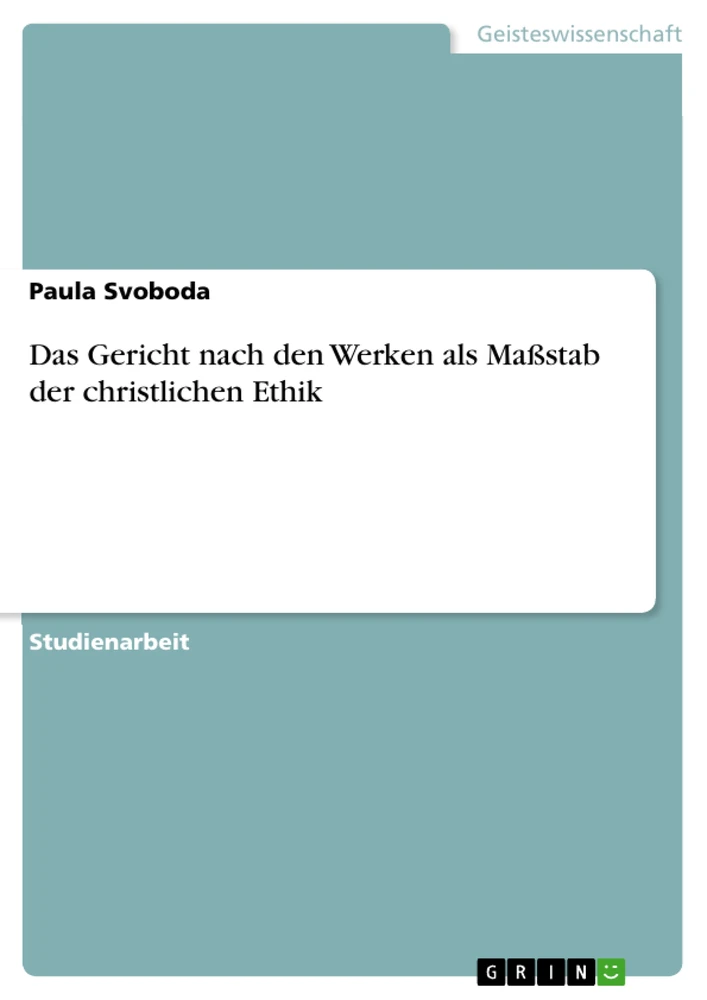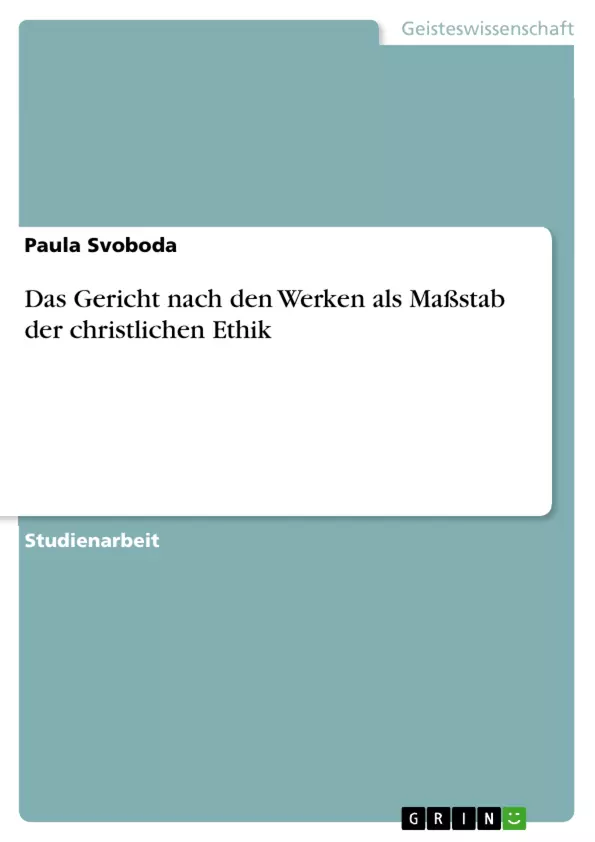Die jahrhundertelange Uneinigkeit zwischen evangelischer und katholischer Theologie dar-über, welche Rolle die guten Werke im Heilsgeschehen einnehmen, ob, wie es die reformato-rische Tradition lehrt, eine Rechtfertigung aus Werken grundsätzlich ausgeschlossen ist oder, so die Ansicht der katholischen Lehrtradition, ob der Christ durch gute Werke seine Seligkeit und Rechtfertigung im Endgericht verdienen muss, bleibt trotz einiger Versöhnungsversuche bestehen. Dieser Streitpunkt hat seine Ursprünge nicht zuletzt in dem widersprüchlichen Zeugnis der Paulusbriefe. Der Apostel Paulus, der als erster den Glauben der Gemeinde theo-logisch hinterfragt und reflektiert hat, scheint uns eine unauflösbare Antinomie hinterlassen zu haben, wenn er einerseits schreibt: „Denn wir urteilen, dass der Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke.“ (Röm 3,28); „Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht: 'Der Gerechte aber wird aus Glau-ben leben'.“ (Röm 1,17); „Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen (…).“ (Röm 5,1f.); andererseits findet man bei ihm folgende Aussagen: „Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses.“ (2. Kor 5,10); „Nach deiner Störrigkeit und deinem un-bußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenba-rung des gerechten Gerichtes Gottes, der einem jeden vergelten wird nach seinen Werken.“ (Röm 2, 5f.). Es scheint so, als wäre sich Paulus dieser Widersprüche nicht bewusst oder als hätte er einen Ausgleich nicht für notwendig empfunden. Das überrascht, da diese Frage zent-ral für jeden Christen ist; denn jeder muss sich ja schließlich vor dem Letzten Gericht verant-worten – um aber im Gericht bestehen zu können, muss man wissen, was der Maßstab dieses Gerichts ist! Erst wenn ich es weiß, kann dieser Maßstab auch der Maßstab meiner ethischen Orientierung und meines Lebens sein.
Folgende Arbeit beschäftigt sich mit diesem Widerspruch und versucht, eine Antwort darauf zu finden, ob der Christ letztendlich nach guten Werken streben muss, um die Seligkeit zu empfangen, also: „Inwiefern kann das Gericht nach den Werken der Maßstab der christlichen Ethik sein?“
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Der neutestamentliche Befund
- a) Rechtfertigung aus Glauben
- b) Gericht nach den Werken
- c) 1. Kor 3,10-15
- d) Das Verhältnis zum Judentum und zu der Lehre Jesu
- e) Rück- und Vorausblick
- II. Die Analyse
- a) Die Interpretation in der Forschung – zwei Grundmuster
- b) Пíστiç bei Paulus - vertikale Dimension
- c) Пíστiç bei Paulus – horizontale Dimension
- d) Rückblick
- e) Kein Gegensatz zwischen Rechtfertigung und Gericht?
- Ergebnis und Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert den scheinbaren Widerspruch im paulinischen Denken zwischen Rechtfertigung aus Glauben und Gericht nach den Werken. Sie untersucht, ob und inwiefern das Gericht nach den Werken als Maßstab für die christliche Ethik gelten kann.
- Die Rolle der Werke im Heilsgeschehen
- Exegetische Analyse von Schlüsselversen in den Paulusbriefen
- Das Verhältnis von Rechtfertigung und Gericht in der Theologie des Paulus
- Die Bedeutung des Glaubens für die christliche Lebensführung
- Die ethische Relevanz des eschatologischen Gerichts
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt den Forschungsgegenstand vor, diskutiert die historische Kontroverse über Rechtfertigung und Werke sowie die Bedeutung des paulinischen Zeugnisses für die Frage.
- Kapitel I behandelt den neutestamentlichen Befund. Es werden zentrale Verse aus den Paulusbriefen exegetisch analysiert, insbesondere Röm 1,17; Röm 3,28; Röm 5,1f.; 2. Kor 5,10 sowie 1. Kor 3,10-15.
- Kapitel II analysiert die Interpretation der paulinischen Aussagen in der Forschung, untersucht die beiden Dimensionen des Glaubens bei Paulus - die vertikale Dimension (Glaube an Gott) und die horizontale Dimension (Glaube an Christus) - und beleuchtet die Frage, ob ein Gegensatz zwischen Rechtfertigung und Gericht besteht.
Schlüsselwörter
Rechtfertigung, Werke, Gericht, Glaube, Paulusbriefe, christliche Ethik, Heilsgeschehen, eschatologisches Gericht, Versöhnung, Gnade, Gottesgerechtigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der zentrale theologische Konflikt zwischen Glauben und Werken?
Es geht um die Frage, ob der Mensch allein durch Glauben gerechtfertigt wird (reformatorisch) oder ob gute Werke notwendig sind, um im Endgericht zu bestehen (katholische Tradition).
Welchen scheinbaren Widerspruch findet man in den Paulusbriefen?
Paulus schreibt einerseits, dass der Mensch ohne Gesetzeswerke durch Glauben gerechtfertigt wird (Röm 3,28), betont aber auch, dass Gott jedem vergelten wird nach seinen Werken (Röm 2,6).
Warum ist der Maßstab des Gerichts für die christliche Ethik wichtig?
Nur wenn ein Christ weiß, wonach er im Letzten Gericht beurteilt wird, kann dieser Maßstab zur Richtschnur für seine ethische Orientierung und Lebensführung werden.
Was bedeuten die vertikale und horizontale Dimension des Glaubens bei Paulus?
Die vertikale Dimension bezieht sich auf das Verhältnis zu Gott, während die horizontale Dimension den Glauben an Christus und dessen Auswirkungen auf das menschliche Miteinander beschreibt.
Gibt es laut der Analyse einen echten Gegensatz zwischen Rechtfertigung und Gericht?
Die Arbeit untersucht, ob beide Konzepte bei Paulus zusammengehören und wie der Glaube zwangsläufig zu einem Handeln führt, das im Gericht Bestand hat.
Welche Rolle spielt die Gnade in diesem Zusammenhang?
Gnade ist die Basis der Rechtfertigung, doch das eschatologische Gericht bleibt die Instanz, die die Ernsthaftigkeit und Realität der christlichen Lebensführung prüft.
- Quote paper
- Paula Svoboda (Author), 2010, Das Gericht nach den Werken als Maßstab der christlichen Ethik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/160577