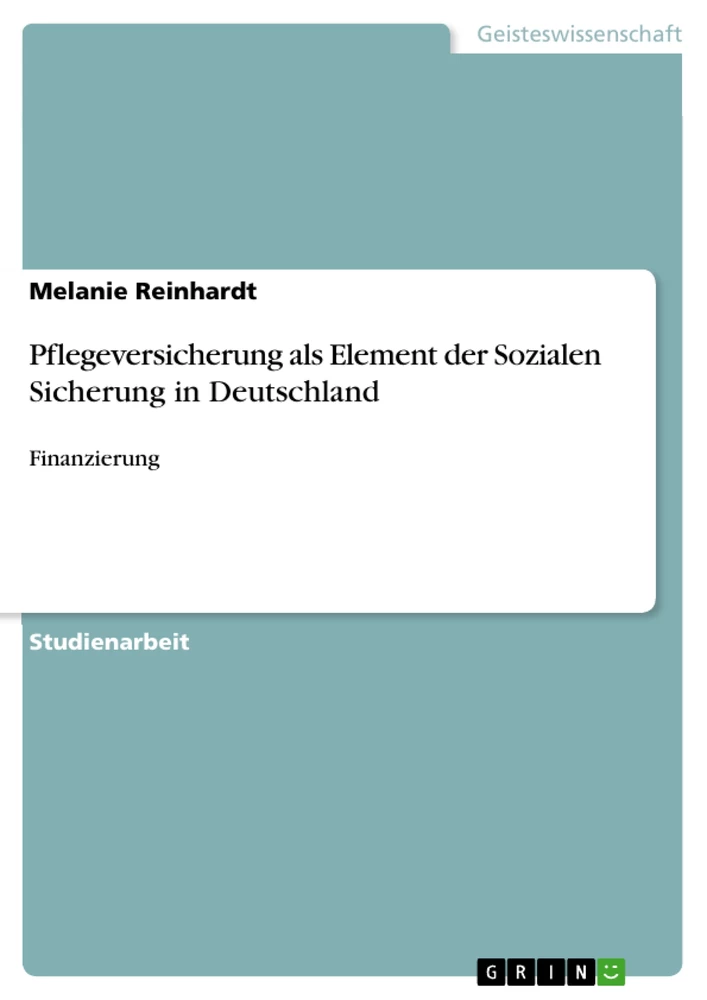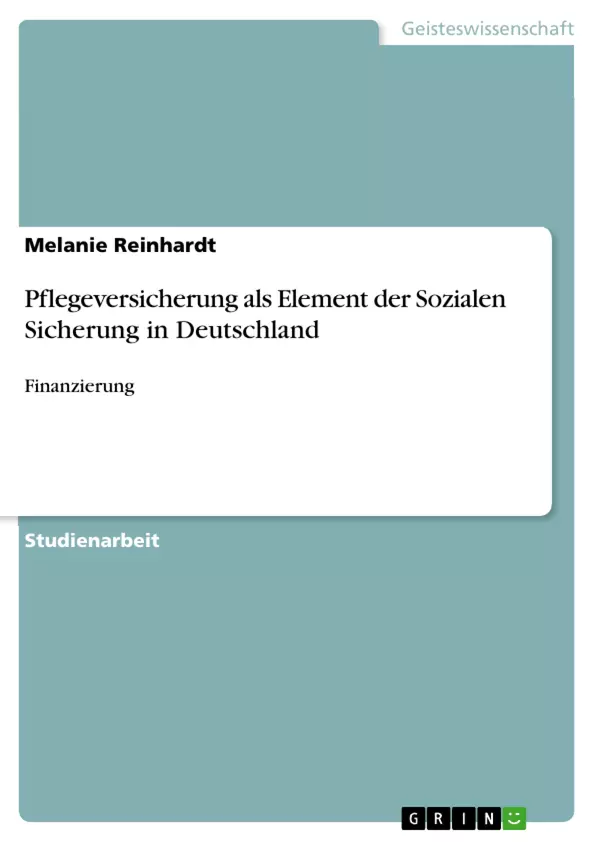Die Pflegeversicherung wurde zum 1. Januar 1995 als fünfte Säule der Sozialver-sicherung eingeführt, um die bis dahin für die Pflege verantwortliche Sozialhilfe finanziell zu entlasten. Seitdem sind nun 14 Jahre vergangen und es bleibt die Frage zu stellen, wie es um die Pflegeversicherung im Jahr 2009 steht. „Ob es besser wird, wenn es anders wird, weiß ich nicht. Dass es anders werden muss, wenn es besser werden soll, ist gewiss.“(Lichtenberg (2008), S. 510.) Dieses Zitat von Georg Christoph Lichtenberg verdeutlicht die aktuelle Situation der Pflegeversicherung. Durch das steigende Defizit, das die Pflegeversicherung zu verzeichnen hat, werden die Rufe nach einer Reformierung des aktuellen Fi-nanzierungssystems immer lauter. Im Folgenden soll untersucht werden, wie es zu den Defiziten überhaupt gekommen ist und welche Reformvorschläge eine Alter-native zu dem bisherigen System sein könnten. Hierzu wird ausgehend von der Darstellung der Grundzüge des Finanzierungssystems der sozialen Pflegeversiche-rung und den damit verbundenen Problemen in Kapitel 2, in Kapitel 3 auf verschiedene Reformvorschläge näher eingegangen. Den Abschluss bildet ein Fa-zit der dargestellten Sachverhalte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Finanzierung der sozialen Pflegeversicherung
- Das gegenwärtige System der Finanzierung
- Struktur des Finanzierungssystems
- Einnahmen- und Ausgabenentwicklung seit 1995
- Auswirkungen der demografischen Entwicklung auf die Finanzierung
- Kritische Würdigung des aktuellen Finanzierungssystems
- Das gegenwärtige System der Finanzierung
- Vorschläge zur Reformierung der sozialen Pflegeversicherung
- Ansprüche an den Reformvorschlag
- Die Bürgerversicherung
- Charakterisierung des Reformvorschlages
- Abschließende Beurteilung des Vorschlages
- Reformvorschlag des Kronberger Kreises
- Charakterisierung des Vorschlages
- Abschließende Beurteilung des Vorschlages
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Referat befasst sich mit der Finanzierung der sozialen Pflegeversicherung in Deutschland und analysiert die Herausforderungen, die sich aus dem demografischen Wandel ergeben. Es werden die wichtigsten Punkte des aktuellen Finanzierungssystems beleuchtet und verschiedene Reformvorschläge kritisch bewertet.
- Struktur und Entwicklung des Finanzierungssystems der sozialen Pflegeversicherung
- Einfluss des demografischen Wandels auf die Finanzierung der Pflegeversicherung
- Kritikpunkte am aktuellen Finanzierungssystem
- Analyse verschiedener Reformvorschläge
- Zusammenfassende Bewertung der Sachverhalte
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der sozialen Pflegeversicherung ein und stellt die Relevanz der Thematik im Kontext des demografischen Wandels dar. Kapitel 2 befasst sich mit der Finanzierung der sozialen Pflegeversicherung, beleuchtet die Struktur des aktuellen Systems, die Einnahmen- und Ausgabenentwicklung seit 1995 und analysiert die Auswirkungen des demografischen Wandels auf die Finanzierung. Kapitel 3 präsentiert verschiedene Reformvorschläge zur sozialen Pflegeversicherung und geht auf deren Charakteristika und Bewertung ein. Das Fazit fasst die wesentlichen Punkte des Referates zusammen.
Schlüsselwörter
Soziale Pflegeversicherung, Finanzierung, Demografischer Wandel, Reformvorschläge, Bürgerversicherung, Kronberger Kreis, Sozialgesetzbuch XI, SPV, Einnahmen, Ausgaben, Defizit, Altenquotient.
Häufig gestellte Fragen
Wann wurde die Pflegeversicherung in Deutschland eingeführt?
Die soziale Pflegeversicherung wurde am 1. Januar 1995 als fünfte Säule der Sozialversicherung eingeführt.
Warum steht die Pflegeversicherung finanziell unter Druck?
Hauptgründe sind die demografische Entwicklung (steigender Altenquotient) und ein wachsendes Defizit zwischen Einnahmen und Ausgaben.
Was ist das Konzept der Bürgerversicherung?
Die Bürgerversicherung ist ein Reformvorschlag, bei dem alle Bürger (auch Beamte und Selbstständige) in ein gemeinsames System einzahlen, um die Finanzbasis zu verbreitern.
Welchen Reformvorschlag macht der Kronberger Kreis?
Der Kronberger Kreis schlägt marktorientierte Reformen vor, die oft eine stärkere Kapitaldeckung und mehr Eigenverantwortung vorsehen.
Wie wirkt sich der demografische Wandel konkret aus?
Durch die Überalterung der Gesellschaft gibt es immer weniger Beitragszahler, während die Zahl der Pflegebedürftigen und damit die Ausgaben stetig steigen.
- Quote paper
- Melanie Reinhardt (Author), 2009, Pflegeversicherung als Element der Sozialen Sicherung in Deutschland , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/160696