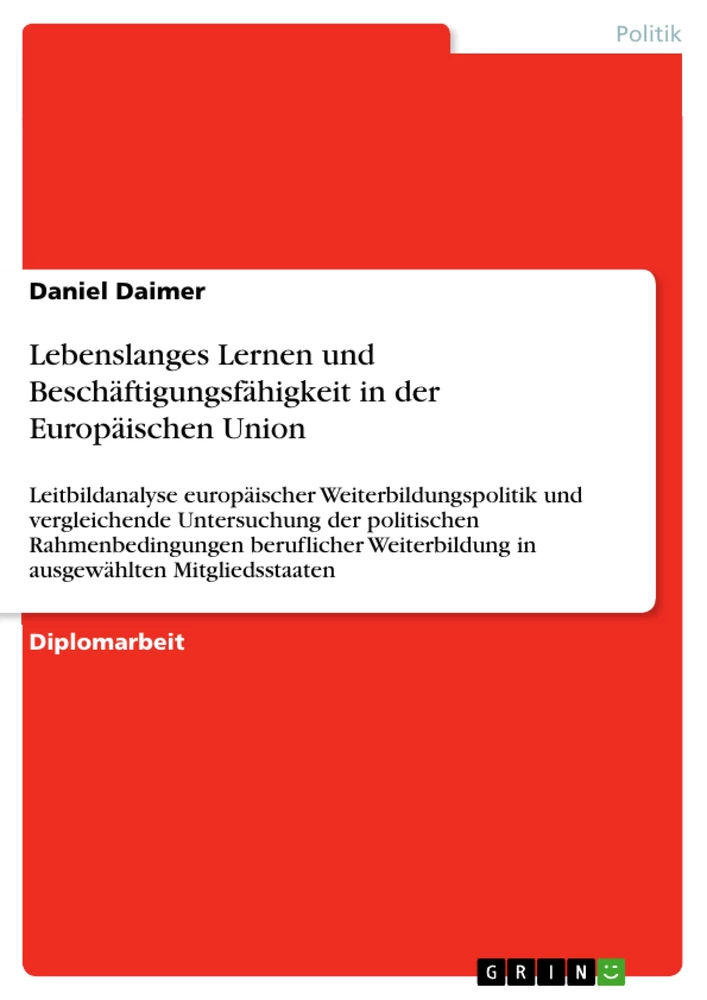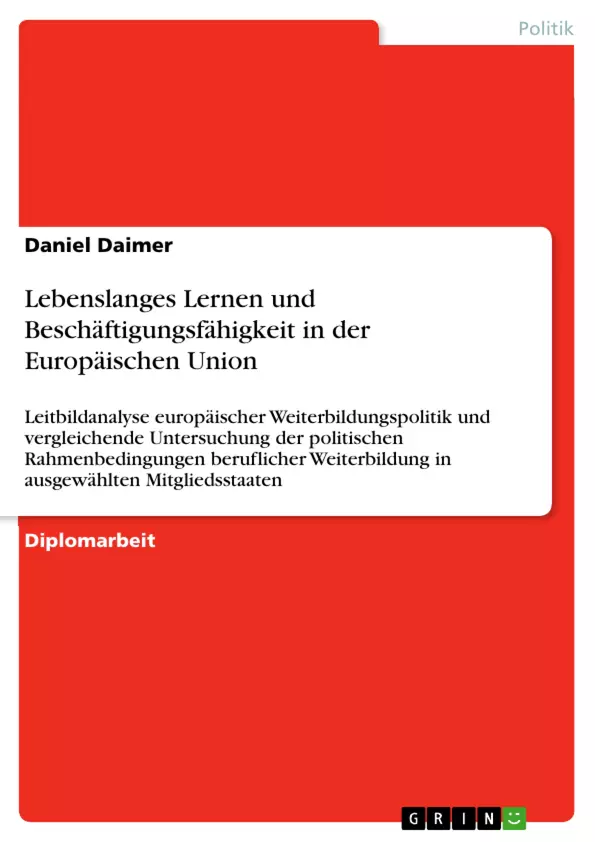Der wirtschaftliche und gesellschaftliche Strukturwandel von einer fordistisch geprägten Industriegesellschaft zu einer Wissens- und Kommunikationsgesellschaft (Heidenreich 1999) stellt eine Herausforderung an Aus- und Weiterbildung dar. (...) Höhere und sich entwickelnde Qualifikationsanforderungen erfordern eine Erweiterung des Lernens auf das ganze Leben (Baethge/Baethge-Kinsky 2004; Josczok 1999). Dieses „Lebenslange Lernen“ (LLL) steht für Lernprozesse, die über die gesamte Lebensspanne verteilt, sowohl in Bildungsinstitutionen als auch am Arbeitsplatz oder in der Freizeit, stattfinden.
LLL wurde seit Mitte der siebziger Jahre von verschiedenen internationalen Organisationen (OECD, UNESCO, Europarat) als bildungspolitisches Reformkonzept propagiert und hat sich als außerordentlich wandlungsfähig gezeigt. Unter einer „patina of international discourse“ (Green 2002, 612) lassen sich deutliche Unterschiede in den propagierten Zielen von LLL ausmachen. (...) So gelten in der Kommissionsmitteilung „Einen europäischen Raum des lebenslangen Lernens schaffen“ (Europäische Kommission 2001a) active citizenship und employability als gleich wichtige und miteinander verbundene Ziele des LLL (Schemmann 2004). Seit den neunziger Jahren hat sich LLL zu „one of the new en vogue themes of European policy“ (de la Porte/Pochet 2003 entwickelt. (...) Danach griff der Europäische Rat das Thema auf und forderte in seiner Schlussfolgerung des Gipfels von Lissabon im März 2000 eine „Aufwertung des lebenslangen Lernens als Grundbestandteil des europäischen Gesellschaftsmodells“ (Europäischer Rat 2000a) im Rahmen der übergreifenden Strategie, die EU bis 2010 „zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt zu machen - einem Wirtschaftsraum, der fähig ist, ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum mit mehr und besseren Arbeitsplätzen und einem größeren sozialen Zusammenhalt zu erzielen“ (ebd.). (...) „Ziele und Strategien der EU werden (...) in jedem Einzelstaat reinterpretiert und entsprechend dem eigenen Regulationsmodus implementiert“ (Baethge/Bartelheimer 2005, 47). Mit dem Leitbild „Einen europäischen Raum des Lebenslangen Lernens schaffen“ wurde auf europäischer Ebene solch ein Ziel formuliert und in Schlüsselbotschaften und Bausteinen konkretisiert. Dieses spezifische Leitbild und seine Reinterpretation und Implementierung in den Mitgliedsstaaten Großbritannien, Dänemark und der Bundesrepublik Deutschland sind die Themen dieser Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Thema
- 1.2. Fragestellung und Eingrenzung
- 1.3. Theorie
- 1.4. Aufbau und Methodik
- 1.5. Literatur und Forschungsstand
- 2. Lebenslanges Lernen und Weiterbildung – Überschneidung und Abgrenzung der Begriffe
- 2.1. Lernen – lebenslang und lebensweit
- 2.2. Berufliche Weiterbildung
- 2.3. Verhältnis von Lebenslangem Lernen und Weiterbildung
- 2.4. Die Internationalität von Lebenslangem Lernen
- 3. Die Entwicklung des Lebenslangen Lernens – Karriere einer Leitidee
- 3.1. Die optimistische Phase des Lebenslangen Lernens
- 3.1.1. Der Faure-Report – Erfindung des Lebenslangen Lernens
- 3.1.2. Permanent Education - Erste europäische Beiträge zum Lebenslangen Lernen
- 3.1.3. Der OECD-Bericht zu „Recurrent Education“
- 3.1.4. Die Wissensgesellschaft der siebziger Jahre als Wissenschaftsgesellschaft
- 3.1.5. Ergebnisse der optimistischen Phase des Lebenslangen Lernens
- 3.2. Die realistische Phase des Lebenslangen Lernens
- 3.2.1. Die Weißbücher der Europäischen Kommission – Die Rückkehr des Lebenslangen Lernens
- 3.2.2. OECD, „lifelong learning“ folgt „recurrent education“
- 3.2.3. Anstieg der wissensbasierten Dienstleistungen und Paradigmenwechsel zur prozessorientierten Weiterbildung
- 3.2.4. Ergebnisse der realistischen Phase des Lebenslangen Lernens
- 4. Lebenslanges Lernen in der europäischen Politik – Operationalisierung eines Leitbildes
- 4.1. „Einen europäischen Raum des lebenslangen Lernens schaffen“
- 4.2. Das europäische Leitbild des Lebenslangen Lernens
- 5. Ausprägungen des Lebenslangen Lernens in den Mitgliedsstaaten
- 5.1. Weiterbildung als Teil des Bildungssystems
- 5.2. Lebenslanges Lernen in Deutschland
- 5.2.1. Struktur und Merkmale der beruflichen Weiterbildung
- 5.2.2. Politische Maßnahmen im Rahmen der Bausteine
- 5.2.3. Lebenslanges Lernen als Bereich deregulierter Weiterbildung
- 5.3. Lebenslanges Lernen in Großbritannien
- 5.3.1. Struktur und Merkmale der beruflichen Weiterbildung
- 5.3.2. Politische Maßnahmen im Rahmen der Bausteine
- 5.3.3. Lebenslanges Lernen in einer fragmentierten Bildungslandschaft
- 5.4. Lebenslanges Lernen in Dänemark
- 5.4.1. Struktur und Merkmale der beruflichen Weiterbildung
- 5.4.2. Politische Maßnahmen im Rahmen der Bausteine
- 5.4.3. Von der Weiterbildung zu einem System des Lebenslangen Lernens
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Konzept des lebenslangen Lernens (LLL) in der Europäischen Union. Sie analysiert die Entwicklung des Leitbildes des LLL, seine Operationalisierung in der europäischen Politik und seine Ausprägungen in ausgewählten Mitgliedsstaaten. Ein zentrales Anliegen ist der Vergleich der politischen Rahmenbedingungen beruflicher Weiterbildung in diesen Ländern.
- Entwicklung des Konzepts des lebenslangen Lernens
- Europäische Bildungspolitik und das Leitbild des lebenslangen Lernens
- Vergleichende Analyse der beruflichen Weiterbildung in ausgewählten EU-Mitgliedsstaaten
- Politische Maßnahmen zur Förderung des lebenslangen Lernens
- Herausforderungen und Chancen des lebenslangen Lernens im Kontext des gesellschaftlichen Wandels
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in das Thema der Diplomarbeit ein. Es beschreibt den gesellschaftlichen Wandel und die steigenden Anforderungen an Aus- und Weiterbildung, wodurch das Konzept des lebenslangen Lernens an Bedeutung gewinnt. Es werden die Fragestellung, die Methodik und der Forschungsstand der Arbeit umrissen. Die Einleitung betont die Bedeutung des lebenslangen Lernens als Antwort auf die Herausforderungen einer wissensbasierten Gesellschaft und die Notwendigkeit, dieses Konzept im europäischen Kontext zu analysieren.
2. Lebenslanges Lernen und Weiterbildung – Überschneidung und Abgrenzung der Begriffe: Dieses Kapitel klärt die Begriffe „Lebenslanges Lernen“ und „Weiterbildung“. Es untersucht die Überschneidungen und Unterschiede zwischen diesen Begriffen und setzt sie in Beziehung zueinander. Das Kapitel betont, dass lebenslanges Lernen einen breiteren Rahmen umfasst als Weiterbildung, da es Lernprozesse über die gesamte Lebensspanne in verschiedenen Kontexten umfasst. Die internationale Dimension des lebenslangen Lernens wird ebenfalls beleuchtet.
3. Die Entwicklung des Lebenslangen Lernens – Karriere einer Leitidee: Dieses Kapitel verfolgt die Entwicklung des Konzepts des lebenslangen Lernens von seiner Entstehung bis zur Gegenwart. Es unterteilt diese Entwicklung in eine optimistische und eine realistische Phase. Die optimistische Phase ist geprägt von der Erwartung, dass lebenslanges Lernen soziale und wirtschaftliche Probleme lösen kann. Die realistische Phase zeichnet sich durch eine differenziertere Sichtweise aus, die die Herausforderungen der Umsetzung berücksichtigt. Es werden wichtige Berichte und Dokumente diskutiert, die diese Entwicklung geprägt haben, wie der Faure-Report und die Weißbücher der Europäischen Kommission.
4. Lebenslanges Lernen in der europäischen Politik – Operationalisierung eines Leitbildes: Dieses Kapitel befasst sich mit der Umsetzung des lebenslangen Lernens in der europäischen Politik. Es analysiert die europäischen Strategien und Initiativen zur Förderung des lebenslangen Lernens und untersucht, wie das Leitbild des lebenslangen Lernens in politische Maßnahmen übersetzt wird. Das Kapitel beleuchtet das Bestreben, einen europäischen Raum des lebenslangen Lernens zu schaffen, und diskutiert die damit verbundenen Herausforderungen.
5. Ausprägungen des Lebenslangen Lernens in den Mitgliedsstaaten: Dieses Kapitel vergleicht die nationalen Systeme des lebenslangen Lernens in Deutschland, Großbritannien und Dänemark. Es analysiert die Strukturen und Merkmale der beruflichen Weiterbildung in diesen Ländern sowie die jeweiligen politischen Maßnahmen zur Förderung des lebenslangen Lernens. Der Fokus liegt auf den Unterschieden in den nationalen Ansätzen und den Herausforderungen, die sich aus den verschiedenen Bildungssystemen ergeben. Die Kapitel diskutieren die jeweilige Kontextualisierung des Konzepts im nationalen Rahmen.
Schlüsselwörter
Lebenslanges Lernen, Weiterbildung, Europäische Union, Bildungspolitik, berufliche Weiterbildung, Wissensgesellschaft, Kompetenzen, Employability, soziale Teilhabe, Vergleichende Analyse, Deutschland, Großbritannien, Dänemark.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Lebenslanges Lernen in der Europäischen Union
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht das Konzept des lebenslangen Lernens (LLL) in der Europäischen Union. Sie analysiert die Entwicklung des Leitbildes, seine Umsetzung in der europäischen Politik und seine Ausprägungen in ausgewählten Mitgliedsstaaten (Deutschland, Großbritannien, Dänemark).
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung des Konzepts des lebenslangen Lernens, die europäische Bildungspolitik und das Leitbild des lebenslangen Lernens, einen Vergleich der beruflichen Weiterbildung in ausgewählten EU-Mitgliedsstaaten, politische Maßnahmen zur Förderung des lebenslangen Lernens und die Herausforderungen und Chancen des lebenslangen Lernens im Kontext des gesellschaftlichen Wandels.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Abgrenzung der Begriffe „Lebenslanges Lernen“ und „Weiterbildung“, Entwicklung des Konzepts des lebenslangen Lernens, Lebenslanges Lernen in der europäischen Politik und Ausprägungen des lebenslangen Lernens in ausgewählten Mitgliedsstaaten (Deutschland, Großbritannien, Dänemark).
Welche Phasen der Entwicklung des lebenslangen Lernens werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet zwischen einer optimistischen und einer realistischen Phase in der Entwicklung des Konzepts des lebenslangen Lernens. Die optimistische Phase ist geprägt von hohen Erwartungen an die Problemlösungsfähigkeit von LLL, während die realistische Phase die Herausforderungen der Umsetzung stärker berücksichtigt.
Welche Berichte und Dokumente werden in der Arbeit diskutiert?
Wichtige Berichte und Dokumente, die die Entwicklung des Konzepts des lebenslangen Lernens geprägt haben, wie der Faure-Report und die Weißbücher der Europäischen Kommission, werden in der Arbeit diskutiert.
Welche Länder werden im Vergleich untersucht?
Die Arbeit vergleicht die nationalen Systeme des lebenslangen Lernens in Deutschland, Großbritannien und Dänemark. Der Fokus liegt auf den Unterschieden in den nationalen Ansätzen und den Herausforderungen, die sich aus den verschiedenen Bildungssystemen ergeben.
Was ist der Schwerpunkt des Ländervergleichs?
Der Ländervergleich konzentriert sich auf die Strukturen und Merkmale der beruflichen Weiterbildung in den ausgewählten Ländern sowie auf die jeweiligen politischen Maßnahmen zur Förderung des lebenslangen Lernens.
Welche Schlüsselbegriffe sind für die Arbeit zentral?
Zentrale Schlüsselbegriffe sind Lebenslanges Lernen, Weiterbildung, Europäische Union, Bildungspolitik, berufliche Weiterbildung, Wissensgesellschaft, Kompetenzen, Employability, soziale Teilhabe, Vergleichende Analyse, Deutschland, Großbritannien und Dänemark.
Was ist das zentrale Anliegen der Arbeit?
Ein zentrales Anliegen der Arbeit ist der Vergleich der politischen Rahmenbedingungen beruflicher Weiterbildung in den ausgewählten Ländern.
Wo finde ich ein detailliertes Inhaltsverzeichnis?
Ein detailliertes Inhaltsverzeichnis mit allen Unterkapiteln ist im HTML-Dokument enthalten.
- Quote paper
- Daniel Daimer (Author), 2006, Lebenslanges Lernen und Beschäftigungsfähigkeit in der Europäischen Union, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/160697