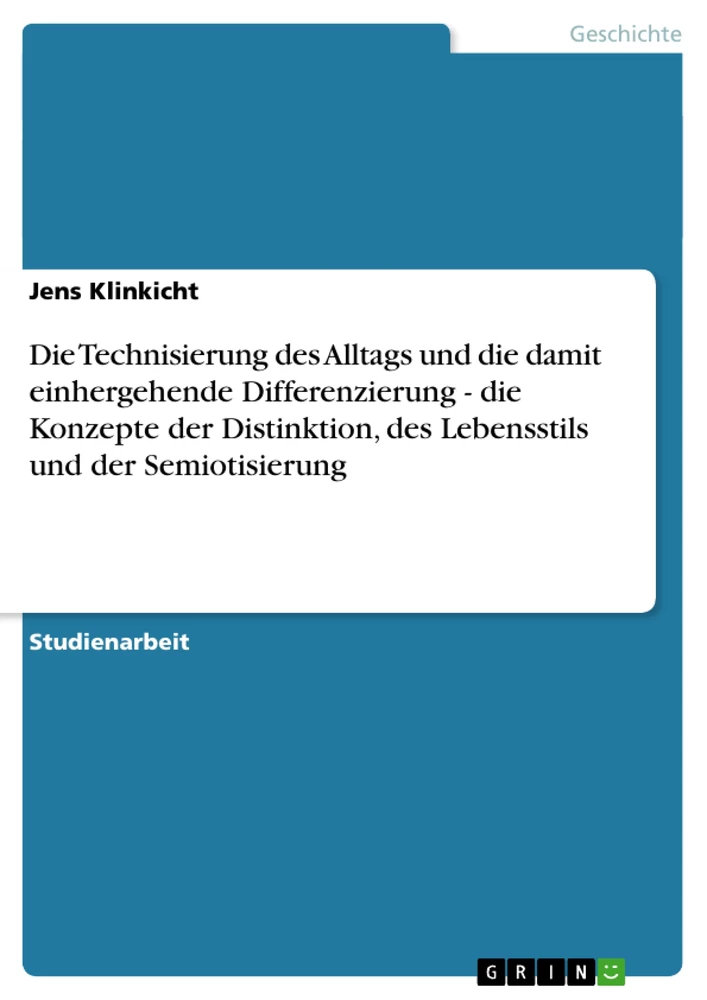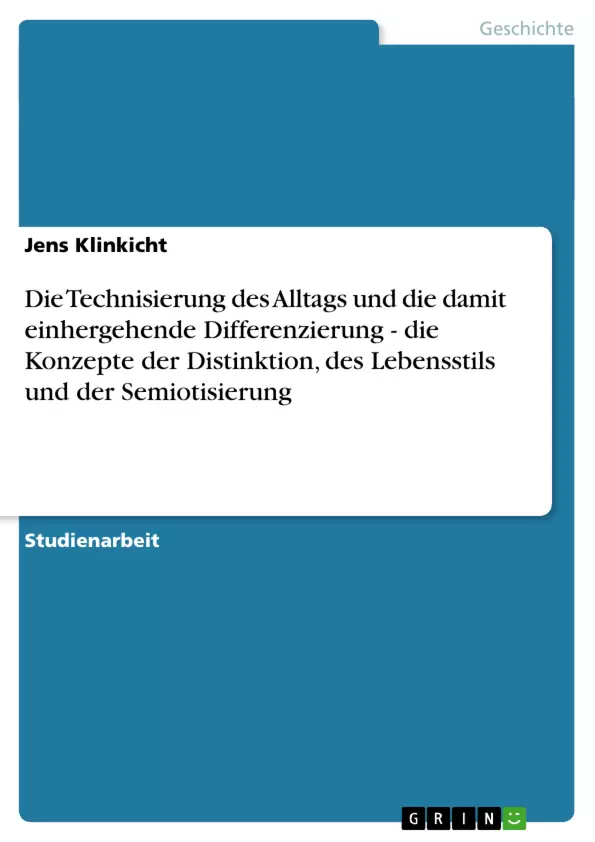Die Geschichte der modernen Gesellschaft ist notwendig eine Geschichte der konsequenten funktionalen Ausdifferenzierung des Gesellschaftssystems in mehrere Teilsysteme. Derartige Gebilde sind zuständig für jeweils einen gesellschaftlichen Problembereich (z.B. Wirtschaft, Politik, Religion, Recht und Kunst) der innerhalb ihrer Grenzen behandelt und gelöst werden muss bzw. soll – soweit kurz der Anspruch der Systemtheorie.
Kennzeichen für eine moderne Gesellschaft ist nun nicht die Prämisse, das eines der eben beispielhaft genannten „Funktionssysteme“ über den jeweils anderen steht (sozusagen das Leitsystem bildet), sondern jedes System seine eigene Funktion als primär behandelt (vgl. Luhmann 1987, S.34-35). Diese Teilsysteme zeichnen sich wiederum durch eine interne Ausdifferenzierung in verschiedene Subsysteme aus, welche gleichfalls auf die Ausdifferenzierung des gesamten Gesellschaftssystems (über den Austausch mit der Umwelt an der Systemgrenze) zurückschlägt und seine Struktur beeinflusst. Das bedeutet darüber hinaus eine immer weiter ansteigende Komplexität des umfassenden Sozialsystems und verlangt durch diese Veränderung(en) eine ständige und erneute Anpassung der gesellschaftlichen Teilsysteme (vgl. Luhmann 1987, S.261).
Bei diesen Prozessen haben wir es mit Interdependenzen und Wechselwirkungen, Strategien und Zielen zu tun. Auch die Sozialstruktur einer modernen Gesellschaft ist notwendigerweise differenziert, z.B. durch die Beschreibung von Klassen, Milieus, Schichten usw. Bei der Bestimmung solcher Begriffe wird unter anderem von (teilweise erheblichen) Differenzen in der Verteilung sozialer Güter ausgegangen. Derartige Gebilde entstehen allerdings nicht einfach so, sondern sind Folgen einer wechselseitigen (sich aufsummierenden) Verstärkung vieler Ungleichheiten (Bildung, Einkommen, sozialer Status, Beruf, Einfluss,…). Luhmann gebraucht für diese Beobachtung den Begriff einer „…Multidimensionalität der Ungleichheit…“ (Luhmann 1985, S.120). Nun interessiert uns an dieser Stelle aber nicht so sehr das Theoriegebäude der Systemtheorie von Luhmann, als vielmehr die Betrachtung von drei sozial entscheidenden Phänomenen (Distinktion, Lebensstil, Semiotisierung), deren Existenz, Wirken und Veränderung ebenfalls durch die Technik dramatisch an Bedeutung zugenommen hat und starken Einfluss auf gesellschaftliche Bewegungen sowie Ereignisse nimmt – damit ist das Stichwort „Technik und Alltag“ gemeint.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einführung
- II. Begriffsklärung von Technik und Technisierung
- III. Einige theoretische Implikationen zu den Begriffen Distinktion, Lebensstil und Semiotisierung
- 3.1. Der Begriff der Distinktion
- 3.2. Der Begriff des Lebensstils
- 3.3. Der Begriff der Semiotisierung
- IV. Die Stellung der Technik in Gesellschaft und Alltag
- 4.1. Das Automobil
- 4.2. Die Mode
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Technisierung des Alltags und ihren Auswirkungen auf die soziale Differenzierung. Sie analysiert die Konzepte der Distinktion, des Lebensstils und der Semiotisierung im Kontext der technischen Entwicklung. Der Fokus liegt dabei auf der Frage, inwiefern die Technik zur sprunghaften Differenzierung kultureller Möglichkeiten, zur Abgrenzung von anderen und zur Entwicklung eines eigenen Lebensstils beiträgt.
- Die Bedeutung der Technik für die Ausdifferenzierung des Gesellschaftssystems
- Die Rolle von Distinktion, Lebensstil und Semiotisierung als Mechanismen der sozialen Differenzierung
- Der Einfluss der Technisierung auf die Konstruktion von Identität und sozialer Ungleichheit
- Die Verwendung der Technik als Mittel zur Abgrenzung und zur Hervorhebung des eigenen Status
- Die Analyse konkreter Beispiele wie Automobil und Mode, um die theoretischen Konzepte zu verdeutlichen
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einführung
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in das Thema der Technisierung des Alltags und ihrer Bedeutung für die moderne Gesellschaft. Sie stellt die These auf, dass die Technik eine zentrale Rolle bei der Differenzierung kultureller Möglichkeiten und der Entwicklung von Lebensstilen spielt. Zudem wird auf den Dualismus von Individuum und Gesellschaft als wesentliche Grundlage dieser Entwicklung hingewiesen.
II. Begriffsklärung von Technik und Technisierung
In diesem Kapitel werden die Begriffe „Technik“ und „Technisierung“ aus systemtheoretischer Perspektive geklärt. Die Technik wird als Einflussvariable beschrieben, die die Entwicklung der modernen Gesellschaft maßgeblich beeinflusst hat. Es werden verschiedene Metaphern zur Beschreibung der heutigen Gesellschaft vorgestellt, in denen die Technik eine zentrale Rolle spielt.
III. Einige theoretische Implikationen zu den Begriffen Distinktion, Lebensstil und Semiotisierung
Dieses Kapitel beleuchtet die theoretischen Konzepte von Distinktion, Lebensstil und Semiotisierung. Es erläutert, wie diese Begriffe die Prozesse der sozialen Differenzierung und die Konstruktion von Identität beeinflussen. Die Technisierung wird als ein wichtiger Faktor für die Entstehung und Entwicklung dieser Konzepte dargestellt.
IV. Die Stellung der Technik in Gesellschaft und Alltag
In diesem Kapitel wird die Rolle der Technik im Alltag anhand zweier empirischer Beispiele, Mode und Automobil, analysiert. Es wird gezeigt, wie die Technik als Werkzeug der Distinktion, des Lebensstils und der Semiotisierung eingesetzt wird. Es werden die Auswirkungen der Technisierung auf die soziale Differenzierung und die Konstruktion von Identität untersucht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Technik, Technisierung, Distinktion, Lebensstil, Semiotisierung, soziale Differenzierung, Identität, soziale Ungleichheit, Alltag, Mode, Automobil und Systemtheorie. Sie untersucht, wie diese Begriffe im Kontext der modernen Gesellschaft miteinander verwoben sind und wie die Technik als treibende Kraft hinter der zunehmenden sozialen Differenzierung wirkt.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusst Technik die soziale Differenzierung?
Technik wirkt als treibende Kraft, die kulturelle Möglichkeiten erweitert und Individuen erlaubt, sich durch Lebensstile von anderen abzugrenzen.
Was bedeutet der Begriff Distinktion in diesem Kontext?
Distinktion beschreibt den Prozess der bewussten Abgrenzung von anderen sozialen Gruppen, oft durch den Einsatz technischer Güter als Statussymbole.
Welche Rolle spielt das Automobil in der Arbeit?
Das Automobil wird als empirisches Beispiel für Technisierung genutzt, um zu zeigen, wie Technik zur Konstruktion von Identität und Status beiträgt.
Was ist unter Semiotisierung zu verstehen?
Semiotisierung bezieht sich auf die Aufladung von Objekten (wie Mode oder Technik) mit Zeichen und Bedeutungen innerhalb einer Gesellschaft.
Welchen theoretischen Ansatz verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit basiert maßgeblich auf der Systemtheorie, insbesondere unter Bezugnahme auf Niklas Luhmann.
- Citar trabajo
- Jens Klinkicht (Autor), 2003, Die Technisierung des Alltags und die damit einhergehende Differenzierung - die Konzepte der Distinktion, des Lebensstils und der Semiotisierung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/16070