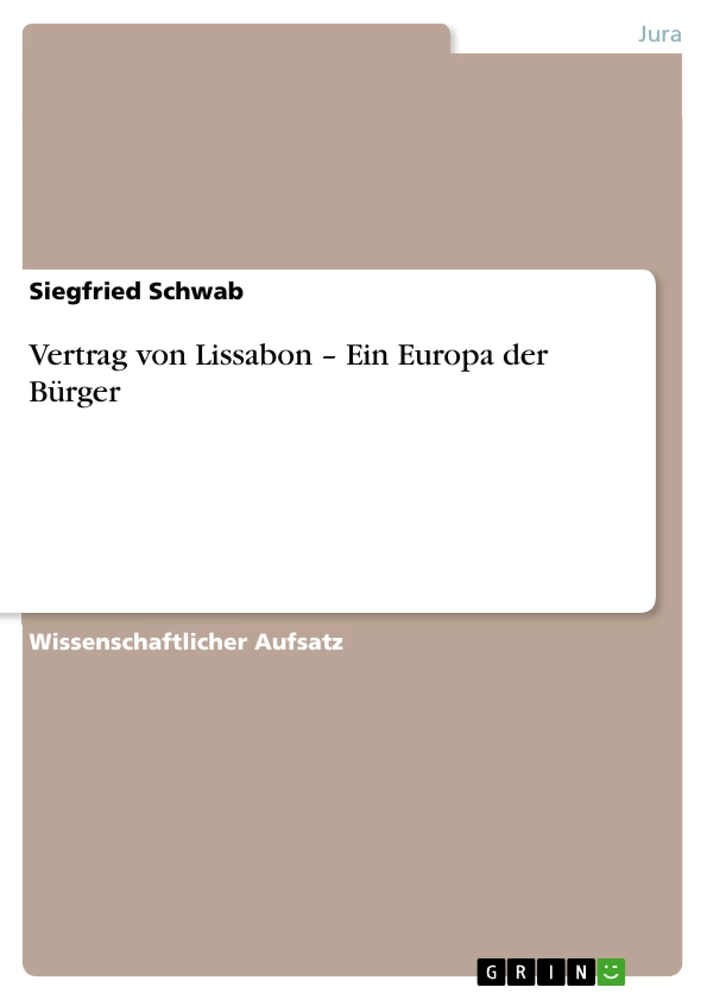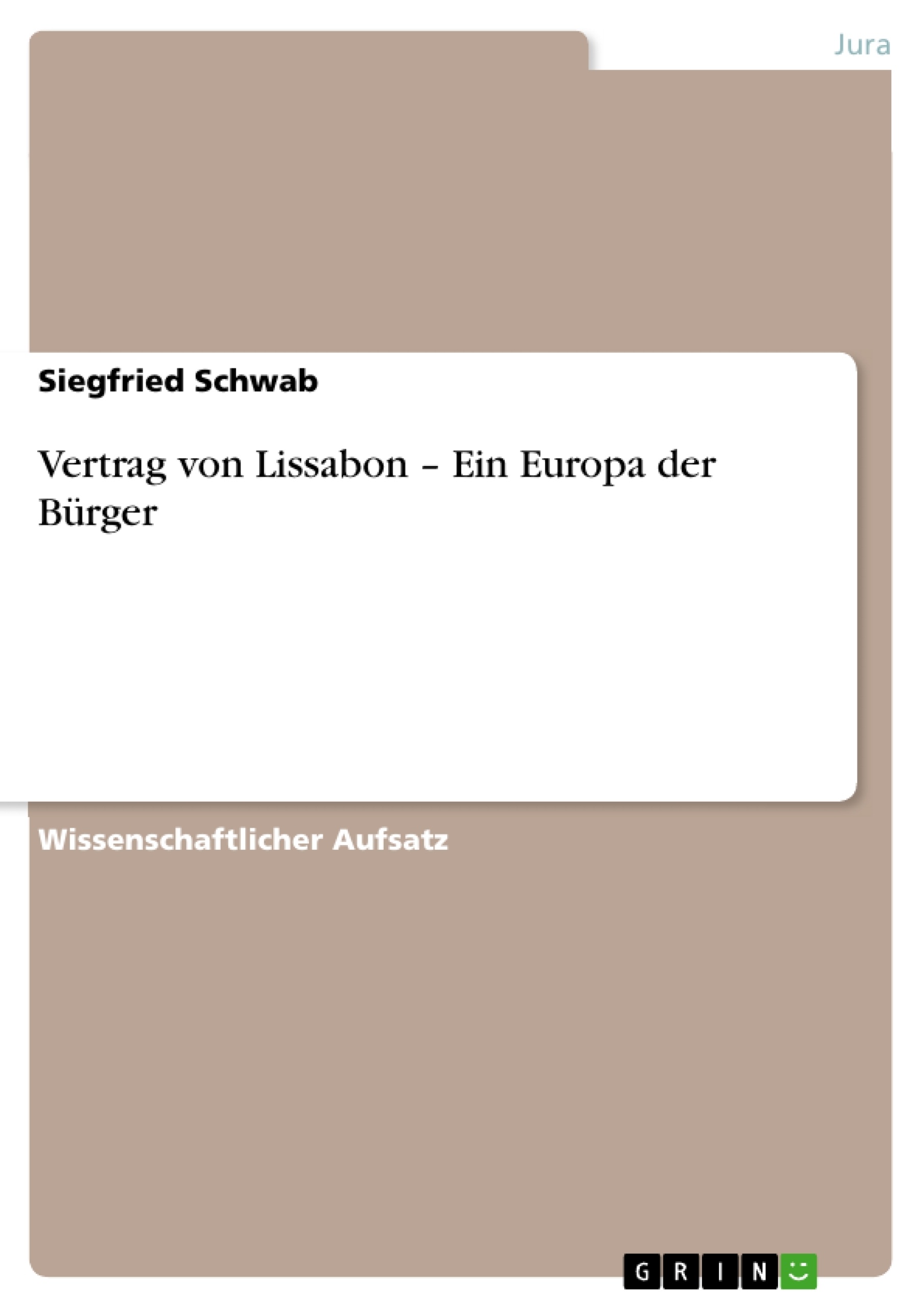!Der Staat ist ein Rechtskonstrukt nicht Mythos; an der Gestaltung nehmen die Staatsangehörigen durch die in Bund, Ländern und Gemeinden gewählten Repräsentanten teil (Erich Röper. Um einem Europa der Bürger näher zu kommen, bedarf es, woran zu arbeiten lange versäumt wurde: der Ausbildung einer europäischen Identität, aus welcher allein die Bereitschaft zur Einordnung in einen Staatenverbund erwachsen kann (Hans Hugo Klein).“
Das Grundgesetz ermächtigt mit Art. 23 GG zur Beteiligung und Entwicklung einer als Staatenverbund konzipierten Europäischen Union. Der Begriff des Verbunds erfasst eine enge, auf Dauer angelegte Verbindung souverän bleibender Staaten, die auf vertraglicher Grundlage öffentliche Gewalt ausübt, deren Grundordnung jedoch allein der Verfügung der Mitgliedstaaten unterliegt und in der die Völker - das heißt die staatsangehörigen Bürger-der Mitgliedstaaten die Subjekte demokratischer Legitimation bleiben. Der Prüfungsmaßstab für das Zustimmungsgesetz zum Vertrag von Lissabon bestimmt sich durch das Wahlrecht als grundrechtsgleiches Recht (Art. 38 Abs. 1 S. 1 i.V. mit Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG). Das Wahlrecht begründet einen Anspruch auf demokratische Selbstbestimmung, auf freie und gleiche Teilhabe an der in Deutschland ausgeübten Staatsgewalt sowie auf die Einhaltung des Demokratiegebots einschließlich der Achtung der verfassungsgebenden Gewalt des Volkes. Die Prüfung einer Verletzung des Wahlrechts umfasst in der hier gegebenen prozessualen Konstellation auch Eingriffe in die Grundsätze, die Art. 79 Abs. 3 GG als Identität der Verfassung festschreibt. Art. 38 Abs. 1 GG gewährleistet jedem wahlberechtigten Deutschen das Recht, die Abgeordneten des Deutschen Bundestags zu wählen. Mit der allgemeinen, freien und gleichen Wahl der Abgeordneten des Deutschen Bundestags betätigt das Bundesvolk seinen politischen Willen unmittelbar. Es regiert sich regelmäßig mittels einer Mehrheit (Art. 42 Abs. 2 GG) in der so zu Stande gekommenen repräsentativen Versammlung. Aus ihr heraus wird der Kanzler- und damit die Bundesregierung - bestimmt; dort hat er sich zu verantworten. Die Wahl der Abgeordneten ist auf der Bundesebene des vom Grundgesetz verfassten Staates die Quelle der Staatsgewalt - diese geht mit der periodisch wiederholten Wahl immer wieder neu vom Volke aus (Art. 20 Abs. 2 GG). Das Wahlrecht ist der wichtigste vom Grundgesetz gewährleistete subjektive Anspruch der Bürger auf demokratische Teilhabe (Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG).
Inhaltsverzeichnis
- Vertrag von Lissabon Ein Europa der Bürger?*1/2
- Das Grundgesetz ermächtigt mit Art. 23 GG4 zur Beteiligung und Entwicklung einer als Staatenverbund konzipierten Europäischen Union.
- Der Prüfungsmaßstab für das Zustimmungsgesetz zum Vertrag von Lissabon bestimmt sich durch das Wahlrecht als grundrechtsgleiches Recht (Art. 38 Abs. 1 S. 1 i.V. mit Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG).
- Art. 79 Abs. 3 GG erklärt die Änderung des Grundgesetzes hinsichtlich bestimmter Einrichtungen und Normen des Grundgesetzes für unzulässig (sog. Ewigkeitsgarantie).
- Art. 38 GG wird verletzt, wenn ein Gesetz, das die deutsche Rechtsordnung für die unmittelbare Geltung und Anwendung von Recht der - supranationalen - Europäischen Gemeinschaften öffnet, die zur Wahrnehmung übertragenen Rechte und das beabsichtigte Integrationsprogramm nicht hinreichend bestimmbar festlegt (vgl. BVerfGE 58, 37) = NJW 1982, 507).
- Die Konstruktion eines Grundrechts auf einen Abgeordneten, der noch etwas zu sagen hat aus Art. 38 GG, also die Verfassungsbeschwerde auf Demokratie, wird noch weiter geöffnet.
- Das Demokratieprinzip ist ein Organisationsprinzip, dessen Geltung sich letzten Endes auf die in Art 1 Abs. 1 S. 2 GG statuierte Pflicht der Staatsorgane zurückführen lässt, die unantastbare Würde des Menschen zu achten und zu schützen, Huster/Rux, in Epping/Hillgruber, Beck'scher Online-Kommentar, Art. 20 GG, RN 49.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text beleuchtet die Auswirkungen des Vertrags von Lissabon auf die deutsche Staatsordnung und die Rolle des Bundesverfassungsgerichts im europäischen Integrationsprozess. Er analysiert die Spannungsverhältnisse zwischen nationaler Souveränität und europäischer Integration, die sich in der Auslegung von Art. 23 GG und Art. 79 Abs. 3 GG widerspiegeln.
- Die Bedeutung des Grundgesetzes im Kontext der Europäischen Union
- Die Auslegung von Art. 23 GG und Art. 79 Abs. 3 GG im Hinblick auf die europäische Integration
- Die Rolle des Bundesverfassungsgerichts als „Hüter des Nationalstaats“
- Die Frage der demokratischen Legitimation europäischer Entscheidungen
- Die Spannungsverhältnisse zwischen nationaler Souveränität und europäischer Integration
Zusammenfassung der Kapitel
Der Text beleuchtet zunächst die Bedeutung des Grundgesetzes im Kontext der Europäischen Union. Er analysiert, wie Art. 23 GG den deutschen Staat zur Beteiligung und Entwicklung der Europäischen Union ermächtigt. Darüber hinaus untersucht er, wie sich das Wahlrecht als grundrechtsgleiches Recht (Art. 38 Abs. 1 S. 1 i.V. mit Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG) auf die Prüfung des Zustimmungsgesetzes zum Vertrag von Lissabon auswirkt.
Anschließend betrachtet der Text die Auslegung von Art. 79 Abs. 3 GG, welche die Änderung des Grundgesetzes hinsichtlich bestimmter Einrichtungen und Normen für unzulässig erklärt. Hierbei wird die Frage erörtert, wie diese sogenannte „Ewigkeitsgarantie“ mit der Übertragung von Hoheitsrechten auf die Europäische Union vereinbar ist.
Weiterhin beleuchtet der Text die Verletzung von Art. 38 GG durch Gesetze, die die deutsche Rechtsordnung für die unmittelbare Geltung und Anwendung von Recht der Europäischen Union öffnen. Dabei wird die Frage aufgeworfen, ob spätere Änderungen des Integrationsprogramms noch vom Zustimmungsgesetz zum Vertrag von Lissabon gedeckt sind.
Schlüsselwörter
Grundgesetz, Vertrag von Lissabon, Europäische Union, Bundesverfassungsgericht, nationale Souveränität, europäische Integration, Art. 23 GG, Art. 79 Abs. 3 GG, Wahlrecht, demokratische Legitimation, Integrationsverantwortung, Rechtsstaatlichkeit, Demokratieprinzip, Grundrechte, objektive Werteordnung, EUV-Lissabon.
Häufig gestellte Fragen
Was regelt der Vertrag von Lissabon?
Er reformierte die rechtliche Struktur der EU, um sie demokratischer und handlungsfähiger zu machen.
Was ist die "Ewigkeitsgarantie" im Grundgesetz?
Gemäß Art. 79 Abs. 3 GG dürfen Kernprinzipien wie Demokratie und Rechtsstaatlichkeit auch durch EU-Integration nicht abgeschafft werden.
Welche Rolle spielt Art. 23 GG?
Er ist der "Europa-Artikel", der die Beteiligung Deutschlands an der Entwicklung der Europäischen Union ermöglicht.
Warum ist das Wahlrecht (Art. 38 GG) bei der EU-Integration wichtig?
Es garantiert Bürgern, dass die wesentliche Staatsgewalt weiterhin vom Volk ausgeht und nicht unkontrolliert auf die EU übertragen wird.
Wie fungiert das Bundesverfassungsgericht im Integrationsprozess?
Es prüft, ob EU-Verträge mit der deutschen Verfassungsidentität vereinbar sind (Integrationsverantwortung).
- Arbeit zitieren
- Prof. Dr. Dr. Assessor jur., Mag. rer. publ. Siegfried Schwab (Autor:in), 2010, Vertrag von Lissabon – Ein Europa der Bürger, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/160806