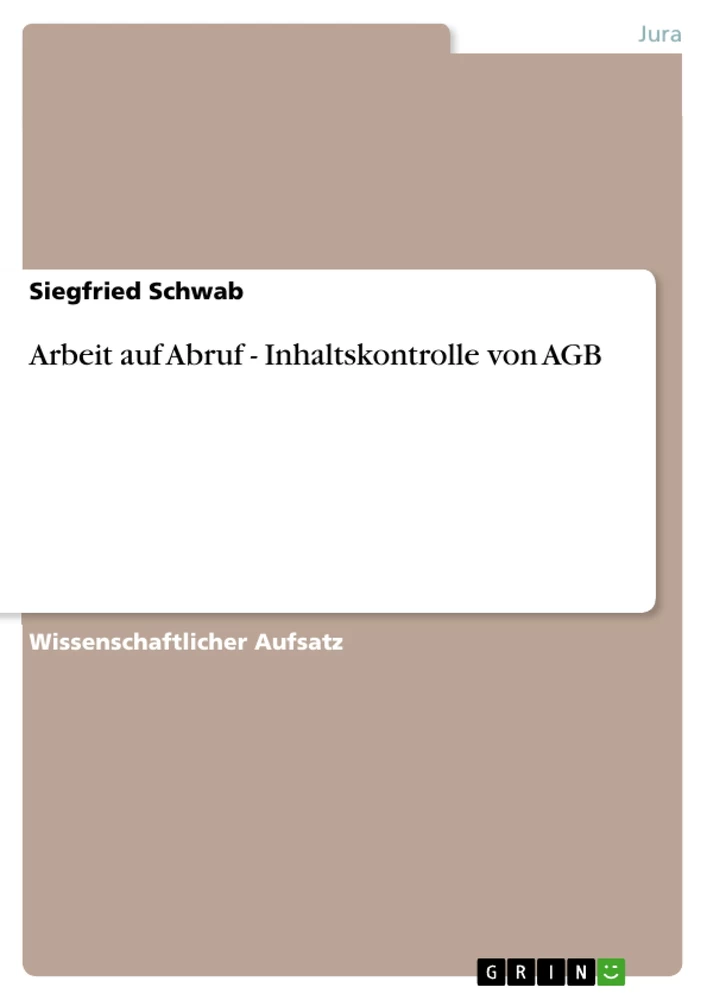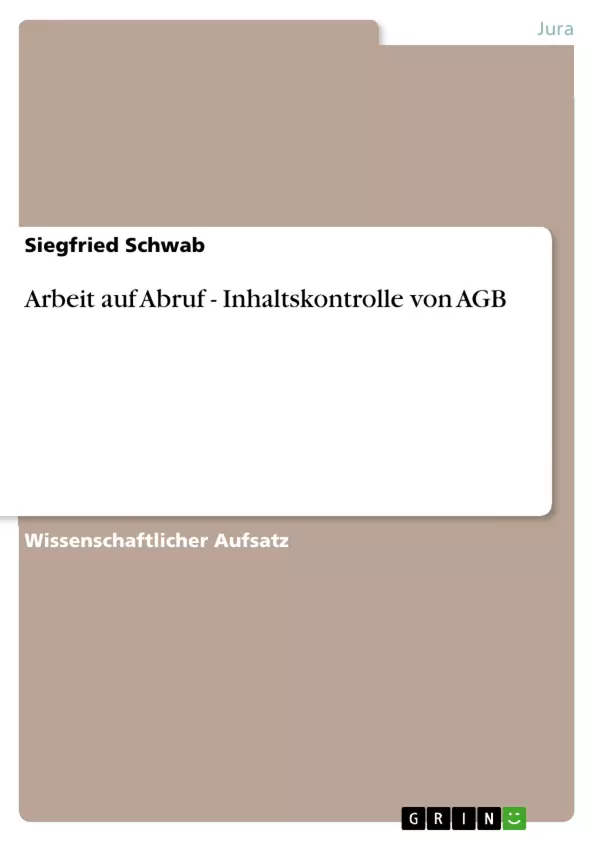§ 12 TzBfG regelt die Arbeit auf Abruf, auch kapitalorientierte variable Arbeitszeit genannt, § 12 Abs. 1 S. 2 TzBfG erfordert die Festlegung einer Mindestdauer der wöchentlichen und der täglichen Arbeitszeit. Die Arbeitsvertragsparteien können wirksam vereinbaren, dass der Arbeitnehmer über die vertragliche Mindestarbeitszeit hinaus Arbeit auf Abruf leisten muss.
Mit der Vereinbarung von Arbeit auf Abruf, die über eine vertragliche Mindestarbeitszeit hinausgeht, verlagert der Arbeitgeber abweichend von § 615 BGB einen Teil seines Wirtschaftsrisikos auf den Arbeitnehmer.
Bei der Angemessenheitsprüfung sind das Interesse des Arbeitgebers an einer Flexibilisierung der Arbeitszeitdauer und das Interesse des Arbeitnehmers an einer festen Regelung der Dauer der Arbeitszeit und der sich daraus ergebenden Arbeitsvergütung angemessen zum Ausgleich zu bringen
Die bei einer Vereinbarung von Arbeit auf Abruf einseitig vom Arbeitgeber abrufbare Arbeit des Arbeitnehmers darf nicht mehr als 25% der vereinbarten wöchentlichen Mindestarbeitszeit betragen.
Bei einer ergänzenden Vertragsauslegung ist darauf abzustellen, was die Parteien bei angemessener Abwägung ihrer Interessen nach Treu und Glauben als redliche Vertragsparteien vereinbart hätten, wenn sie die Unwirksamkeit der Klausel bedacht hätten. Zur Feststellung des mutmaßlichen Parteiwillens ist die tatsächliche Vertragsdurchführung von erheblicher Bedeutung. Sie gibt Aufschluss über das von den Parteien wirklich Gewollte.
Ein Abrufarbeitsverhältnis i.S.d § 12 TzBfG liegt vor, wenn im Arbeitsvertrag die Dauer der Arbeitszeit nur auf einen bestimmten Zeitraum bezogen festgelegt wird und der Arbeitgeber nach billigem Ermessen entscheiden kann, wie viel Arbeit er zu welchem Zeitpunkt in Anspruch nehmen will. Arbeit auf Abruf kann mit jedem ArbN, also auch mit Leiharbeitnehmern vereinbart werden. Unerheblich ist, ob sie einen rechtlichen Sonderschutzstatus haben (z. B. stillende Mutter oder Schwerbehinderter) vgl. Boecken, RN 13. Abrufarbeitsverhältnisse sind durch die zeitliche Dispositionsbefugnis des ArbG und die angemessene Verfügbarkeit des ArbN geprägt. Das Weisungsrecht des ArbG zur Konkretisierung der Arbeitszeit muss der ArbG nach billigem Ermessen ausüben. Der ArbG kann flexibel und nach Arbeitsanfall die Arbeitsleistung abrufen.
Inhaltsverzeichnis
- Arbeit auf Abruf - Inhaltskontrolle von AGB
- § 12 Abs. 1 S. 2 TzBfG erfordert die Festlegung einer Mindestdauer der wöchentlichen und der täglichen Arbeitszeit
- Mit der Vereinbarung von Arbeit auf Abruf, die über eine vertragliche Mindestarbeitszeit hinausgeht, verlagert der Arbeitgeber abweichend von § 615 BGB einen Teil seines Wirtschaftsrisikos auf den Arbeitnehmer
- Die Annahme des BAG, bei einem über 25% hinausgehenden Anteil abrufbarer Arbeitsleistung eine unangemessene Benachteiligung des Arbeitnehmers anzunehmen (§ 307 BGB), ist verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden
- Die bei einer Vereinbarung von Arbeit auf Abruf einseitig vom Arbeitgeber abrufbare Arbeit des Arbeitnehmers darf nicht mehr als 25% der vereinbarten wöchentlichen Mindestarbeitszeit betragen
- Bei einer ergänzenden Vertragsauslegung ist darauf abzustellen, was die Parteien bei angemessener Abwägung ihrer Interessen nach Treu und Glauben als redliche Vertragsparteien vereinbart hätten, wenn sie die Unwirksamkeit der Klausel bedacht hätten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Text untersucht die rechtliche Regulierung von Arbeitsverträgen mit Arbeit auf Abruf, insbesondere im Hinblick auf die Inhaltskontrolle von Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Dabei werden die rechtlichen Rahmenbedingungen, die Interessen der Vertragsparteien sowie die Auswirkungen auf das Arbeitsverhältnis betrachtet.
- Rechtliche Regulierung von Arbeitsverträgen mit Arbeit auf Abruf
- Inhaltskontrolle von Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) im Arbeitsrecht
- Interessenausgleich zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer
- Auswirkungen von Arbeit auf Abruf auf das Arbeitsverhältnis
- Verfassungsrechtliche Aspekte der Gestaltung von Arbeitsverträgen
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel behandelt die rechtliche Grundlage der Arbeit auf Abruf im deutschen Arbeitsrecht und beleuchtet die Bedeutung der Festlegung einer Mindestarbeitszeit im Arbeitsvertrag.
- Im zweiten Kapitel wird die Verschiebung des Wirtschaftsrisikos vom Arbeitgeber zum Arbeitnehmer durch die Vereinbarung von Arbeit auf Abruf untersucht, wobei der Fokus auf den Schutz des Arbeitnehmers liegt.
- Das dritte Kapitel beleuchtet die rechtliche Bewertung von Klauseln in Arbeitsverträgen, die Arbeit auf Abruf betreffen, und analysiert die Grenzen der Privatautonomie unter dem Aspekt der AGB-Kontrolle.
- Das vierte Kapitel befasst sich mit der konkreten Ausgestaltung von Arbeitsverträgen mit Arbeit auf Abruf und den daraus resultierenden rechtlichen und praktischen Problemen.
- Das fünfte Kapitel bietet eine umfassende Analyse der rechtlichen und tatsächlichen Situation der Parteien in einem konkreten Fall von Arbeit auf Abruf und diskutiert die Grenzen der Gestaltungsfreiheit im Arbeitsverhältnis.
Schlüsselwörter
Dieser Text beschäftigt sich mit den Themen Arbeit auf Abruf, Arbeitszeit, Mindestarbeitszeit, AGB-Kontrolle, Interessenausgleich, Wirtschaftsrisiko, Vertragsauslegung, Schutz des Arbeitnehmers, Arbeitsvertragsgestaltung, Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) und Verfassungsrecht.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die gesetzliche Grundlage für Arbeit auf Abruf?
Die Arbeit auf Abruf wird in § 12 des Teilzeit- und Befristungsgesetzes (TzBfG) geregelt.
Muss im Arbeitsvertrag eine Mindestarbeitszeit festgelegt werden?
Ja, gemäß § 12 Abs. 1 S. 2 TzBfG ist die Festlegung einer wöchentlichen und täglichen Mindestarbeitszeit zwingend erforderlich.
Wie viel zusätzliche Arbeit darf der Arbeitgeber abrufen?
Nach der Rechtsprechung des BAG darf die zusätzlich abrufbare Leistung maximal 25% der vereinbarten Mindestarbeitszeit betragen.
Wer trägt das Wirtschaftsrisiko bei Abrufarbeit?
Durch Abrufarbeit verlagert der Arbeitgeber einen Teil seines Wirtschaftsrisikos auf den Arbeitnehmer, was einer strengen Inhaltskontrolle unterliegt.
Was passiert, wenn eine Klausel zur Abrufarbeit unwirksam ist?
In diesem Fall erfolgt eine ergänzende Vertragsauslegung unter Berücksichtigung von Treu und Glauben und der tatsächlichen Vertragsdurchführung.
- Arbeit zitieren
- Prof. Dr. Dr. Assessor jur., Mag. rer. publ. Siegfried Schwab (Autor:in), 2010, Arbeit auf Abruf - Inhaltskontrolle von AGB, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/160813