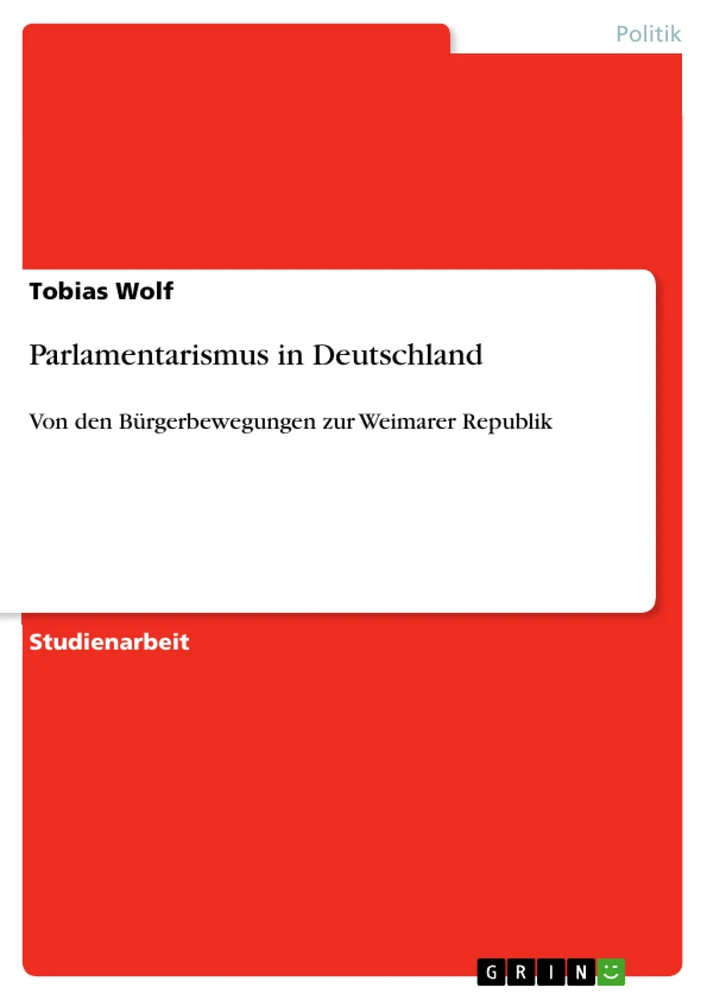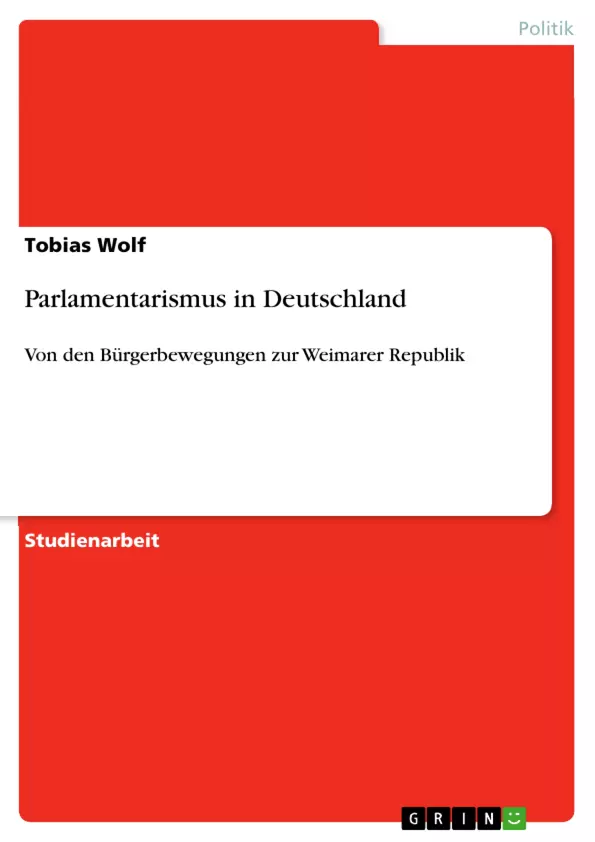Parlamentarismus im Sinne eines tagenden und verhandelnden Rates bzw. einer demokratisch gewählten oder anderweitig legitimierten Interessenvertretung hat eine lange Historie, die im Rahmen einer Studienarbeit schwerlich umfassend bearbeitet werden kann.
Der Anspruch der vorliegenden Arbeit ist es daher, die Entstehung des Parlamentarismus sowie die Entwicklung von Demokratie und Teilhaberechten in Deutschland bis zum Beginn der Diktatur des Dritten Reiches nachzuzeichnen.
Neben einem kurzen historischen Exkurs, der das Aufkommen freiheitlich-bürgerlicher Mitspracheforderungen in Kontinentaleuropa bis zur Vormärzzeit thematisiert, liegt der Hauptfokus auf der Phase der parlamentarischen Entwicklung seit der Frankfurter Nationalversammlung von 1848 bis zum Ende der ersten deutschen Demokratie, der Weimarer Republik.
Zusammenfassend werden die unterschiedlichen historischen Perioden des Reichstages im Deutschen Reich bis 1918 und der Weimarer Demokratie betrachtet und deren Bedeutung für den gegenwärtigen parlamentarischen Verfassungsstaat der Bundesrepublik deutlich gemacht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kurze Geschichte des Parlamentarismus
- Entstehung des Begriffes Parlament
- Das englische Parlament als Keimzelle des modernen Parlamentarismus
- England als Vorbild Kontinentaleuropas und der amerikanischen Kolonien
- Die Entwicklung des Parlamentarismus in Deutschland bis 1918
- Die Ergebnisse des Wiener Kongresses und die Periode des Vormärz
- Die März-Revolution von 1848 und die erste deutsche Nationalversammlung
- Der Vorabend der Reichsgründung 1871
- Das Deutsche Reich als Verfassungsstaat
- Politik und Parteienlandschaft im Deutschen Reich 1871-1918
- Das Ende des Kaiserreiches
- Die Weimarer Republik
- Der Übergang von der Monarchie zur Demokratie
- Die Nationalversammlung als prägende Institution der Weimarer Republik
- Politische Entwicklungen nach dem Versailler Vertrag
- Der gefährdete Staat und die Rolle der Parteien
- Die Erosion des Weimarer Verfassungsstaates
- Der Weg in die nationalsozialistische Diktatur
- Abschlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, die Entstehung des Parlamentarismus und die Entwicklung von Demokratie und Teilhaberechten in Deutschland bis zum Beginn der nationalsozialistischen Diktatur nachzuzeichnen. Der Fokus liegt dabei auf der parlamentarischen Entwicklung seit der Frankfurter Nationalversammlung von 1848 bis zum Ende der Weimarer Republik. Die Arbeit beleuchtet auch die verschiedenen historischen Perioden des Reichstages im Deutschen Reich und der Weimarer Demokratie, um deren Bedeutung für den heutigen parlamentarischen Verfassungsstaat der Bundesrepublik Deutschland aufzuzeigen.
- Entstehung und Entwicklung des Parlamentarismus in Europa
- Einfluss des englischen Parlaments auf kontinentaleuropäische Entwicklungen
- Parlamentarische Entwicklung in Deutschland vom Vormärz bis zur Weimarer Republik
- Die Rolle von Parteien und politischen Entwicklungen im Deutschen Reich und der Weimarer Republik
- Der Übergang von der Monarchie zur Demokratie in Deutschland
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit untersucht die Entstehung des Parlamentarismus und die Entwicklung der Demokratie in Deutschland bis zum Dritten Reich. Sie konzentriert sich auf die Zeit von der Frankfurter Nationalversammlung 1848 bis zum Ende der Weimarer Republik und beleuchtet die Bedeutung dieser Entwicklungen für den heutigen deutschen Verfassungsstaat.
Kurze Geschichte des Parlamentarismus: Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung des Begriffs "Parlament", den Einfluss des englischen Parlaments als Keimzelle des modernen Parlamentarismus und dessen Vorbildfunktion für Kontinentaleuropa und die amerikanischen Kolonien. Es wird die Entwicklung vom Großen Rat des englischen Königs bis zur Bill of Rights von 1689 als Meilenstein der konstitutionellen Monarchie nachgezeichnet und der Einfluss dieser Entwicklung auf spätere Revolutionen und die Gründung der USA diskutiert. Die Bedeutung des englischen Common Law und der allmählichen Eingrenzung der königlichen Macht durch das Parlament werden hervorgehoben.
Die Entwicklung des Parlamentarismus in Deutschland bis 1918: Dieses Kapitel analysiert die Entwicklung des Parlamentarismus in Deutschland vom Wiener Kongress und der Vormärzzeit über die Märzrevolution von 1848 und die Frankfurter Nationalversammlung bis zur Gründung des Deutschen Reiches 1871. Es behandelt die politische Landschaft des Kaiserreichs, die Rolle der Parteien und das letztendliche Ende der Monarchie. Der Fokus liegt auf der allmählichen Entwicklung parlamentarischer Strukturen und der Herausforderungen, die sich daraus ergaben, einschließlich der begrenzten Macht des Parlaments im Vergleich zum Kaiser und den unterschiedlichen politischen Strömungen.
Die Weimarer Republik: Dieses Kapitel beschreibt den Übergang von der Monarchie zur Demokratie, die Rolle der Nationalversammlung und die politischen Entwicklungen nach dem Versailler Vertrag. Es analysiert die Herausforderungen, vor denen die junge Republik stand, die Rolle der Parteien und die zunehmende Erosion des demokratischen Systems. Die Kapitel beleuchtet die schrittweise Schwächung der Weimarer Republik und die Faktoren, die letztendlich zum Aufstieg der Nationalsozialisten beitrugen.
Schlüsselwörter
Parlamentarismus, Demokratie, Deutschland, Weimarer Republik, Deutsches Reich, Nationalversammlung, Französische Revolution, konstitutionelle Monarchie, Parteienlandschaft, Vormärz, Märzrevolution 1848, Bill of Rights, Verfassungsstaat.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument: Entwicklung des Parlamentarismus in Deutschland
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Das Dokument bietet einen umfassenden Überblick über die Entwicklung des Parlamentarismus in Deutschland vom Vormärz bis zum Ende der Weimarer Republik. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine Liste von Schlüsselbegriffen. Der Fokus liegt auf der Entstehung und Entwicklung parlamentarischer Strukturen und der Rolle von Parteien und politischen Ereignissen in diesem Zeitraum.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt die Entstehung des Parlamentarismus in Europa, den Einfluss des englischen Parlaments, die parlamentarische Entwicklung in Deutschland vom Vormärz bis zur Weimarer Republik, die Rolle von Parteien und politischen Entwicklungen im Deutschen Reich und der Weimarer Republik, sowie den Übergang von der Monarchie zur Demokratie in Deutschland. Es werden wichtige historische Ereignisse wie der Wiener Kongress, die Märzrevolution 1848, die Gründung des Deutschen Reiches und der Untergang der Weimarer Republik eingehend betrachtet.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument gliedert sich in die Kapitel "Einleitung", "Kurze Geschichte des Parlamentarismus", "Die Entwicklung des Parlamentarismus in Deutschland bis 1918", "Die Weimarer Republik" und "Abschlussbetrachtung". Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der parlamentarischen Entwicklung in Deutschland.
Was ist die Zielsetzung des Dokuments?
Das Dokument verfolgt das Ziel, die Entstehung des Parlamentarismus und die Entwicklung von Demokratie und Teilhaberechten in Deutschland bis zum Beginn der nationalsozialistischen Diktatur nachzuzeichnen. Der Fokus liegt auf der parlamentarischen Entwicklung seit der Frankfurter Nationalversammlung von 1848 bis zum Ende der Weimarer Republik. Es soll die Bedeutung dieser Entwicklungen für den heutigen parlamentarischen Verfassungsstaat der Bundesrepublik Deutschland aufgezeigt werden.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt?
Schlüsselwörter sind Parlamentarismus, Demokratie, Deutschland, Weimarer Republik, Deutsches Reich, Nationalversammlung, Französische Revolution, konstitutionelle Monarchie, Parteienlandschaft, Vormärz, Märzrevolution 1848, Bill of Rights, und Verfassungsstaat.
Welche Zeitspanne wird im Dokument abgedeckt?
Das Dokument behandelt die Zeitspanne von der Entstehung des Parlamentarismus bis zum Ende der Weimarer Republik, mit besonderem Fokus auf die Periode ab der Frankfurter Nationalversammlung 1848.
Welche Rolle spielt das englische Parlament im Dokument?
Das englische Parlament wird als Keimzelle des modernen Parlamentarismus dargestellt und sein Einfluss auf die Entwicklung des Parlamentarismus in Kontinentaleuropa und den amerikanischen Kolonien wird hervorgehoben.
Welche Bedeutung hat die Weimarer Republik im Kontext des Dokuments?
Die Weimarer Republik stellt einen zentralen Abschnitt des Dokuments dar, in dem der Übergang von der Monarchie zur Demokratie, die Herausforderungen der jungen Republik, die Rolle der Parteien und die schrittweise Erosion des demokratischen Systems analysiert werden.
- Arbeit zitieren
- Tobias Wolf (Autor:in), 2009, Parlamentarismus in Deutschland, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/160939