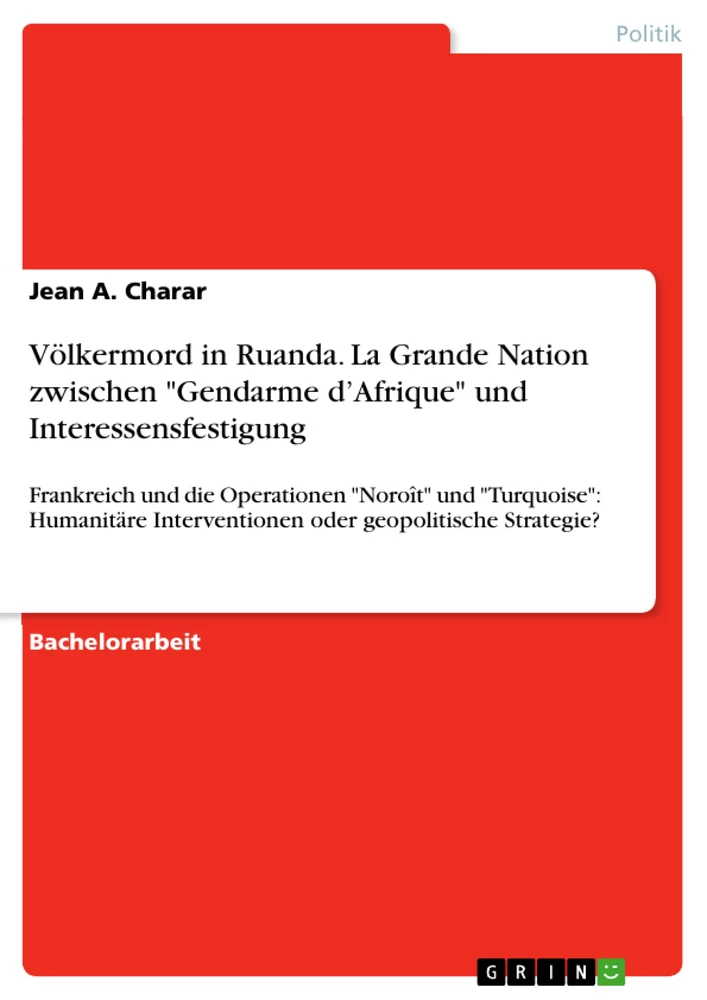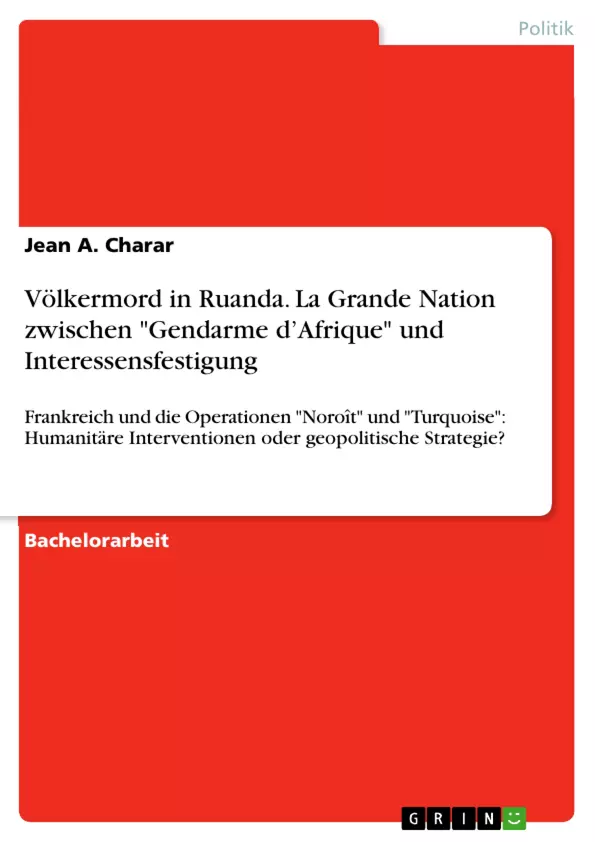Nach dem Völkermord in Ruanda von 1994, welcher dem Ruandaexperten Gérard Prunier zufolge mehr als 800.000 Menschen das Leben gekostet hat, ist Nicolas Sarkozy der erste französische Präsident, der Ruanda wieder einen offiziellen Besuch abstattet. Im Zuge dessen gesteht er erstmals „schwere Einschätzungsfehler“ sowie „politische Fehler“ Frankreichs ein. Kurz nach dem Aufenthalt Sarkozys in der ruandischen Hauptstadt Kigali berichtet die französische Zeitung Le Monde, die Witwe des ehemaligen ruandischen Präsidenten Juvénal Habyarimana sei in Paris vorläufig festgenommen worden. Sie wird verdächtigt, den Völkermord mit koordiniert und geplant zu haben. Agathe Habyarimana soll sich jedoch schon seit dem 9. April 1994 in der französischen Hauptstadt aufgehalten haben.
Als nicht eindeutig erklärbar erweist sich Frankreichs Interesse und (militärisches) Engagement in Ruanda. Denn Ruanda verfügt, im Gegensatz zur benachbarten Demokratischen Republik Kongo, über keine bedeutenden Ressourcen.
Aus diesem Grund soll der Frage nachgegangen werden, welche Bedeutung Ruanda für Frankreich hat und warum Paris das Regime des ehemaligen Präsidenten Habyarimana aktiv unterstützte. Darüber hinaus soll untersucht werden, ob es sich bei der französischen Militäroperation Noroît, sowie der Post-Genozid-Intervention Turquoise um, wie offiziell kommuniziert wurde, Operationen humanitären Charakters handelte, oder ob vielmehr nationale Interessensfestigung dominierte. Desweiteren zielt die vorliegende Arbeit darauf ab, die gegen Frankreich erhobenen Vorwürfe zu überprüfen.
Die deutsche und belgische Kolonialzeit und die damit verbundene (pseudo-)ethnische Differenzierung werden kurz skizziert, um die historisch sowie soziokulturell entstandenen Rivalitäten zwischen Tutsi und Hutu beleuchten zu können.
Der zweite Teil der Arbeit untersucht anfangs die Beziehung zwischen Frankreich und dem 1962 unabhängig gewordenen Ruanda, insbesondere die französischen Interessen an dem rohstoffarmen Land. Anschließend sollen die Operationen Noroît und Turquoise analysiert werden, wobei der Fokus auf letzterer liegen soll.
Der abschließende Teil der Arbeit beinhaltet den Vergleich zweier Objekte: Zum einen soll der Vorwurf der politischen, zum anderen der militärischen Unterstützung der ruandischen Regierung durch Frankreich beleuchtet werden. Die Wahl dieser Objekte lässt sich mit deren Wichtigkeit und der Schwere des Vorwurfs begründen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Einführung und Problemdefinition
- 1.2 Fragestellung, Aufbau und Ziel der Arbeit
- 2. Vom Kolonialruanda zum Völkermord
- 2.1 Le piège ethnique: Die europäische Kolonialzeit
- 2.2 Das explosive Jahrhundert: Eskalation der ethnischen Spannungen
- 2.3 Demokratisierungansätze und das Friedensabkommen von Arusha
- 3. Frankreich und Ruanda: eine zufällige,Freundschaft“?
- 3.1 Geostrategische und geopolitische Interessen
- 3.2 Wirtschaftliche Bindungen
- 3.3 Zwischen persönlichen Beziehungen und Vetternwirtschaft
- 4. Frankreichs militärische Interventionen: Nächstenliebe oder geopolitisches Kalkül?
- 4.1 Die Operation Noroît eine reine Schutzmaßnahme für europäische Staatsbürger?
- 4.2 Die Operation Turquoise : humanitäre oder politische Intervention?
- 5. Frankreich und Ruanda: eine Zwischenbilanz
- 6. Analyse der ruandischen Vorwürfe zur Beteiligung Frankreichs am Völkermord
- 6.1 Politische Unterstützung und gezielte Evakuierung
- 6.2 Kontinuierliche Kriegsbeteiligung
- 6.2.1 Die Beteiligung der Nachrichtendienste
- 6.2.2 Strategische und taktische Unterstützungsmaßnahmen
- 7. Die Schuldfrage: Französische Republik oder unkontrollierbare Akteure?
- 7.1 Zusammenfassung
- 7.2 Konklusion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit analysiert Frankreichs Rolle im Völkermord in Ruanda und untersucht die Frage, ob die französischen Operationen Noroît und Turquoise humanitäre Interventionen oder geopolitische Strategien waren. Ziel ist es, die französischen Interessen und Motive im Kontext des Völkermords zu ergründen und die Auswirkungen der Interventionen auf die politische und humanitäre Situation Ruandas zu beleuchten.
- Die europäische Kolonialzeit in Ruanda und die Entstehung ethnischer Spannungen.
- Die Eskalation der ethnischen Konflikte und der Ausbruch des Völkermords in Ruanda.
- Frankreichs geopolitische und wirtschaftliche Interessen in Ruanda.
- Die militärischen Interventionen Frankreichs in Ruanda: Operation Noroît und Operation Turquoise.
- Die Analyse der ruandischen Vorwürfe zur Beteiligung Frankreichs am Völkermord.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit führt in die Thematik des Völkermords in Ruanda ein und stellt die Forschungsfrage sowie die Zielsetzung der Arbeit dar. Das zweite Kapitel beleuchtet die Geschichte Ruandas unter der europäischen Kolonialherrschaft und die Entstehung der ethnischen Spannungen, die zum Völkermord führten. Das dritte Kapitel analysiert die Beziehungen zwischen Frankreich und Ruanda und untersucht die französischen geopolitischen und wirtschaftlichen Interessen in der Region. Das vierte Kapitel widmet sich den französischen militärischen Interventionen in Ruanda, Operation Noroît und Operation Turquoise, und hinterfragt deren wahre Motivationen. Das fünfte Kapitel analysiert die ruandischen Vorwürfe zur Beteiligung Frankreichs am Völkermord, wobei die Aspekte der politischen Unterstützung und der gezielten Evakuierung sowie die Rolle der französischen Nachrichtendienste im Vordergrund stehen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen Völkermord, Kolonialismus, ethnische Konflikte, Geopolitik, Frankreichs Außenpolitik, humanitäre Intervention, militärische Intervention, Operation Noroît, Operation Turquoise und die Schuldfrage. Sie beleuchtet die komplexen Verflechtungen zwischen Politik, Wirtschaft und Gewalt und untersucht die Rolle Frankreichs im Kontext des ruandischen Völkermords.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielte Frankreich beim Völkermord in Ruanda?
Frankreich wird vorgeworfen, das Habyarimana-Regime politisch und militärisch unterstützt zu haben, was trotz Kenntnis der Spannungen zur Eskalation beitrug.
Was war die "Operation Turquoise"?
Eine französische Militärintervention im Jahr 1994, die offiziell humanitäre Zwecke verfolgte, aber kritisiert wird, weil sie Tätern die Flucht in den Kongo ermöglicht haben soll.
Warum hatte Frankreich Interessen an Ruanda?
Obwohl Ruanda rohstoffarm ist, spielten geostrategische Interessen und der Erhalt des französischen Einflusses in Afrika ("Françafrique") eine zentrale Rolle.
Wie entstanden die ethnischen Rivalitäten in Ruanda?
Die Rivalitäten zwischen Hutu und Tutsi wurden maßgeblich während der deutschen und belgischen Kolonialzeit durch pseudo-ethnische Klassifizierungen verschärft.
Was gestand Nicolas Sarkozy 2010 in Ruanda ein?
Er räumte "schwere Einschätzungsfehler" und "politische Fehler" Frankreichs im Zusammenhang mit dem Völkermord ein, ohne jedoch eine direkte Mitschuld zu bestätigen.
- Arbeit zitieren
- Jean A. Charar (Autor:in), 2010, Völkermord in Ruanda. La Grande Nation zwischen "Gendarme d’Afrique" und Interessensfestigung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/160950