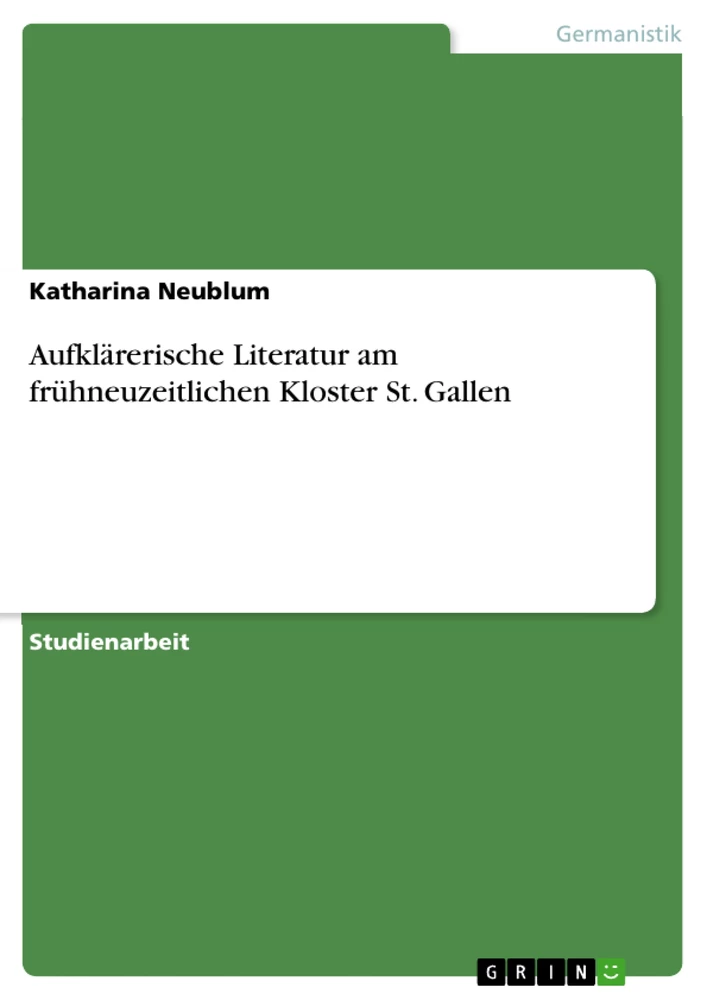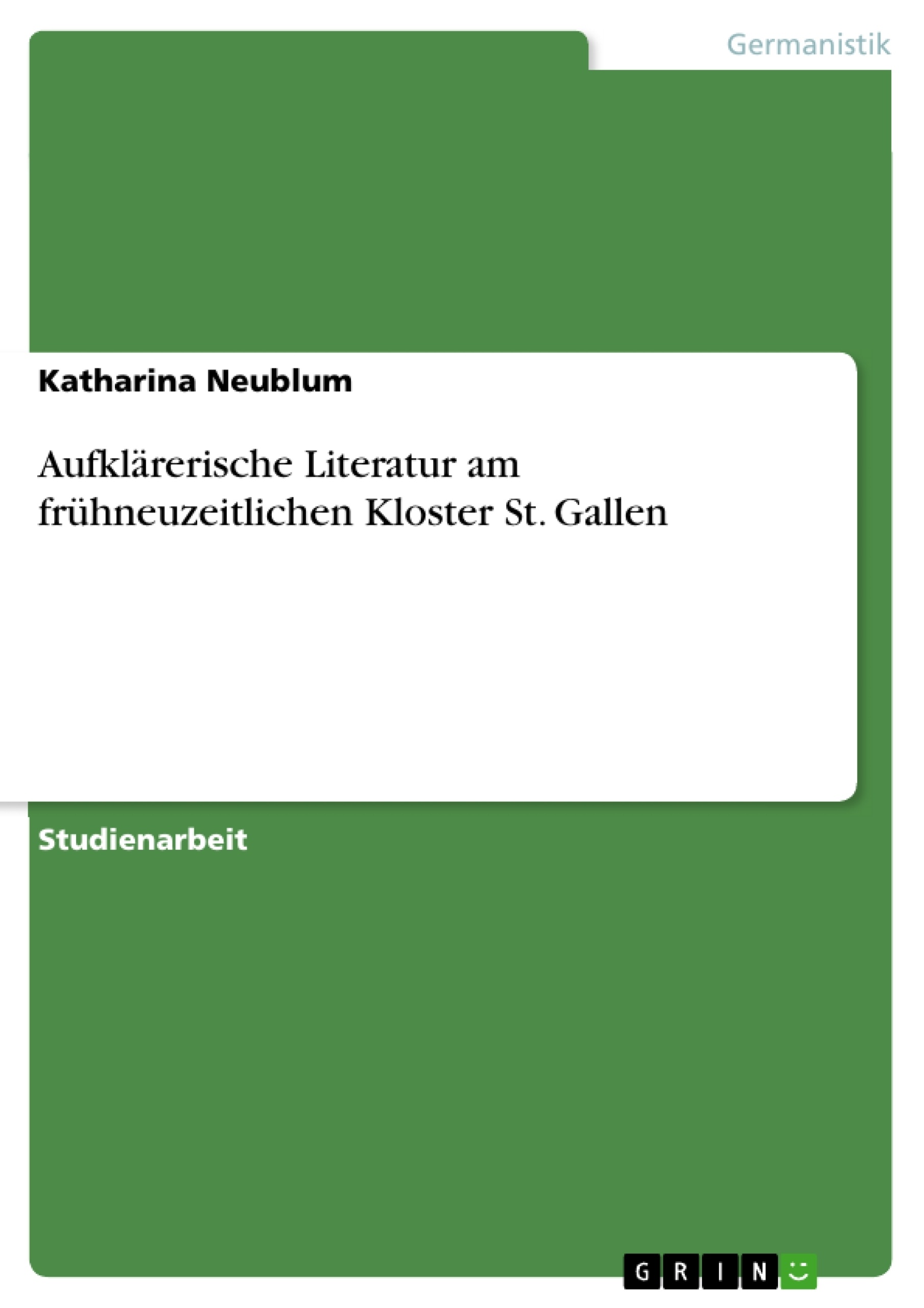Vor nun annähernd 500 Jahren gelang es Martin Luther, weit reichende Veränderungen hervorzurufen und damit eine neue Ära einzuläuten, die wir heute als Frühe Neuzeit bezeichnen. Luthers 95 Thesen waren mit ausschlaggebend für eine Reformation innerhalb der Kirche, die noch weit reichende Erneuerungen hervorrufen sollte. In diese Zeit, allerdings nun schon ein Jahrhundert später, fällt auch das „Zeitalter der Aufklärung“. Neue Erkenntnisse und Ansichten beeinflussten die Menschen, auf dem Land ebenso wie in der Stadt. Betroffen von der Aufklärung waren ebenfalls, auch wenn sie sich anfangs sehr gegen aufklärerisches Denken wehrten, die Mönche an den Klöstern. Diese Arbeit soll einen Blick auf die Literatur am frühneuzeitlichen Kloster in St. Gallen werfen. Hierbei wird ein Mönch in den Fokus der Betrachtungen gestellt, der über Jahre hinweg für die Literatur der Hautbibliothek eines Klosters verantwortlich gewesen ist: Pater Johann Nepomuk Hauntinger, Bibliothekar der Hauptbibliothek des Klosters St. Gallen im späteren 18. Jahrhundert. Durch ihn und die von ihm angeschaffte Literatur während seiner Amtszeit soll ein Überblick darüber gewonnen werden, inwiefern das Kloster der Frühen Neuzeit von der Aufklärung berührt war. Im ersten Teil der Arbeit ist ein kurzer historischer Rückblick gegeben, um eine Vorstellung darüber zu bekommen, wie das Leben im 18. Jahrhundert ausgesehen hat und welche Ereignisse in der Frühen Neuzeit datiert werden können. Weiter soll der Begriff der Aufklärung genauer definiert und Ansichten von Aufklärern dargstellt werden, um ein Verständnis dafür zu bekommen, warum die Aufklärung so weit reichende Folgen mit sich bringen konnte. Auch soll deutlich werden, warum es für einen katholischen Mönch so schwierig ist, sich mit den Auswirkungen der Aufklärung anzufreunden. Daher werfen wir auch einen Blick auf das Leben eines Benediktinermönchs im Kloster und setzen uns mit den dortigen Vorschriften und Lebensinhalten auseinander. Im nächsten Schritt geht es dann um den Bibliothekar Hauntinger, um sein Leben und seine Person, damit wir wissen, was er für ein Mensch gewesen ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Geschichtlicher Rückblick
- Frühe Neuzeit
- Aufklärung
- Das Kloster St. Gallen
- Der Benediktinermönch
- Der Bibliothekar Johann Nepomuk Hauntinger
- Literatur am Kloster
- Die theologischen Disziplinen
- Die Rechtswissenschaft
- Die philosophischen Fächer
- Lexiken und Grammatiken
- Dichtung und übrige schöne Künste
- Gelehrsamkeitsgeschichte
- Kirche und Profangeschichte, Historische Hilfswissenschaften
- Politik und Zeitgeschichte
- Geographie und Reiseliteratur
- Naturwissenschaften
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Literatur am frühneuzeitlichen Kloster St. Gallen im 18. Jahrhundert, speziell mit dem Einfluss der Aufklärung auf die Klosterbibliothek. Das Hauptaugenmerk liegt auf Pater Johann Nepomuk Hauntinger, dem Bibliothekar, und seinen Bestrebungen, die Bibliothek mit aufklärerischer Literatur zu erweitern.
- Die Rolle der Aufklärung in der Frühen Neuzeit
- Die Lebensbedingungen und die Vorschriften im Benediktinerkloster
- Die Erwerbspolitik des Bibliothekars Hauntinger
- Die Kategorien der Literatur in der Klosterbibliothek
- Die Frage, ob Hauntinger ein Aufklärer war
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einem kurzen historischen Rückblick auf die Frühe Neuzeit und die Aufklärung, um den Kontext für die Untersuchung der Klosterliteratur zu schaffen. Anschließend wird das Kloster St. Gallen und das Leben eines Benediktinermönchs vorgestellt. Besonderes Augenmerk liegt auf der Person des Bibliothekars Johann Nepomuk Hauntinger. Im nächsten Kapitel werden die verschiedenen Arten von Literatur in der Klosterbibliothek vorgestellt, wobei die Schwerpunkte auf den Bereichen Theologie, Rechtswissenschaft und Philosophie liegen. Die Arbeit endet mit der Frage, ob Hauntinger tatsächlich ein Anhänger der Aufklärung war.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Klosterkultur, Aufklärung, Literatur am Kloster St. Gallen, Johann Nepomuk Hauntinger, Erwerbspolitik, Theologie, Rechtswissenschaft, Philosophie, Geschichte, Geographie, Naturwissenschaften, Benediktinermönch.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Pater Johann Nepomuk Hauntinger?
Er war der Bibliothekar der Hauptbibliothek des Klosters St. Gallen im späten 18. Jahrhundert und verantwortlich für die Modernisierung der Literaturbestände.
Wie beeinflusste die Aufklärung das Klosterleben?
Trotz anfänglichen Widerstands drangen aufklärerische Ideen über die Literatur in die Klöster ein und beeinflussten die Ansichten der Mönche über Wissenschaft und Gesellschaft.
Welche Arten von Literatur schaffte Hauntinger an?
Neben Theologie erwarb er Werke aus den Bereichen Rechtswissenschaft, Philosophie, Naturwissenschaften, Geographie und Reiseliteratur.
War Hauntinger selbst ein Aufklärer?
Die Arbeit untersucht dies kritisch; er war zumindest ein Vermittler aufklärerischen Wissens, der die Bibliothek für moderne wissenschaftliche Strömungen öffnete.
Warum war die Aufklärung für Benediktinermönche problematisch?
Viele aufklärerische Ansichten stellten traditionelle kirchliche Dogmen und die strengen Klosterregeln infrage, was zu inneren Konflikten führte.
- Quote paper
- Katharina Neublum (Author), 2008, Aufklärerische Literatur am frühneuzeitlichen Kloster St. Gallen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/160966