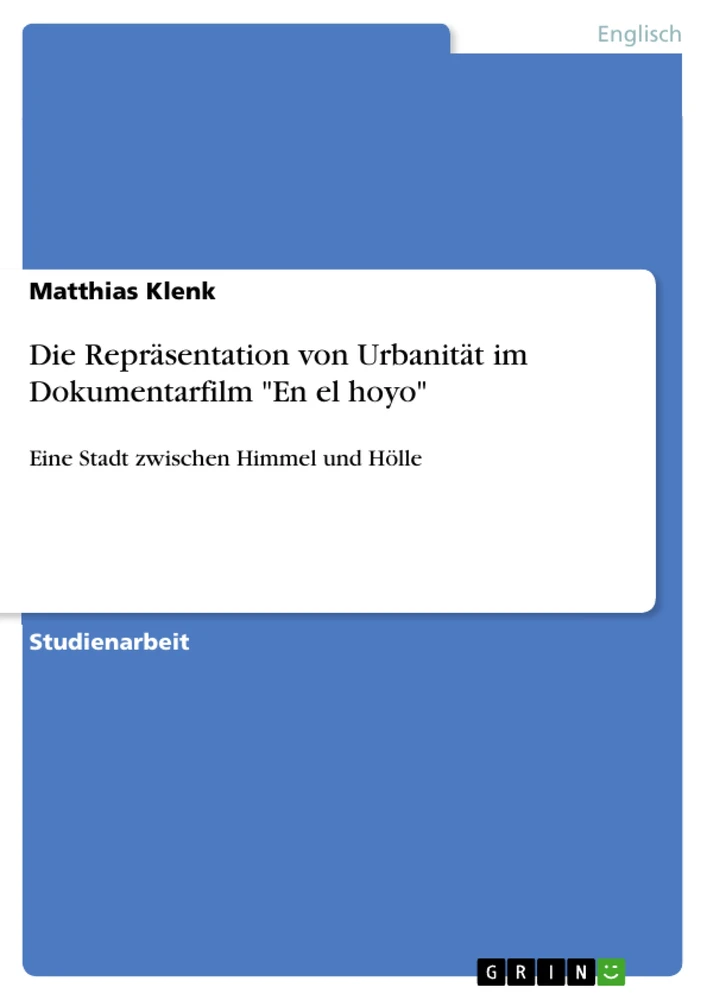Seit der Erfindung laufender Bilder sind Stadt und Film untrennbar miteinander verwoben. Anfangs v.a. materialistischer, klassenhistorischer und gesellschaftlicher Faktoren geschuldet, wurde auch die Lebenswelt der Mehrheit der Menschen weltweit von einer Ländlichen zu einer Urbanen. Dabei sind Mexiko und seine Hauptstadt keine Ausnahme, sondern, für lateinamerikanische Verhältnisse, schon sehr früh Teil der urbanen Revolution, durch die Migration vom Land in die Stadt. Auch im Filmischen war Mexiko- Stadt von Anbeginn der cineastischen Zeitrechnung in Mexiko die Hauptstadt der Filmproduktion und Ausdruck des modernen urbanen Lebens. Wie Alfaro in einem der ersten, Kino und urbanes Mexiko ansprechenden, Artikel feststellt: „A partir de allí, la práctica cinematográfica puede o debe aludir a la escala de valores, la habla, a las formas de trabajo, a la estructura familiar, a los espacios habitables o a la neurosis típicamente citadinos“ (Alfaro 1982: 176).
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Urbanität
- 2.1. Verkehrschaos und Überbevölkerung Mexiko-Stadt
- 2.2. Die Stadt - das Urbane theoretisch gefasst
- 3. Methodische Überlegungen
- 3.1. Mexikanischer Dokumentarfilm im historischen Abriss
- 3.2. Ausarbeitung der Methodik
- 4. En el hoyo unter der Lupe - die Analyse
- 4.1. Einleitung En el hoyo
- 4.2. Analyse der Erzählstruktur
- a) Zwischen Himmel und Hölle: das Sequenzprotokoll
- b) Die Stadt in Erzählungen: Großstadtmythen/Legende
- c) Stadt-Land-Diskurs (Migration)
- d) Generationen und Traditionen
- e) Wünsche und Hoffnungen: Vorstellung von Konsum und urbanen Träumen
- 4.3. Technisch-ästhetische Analyse
- a) Die Zeit im Raffer: Rulfos Montage
- b) Sound of the City: Ton und Musik
- c) Die Stadt aus Sicht des Autofahrers: die Motivwahl
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Repräsentation von Urbanität im mexikanischen Dokumentarfilm, insbesondere in Juan Carlos Rulfos "En el hoyo". Ziel ist es, die Darstellung von Mexiko-Stadt als komplexes urbanes Zentrum im Kontext des mexikanischen Dokumentarfilms zu analysieren. Die Arbeit beleuchtet den Zusammenhang zwischen Film und Stadtentwicklung sowie die spezifischen filmischen Mittel, die zur Darstellung urbaner Herausforderungen eingesetzt werden.
- Die Repräsentation von Urbanität in mexikanischen Dokumentarfilmen
- Die filmische Darstellung von Verkehrsproblemen und Überbevölkerung in Mexiko-Stadt
- Analyse der Erzählstruktur und ästhetischen Mittel in "En el hoyo"
- Der historische Kontext des mexikanischen Dokumentarfilms
- Der Stadt-Land-Diskurs und seine filmische Umsetzung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die Forschungslücke bezüglich der Analyse von Urbanität im mexikanischen Dokumentarfilm heraus. Sie betont die enge Verbindung zwischen Stadt und Film und führt den ausgewählten Film "En el hoyo" von Juan Carlos Rulfo als Fallbeispiel ein. Die Arbeit skizziert ihren methodischen Ansatz und die Gliederung der Analyse, die von der historischen Entwicklung der Stadt über theoretische Konzepte von Urbanität zur filmischen Analyse führt.
2. Urbanität: Dieses Kapitel beleuchtet die komplexe Realität von Mexiko-Stadt, beginnend mit ihrer historischen Entwicklung von der aztekischen Hauptstadt Tenochtitlán bis zur heutigen Megacity. Es beschreibt das stetige Wachstum, die Herausforderungen der Überbevölkerung und des Verkehrschaos, und verortet die Stadt im Kontext globaler Urbanisierungsprozesse. Die Betrachtung historischer Ereignisse wie der spanischen Eroberung und der Unabhängigkeitskriege unterstreicht die Bedeutung der Stadt in der mexikanischen Geschichte und legt den Grundstein für das Verständnis der gegenwärtigen Herausforderungen.
Schlüsselwörter
Mexikanischer Dokumentarfilm, Urbanität, Mexiko-Stadt, En el hoyo, Juan Carlos Rulfo, Verkehrschaos, Überbevölkerung, Stadtentwicklung, Filmanalyse, Erzählstruktur, ästhetische Mittel, Stadt-Land-Diskurs, Migration.
Häufig gestellte Fragen zu "En el hoyo": Eine Analyse der Urbanität im mexikanischen Dokumentarfilm
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Darstellung von Urbanität im mexikanischen Dokumentarfilm, speziell in Juan Carlos Rulfos Film "En el hoyo". Der Fokus liegt auf der Repräsentation von Mexiko-Stadt als komplexes urbanes Zentrum und den filmischen Mitteln, die zur Darstellung urbaner Herausforderungen verwendet werden.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Repräsentation von Urbanität in mexikanischen Dokumentarfilmen, die filmische Darstellung von Verkehrsproblemen und Überbevölkerung in Mexiko-Stadt, die Analyse der Erzählstruktur und ästhetischen Mittel in "En el hoyo", den historischen Kontext des mexikanischen Dokumentarfilms und den Stadt-Land-Diskurs und seine filmische Umsetzung.
Welche Methodik wird angewendet?
Die Arbeit kombiniert eine historische Betrachtung der Stadtentwicklung Mexiko-Stadts mit theoretischen Konzepten der Urbanität und einer detaillierten filmischen Analyse von "En el hoyo". Die Analyse umfasst die Erzählstruktur, die ästhetischen Mittel (Montage, Ton, Motivwahl) und den Kontext des Films innerhalb der Geschichte des mexikanischen Dokumentarfilms.
Wie ist die Arbeit gegliedert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Urbanität (inkl. theoretischer Konzepte und der konkreten Situation in Mexiko-Stadt), Methodische Überlegungen (inkl. historischem Abriss des mexikanischen Dokumentarfilms), Analyse von "En el hoyo" (inkl. Erzählstruktur- und technisch-ästhetischer Analyse) und Fazit.
Welche Aspekte der Erzählstruktur von "En el hoyo" werden analysiert?
Die Analyse der Erzählstruktur in "En el hoyo" umfasst die Sequenzanalyse, die Untersuchung von Großstadtmythen und Legenden, den Stadt-Land-Diskurs (Migration), die Darstellung von Generationen und Traditionen sowie die Darstellung von Wünschen, Hoffnungen und Konsumträumen.
Welche technisch-ästhetischen Aspekte werden analysiert?
Die technisch-ästhetische Analyse von "En el hoyo" konzentriert sich auf Rulfos Montagetechniken, die Rolle von Ton und Musik, und die Motivwahl, insbesondere die Perspektive des Autofahrers.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Mexikanischer Dokumentarfilm, Urbanität, Mexiko-Stadt, En el hoyo, Juan Carlos Rulfo, Verkehrschaos, Überbevölkerung, Stadtentwicklung, Filmanalyse, Erzählstruktur, ästhetische Mittel, Stadt-Land-Diskurs, Migration.
Welche Forschungslücke schließt die Arbeit?
Die Arbeit schließt die Forschungslücke bezüglich der Analyse von Urbanität im mexikanischen Dokumentarfilm. Sie bietet eine detaillierte Fallstudie, die die enge Verbindung zwischen Stadt und Film aufzeigt.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler*innen und Studierende der Filmwissenschaft, Stadtforschung, Medienwissenschaft und Lateinamerikastudien, die sich für die Repräsentation von Urbanität im Film und die Geschichte des mexikanischen Kinos interessieren.
- Quote paper
- Matthias Klenk (Author), 2009, Die Repräsentation von Urbanität im Dokumentarfilm "En el hoyo", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/160983