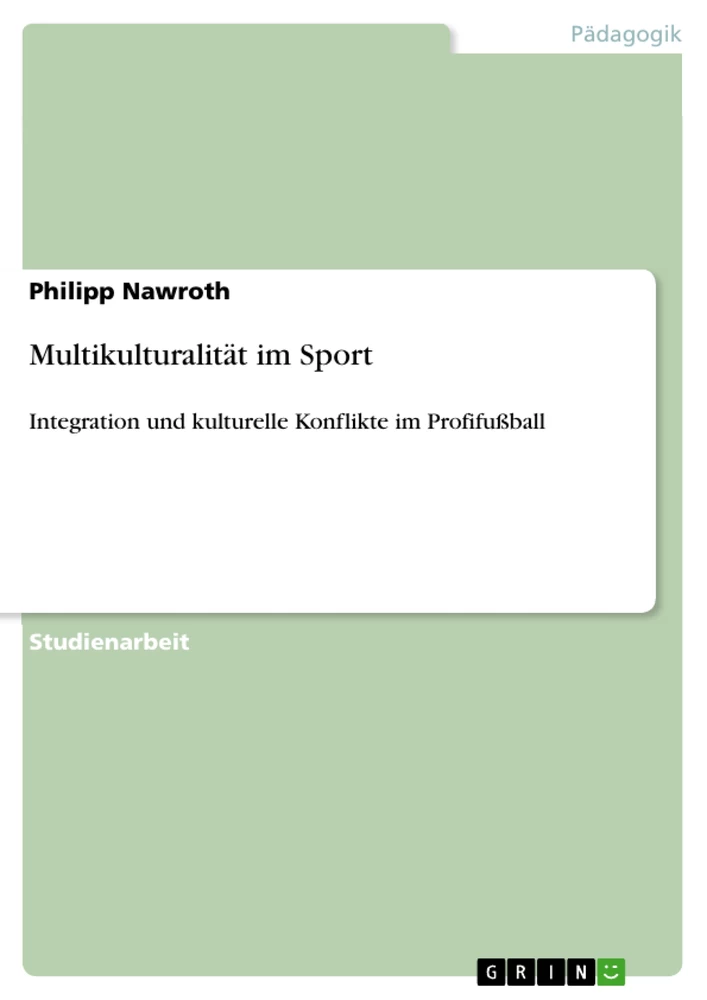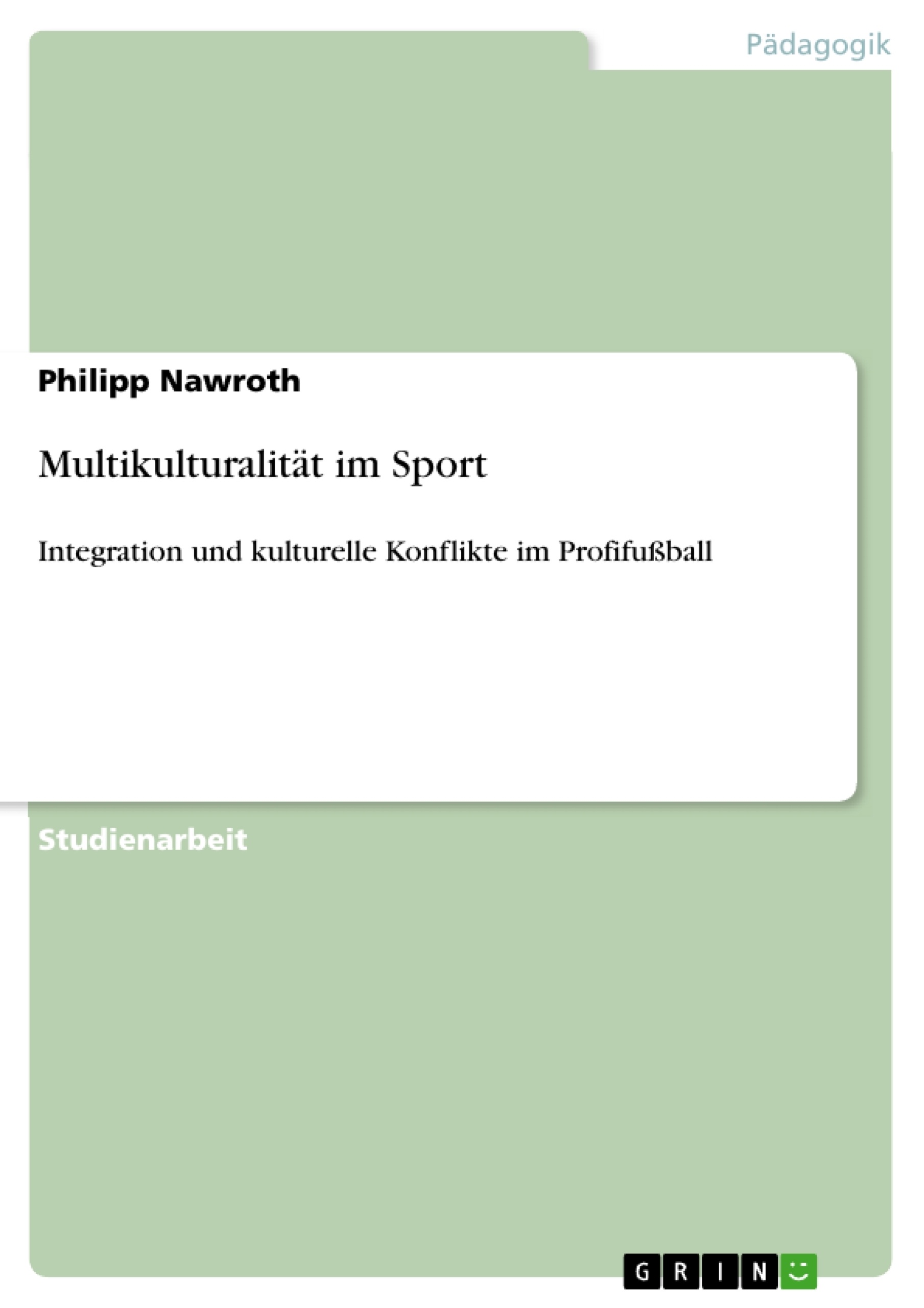Fußball beschäftigt und begeistert jeden Tag weltweit Millionen von Menschen. Die
Faszination, die dieser Sport zweifellos auszustrahlen scheint, fördert mehr noch als in
anderen Sportarten den Zusammenhalt von Gruppen und schafft Zugehörigkeiten und
Prozesse der bedingungslosen Identifikation. Die Anhängerschaft der großen
Profivereine stellt sich mit einer derartigen Hingabe dar, die so kaum anderswo zu
beobachten ist. Auch die Auswahlmannschaften der Länder vereinen oftmals ihre
Nation in einer besonders intensiven Weise hinter sich.
Einige Faktoren nehmen im modernen Fußball jedoch Einfluss auf das traditionelle
Zugehörigkeitsempfinden des Sportlers sowie des Betrachters zu seinem Verein oder
seiner Nationalmannschaft.
Die zunehmende mediale Vermarktung des professionellen Sports und die Entwicklung
des bloßen athletischen Wettstreits hin zum gesellschaftlichen Großereignis beeinflusst
das Verhalten der Akteure sowie des Publikums ganz erheblich. Der Sportzuschauer
wird in hochmodernen Arenen und mit der Fernsehübertragung eines Spiels aus jedem
denkbaren Blickwinkel immer mehr zum Konsumenten einer
Unterhaltungsdienstleistung gemacht und die Konzentration verlagert sich vom reinen
sportlichen Mitfiebern mit dem Heimatverein hin zur oftmals erfolgsabhängigen
Sympathie mit einem Club, deren Ursprünge nur zum Teil in lokaler Zugehörigkeit
liegen. Wie bei jedem Eingriff in ein vormals bestehendes vermeintliches
gesellschaftliches Gleichgewicht bleibt es jedoch nicht aus, dass sich konträr dazu
Gruppierungen formieren, in denen Vereinstreue und lokale Zugehörigkeit höchste
Priorität besitzen.
Zudem bewirkt die Entwicklung der ursprünglichen Sportvereine, die heute zunehmend
als Wirtschaftsunternehmen verstanden werden müssen, dass kulturelle und lokale
Zugehörigkeiten auf Seiten der Sportler selten werden. Fußballspieler scheinen in
erster Linie Arbeitnehmer zu sein, deren sportliches Handwerk sie in großen
konkurrierenden Wirtschaftsbetrieben ausüben und dabei nicht unerhebliche
Verdienste für ihre Leistungen empfangen. Vereine sind am Erfolg orientiert und
können geeignetes Spielermaterial für Geld erwerben und handeln auf einem weltweit
organisierten und unter Vermittlern aufgeteilten Transfermarkt.
Diese Verschiebungen bezüglich der Bedeutung von regionaler, nationaler und
kultureller Zugehörigkeit eröffnen eine Vielzahl von Perspektiven.
In dieser Hausarbeit wird der moderne Fußball auf seine kulturellen Erscheinungen hin
untersucht.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Beispiele der Integration in Fußballnationalmannschaften
- 2.1 Französische Nationalmannschaft bei der WM 1998
- 2.2 Deutsche U21-Nationalmannschaft bei der Junioren-EM 2009
- 3 Konfliktpotenzial durch kulturelle Verschiedenheit und regionale Besonderheiten
- 3.1 Rassismus im Fußball
- 3.2 Regionale Rivalitäten
- 4 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert den modernen Fußball im Hinblick auf seine kulturellen Aspekte. Die Arbeit untersucht, wie sich die Integration und Multikulturalität in zwei europäischen Nationalmannschaften – der französischen WM-Mannschaft von 1998 und der deutschen U21-Nationalmannschaft bei der Junioren-EM 2009 – manifestiert. Des Weiteren wird das Konfliktpotenzial, das durch kulturelle Unterschiede und regionale Rivalitäten entsteht, beleuchtet. Im Fokus steht dabei die Frage, ob der Fußball die Möglichkeit hat, Integration und Zusammengehörigkeit in einer multikulturellen Welt zu fördern.
- Integration und Multikulturalität im Fußball
- Kulturelle Unterschiede und Konfliktpotenzial
- Rolle des Fußballs in einer multikulturellen Welt
- Regionale Rivalitäten im Fußball
- Zusammenhang zwischen dem Fußball und gesellschaftlichen Umstrukturierungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Fußballs in Bezug auf gesellschaftliche Zusammenhänge und Identifikationsprozesse heraus. Es werden die Einflussfaktoren der medialen Vermarktung und der ökonomischen Entwicklung des Profifußballs beleuchtet, die zu Veränderungen in der Wahrnehmung von regionaler und nationaler Zugehörigkeit führen.
Kapitel 2 präsentiert zwei exemplarische Nationalmannschaften, die den Umgang mit Integration und Multikulturalität innerhalb eines Nationalteams veranschaulichen. Die französische Nationalmannschaft bei der WM 1998 wird im Hinblick auf die hohe Anzahl an Spielern mit Migrationshintergrund analysiert, während Kapitel 2.2 die deutsche U21-Nationalmannschaft bei der Junioren-EM 2009 in Bezug auf ihre Integrationsbemühungen beleuchtet.
Kapitel 3 befasst sich mit den potenziellen Konflikten, die durch kulturelle Verschiedenheit und regionale Besonderheiten im Fußball entstehen können. Es werden Rassismus im Fußball sowie regionale Rivalitäten mit gesellschaftlich-kulturellem Hintergrund behandelt.
Schlüsselwörter
Diese Hausarbeit befasst sich mit den Themen Integration, Multikulturalität, Rassismus, regionale Rivalitäten, Fußballnationalmannschaften, gesellschaftliche Umstrukturierung und dem Einfluss des Fußballs auf die Gesellschaft.
Häufig gestellte Fragen
Kann Fußball die Integration fördern?
Ja, Fußball schafft durch gemeinsame Ziele und Identifikation ein Gefühl der Zusammengehörigkeit, das kulturelle Grenzen überwinden kann.
Welche Bedeutung hatte die französische Nationalmannschaft 1998?
Das „Black-Blanc-Beur“-Team galt als Symbol für ein multikulturelles Frankreich und zeigte, wie Erfolg zur nationalen Einheit beitragen kann.
Was sind die Ursachen für Rassismus im Fußball?
Rassismus resultiert oft aus gesellschaftlichen Vorurteilen, die im Stadion durch Gruppendynamiken und Rivalitäten instrumentalisiert werden.
Wie wirkt sich die Kommerzialisierung auf die Vereinstreue aus?
Fans werden zunehmend zu Konsumenten, was die traditionelle lokale Bindung schwächen kann, während gleichzeitig Gegenbewegungen für „echte“ Vereinstreue entstehen.
Was versteht man unter regionalen Rivalitäten im Fußball?
Konflikte zwischen Vereinen, die oft auf historischen, kulturellen oder sozialen Unterschieden zwischen Städten oder Regionen basieren.
- Quote paper
- Philipp Nawroth (Author), 2010, Multikulturalität im Sport, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/161048