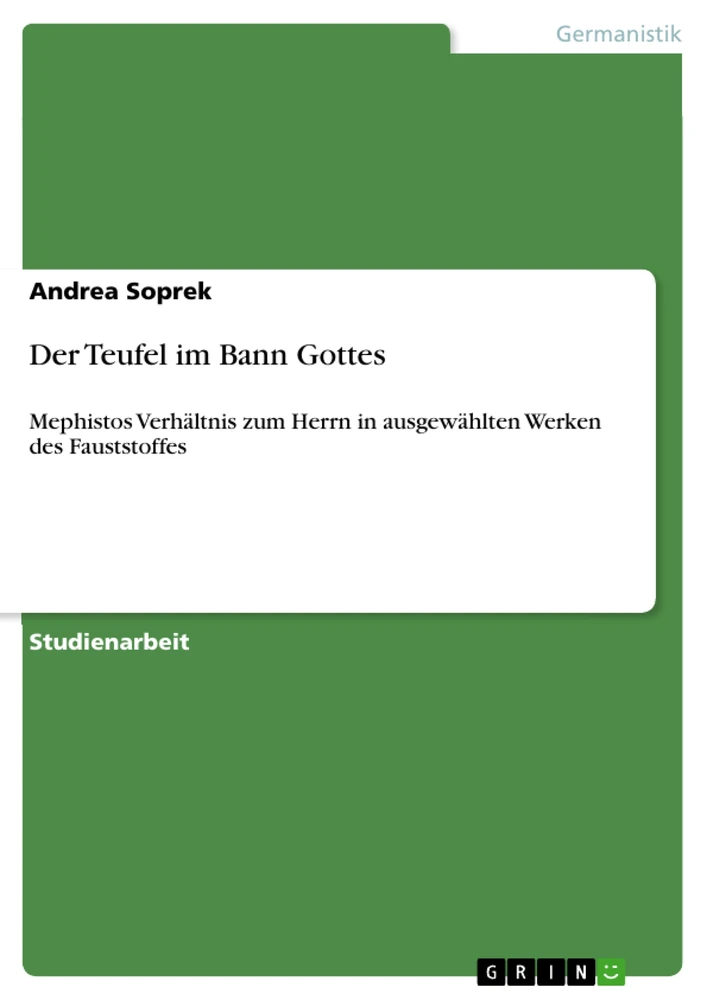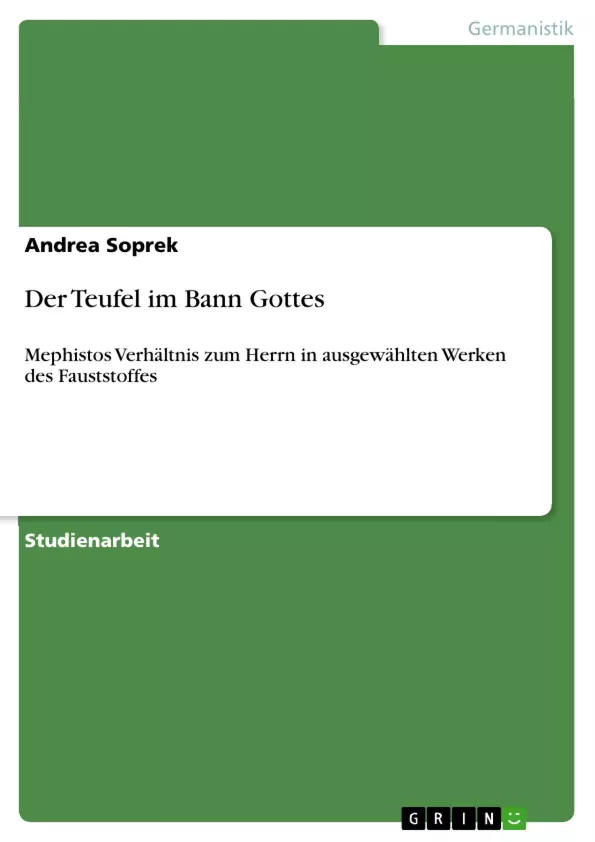Nachdem in der Faustforschung lange Zeit das Augenmerk nahezu ausschließlich auf dem Titelhelden ruhte, und sein so essentieller Gegenspieler, der Teufel, großenteils unbeachtet blieb, bzw. auf den typischen, bösen Teufel reduziert wurde, wendet sich die Literaturkritik in letzter Zeit mehr und mehr ihm, dem Widersacher zu. Dies ist um so wichtiger, als der Teufel in der Zeit der Reformation, in der die Anfänge des Fauststoffes fußen, einen großen Zuwachs an Popularität erfuhr, aber auch zahlreichen Veränderungen unterworfen war.
Inhaltsverzeichnis
- Der Teufel in der Reformation
- Mephistopheles Verhältnis zu Gott in verschiedenen Stufen der Fausttradition
- Ursprung und Bedeutung des Teufelsnamens
- Mephistopheles
- Leviathan
- Historia von D Johann Fausten
- Textanalyse
- Marlowes „Die tragische Historie vom Doktor Faustus“
- Textanalyse
- Klingers „Fausts Leben, Taten und Höllenfahrt“
- Textanalyse
- Goethes Urfaust
- Textanalyse
- Die Theodizee als gemeinsames Motiv der Faustbearbeitungen
- Ursprung und Bedeutung des Teufelsnamens
- Die „Historia als der Grundstein der Fausttradition
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung des Mephistopheles-Charakters in verschiedenen Faust-Adaptionen, angefangen vom Volksbuch „Historia von D Johann Fausten“ bis hin zu Goethes „Urfaust“. Der Fokus liegt dabei auf Mephistopheles' Verhältnis zum Herrn und wie sich dieses Verhältnis in den unterschiedlichen Epochen und Interpretationen der Faust-Thematik entwickelt hat.
- Die Rolle des Teufels in der Reformation und die Bedeutung des Teufelsbildes für die Fausttradition
- Die Entwicklung des Mephistopheles-Charakters von einer stereotypen bösen Gestalt zu einer komplexen und vielschichtigen Persönlichkeit
- Das Verhältnis zwischen Mephistopheles und dem Herrn und die Frage nach der Macht und dem Einfluss Gottes auf die Welt
- Die Theodizee als gemeinsames Motiv in der Faustliteratur und die Frage nach der Rechtfertigung Gottes im Angesicht des Leids
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit der Rolle des Teufels in der Reformation und zeigt auf, wie die protestantische Lehre die Angst vor dem Teufel und seine Macht neu belebte. Der zweite Teil der Arbeit analysiert die Entwicklung des Mephistopheles-Charakters in verschiedenen Faust-Adaptionen. Die „Historia von D Johann Fausten“ wird als der Ursprung der Fausttradition betrachtet, während die Werke von Marlowe und Klinger die Entwicklung des Mephistopheles-Charakters und sein Verhältnis zum Herrn weiter erforschen. Das Kapitel über Goethes „Urfaust“ analysiert die vielschichtige und respektlose Teufelsgestalt, die Goethe in seinem Werk geschaffen hat. Abschließend wird die Theodizee als ein gemeinsames Motiv in der Faustliteratur erörtert.
Schlüsselwörter
Fauststoff, Mephistopheles, Teufel, Gott, Reformation, Theodizee, Volksbuch, „Historia von D Johann Fausten“, Marlowe, Klinger, Goethe, „Urfaust“, Teufelsbündnis, Literaturkritik.
Häufig gestellte Fragen
Wie entwickelte sich der Charakter des Mephistopheles in der Literatur?
Die Arbeit zeigt die Entwicklung von einer stereotypen bösen Gestalt im Volksbuch bis hin zu einer komplexen, vielschichtigen Persönlichkeit bei Goethe auf.
Welche Rolle spielte der Teufel in der Reformationszeit?
In der Reformation erlebte das Teufelsbild einen Popularitätsschub, da die protestantische Lehre die ständige Gegenwart und Gefahr des Widersachers betonte.
Was bedeutet das Motiv der "Theodizee" im Fauststoff?
Es geht um die Frage nach der Rechtfertigung Gottes angesichts des Leids und des Bösen in der Welt, personifiziert durch das Wirken des Teufels.
Welche Faust-Bearbeitungen werden in der Arbeit analysiert?
Analysiert werden unter anderem das Volksbuch "Historia von D. Johann Fausten", sowie Werke von Marlowe, Klinger und Goethes "Urfaust".
Woher stammt der Name "Mephistopheles"?
Die Arbeit untersucht den Ursprung und die Bedeutung des Namens sowie alternative Bezeichnungen wie "Leviathan" im Kontext der Tradition.
- Arbeit zitieren
- Andrea Soprek (Autor:in), 2008, Der Teufel im Bann Gottes, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/161073