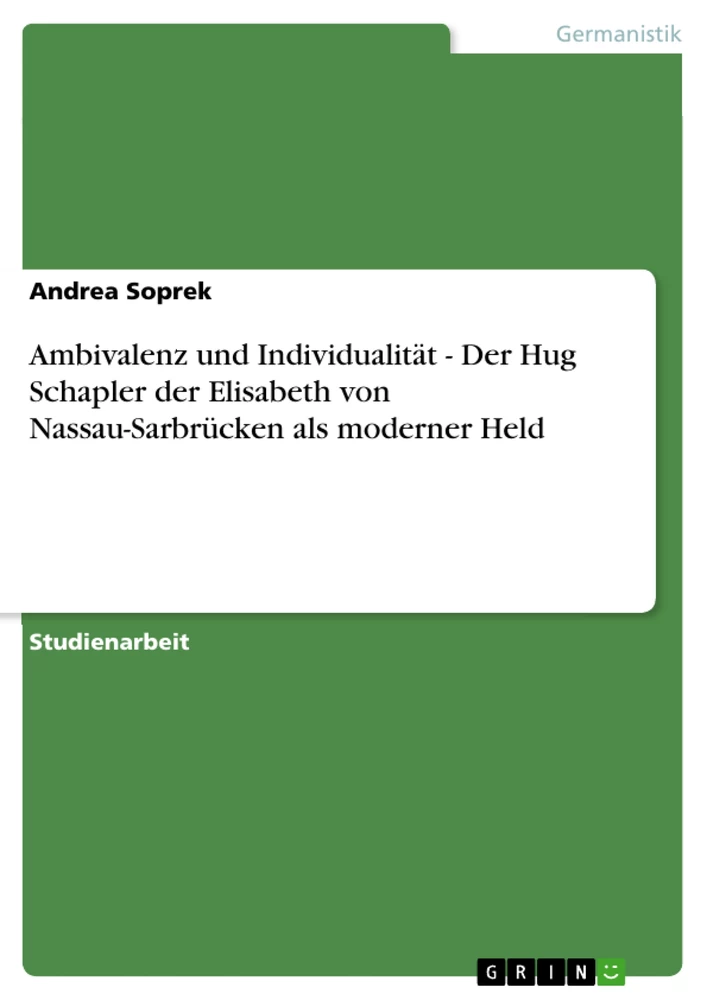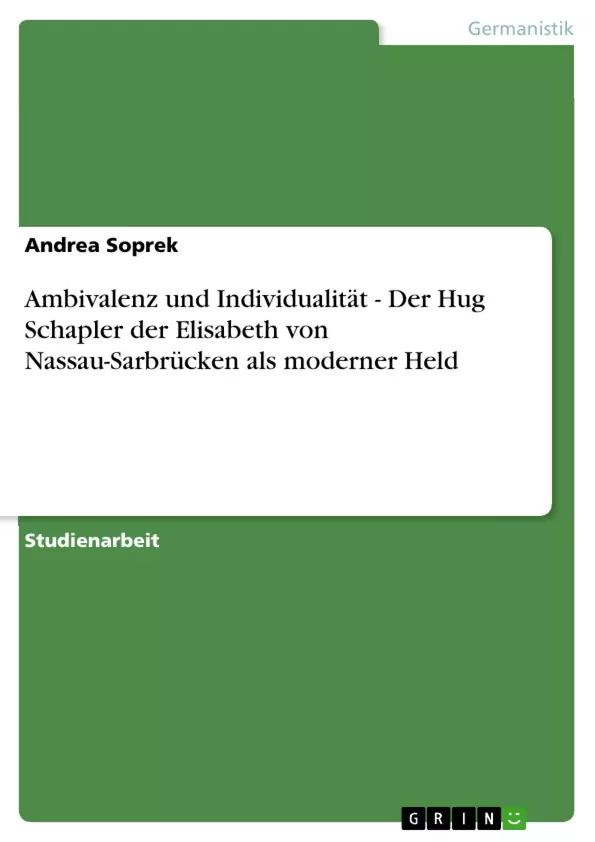Die Prosaauflösungen der Elisabeth von Lothringen, Gräfin von Nassau-Saarbrücken
Die Prosaauflösungen, die der deutsch-französischen Gräfin Elisabeth von Nassau-Saarbrücken zugeschrieben werden und die in den 30. Jahren des 15. Jahrhunderts entstanden sind, stehen am Anfang einer langen Tradition von deutschen Prosaauflösungen und Prosaromanen. Die ungewöhnliche Entscheidung der Übersetzerin, die Versform in Prosa zu übertragen, die zwar in Deutschland und Frankreich bereits gebräuchlich war, jedoch vorwiegend auf religiöse und erbauliche Texte angewandt wurde, verleiht dem am Saarbrücker Hof entstandenen Zyklus, zu dem die Texte ‚Herzog Herpin‘, ‚Loher und Maller‘, ‚Königin Sibille‘ und ‚Huge Scheppel‘ gehören, eine herausragende Stellung in der deutschen Literaturgeschichte.
Jedoch ist zu betonen, dass die Übersetzerin den neuen Prosastil keineswegs realisiert hat und er für sie wohl niemals Selbstzweck im Sinne einer neuen, an eine sich entwickelnde Gesellschaft angepaßten, modernen Schreibweise war. Statt ihre Wahl zu kommentieren und sich um Legitimation zu bemühen, versucht sie im Gegenteil eine traditionelle Textgestalt beizubehalten, etwa durch das Einflechten von Höreranreden, die Beibehaltung der Laissengliederung und den Stereotypen, mit vielen Wiederholungen versehenen Ton der Versvorlagen. Für Elisabeth scheint die Prosaform nicht ausschlaggebend gewesen zu sein, sondern lediglich die beste und einfachste Methode diesen traditionellen französischen Stoff einem deutschen Publikum näher zu bringen. Bereits die ca. 20 Jahre später entstandenen, ebenfalls aus dem Französischen übersetzten Werke ‚Pontus und Sidonia‘ der Eleonore von Österreich und ‚Melusine‘ von Thürring von Ringoltingen sind stilistisch völlig anders gestaltet und realisieren die Prosaform als neue, den veränderten Gegebenheiten auf dem Literaturmarkt angepaßte Textform.
Inhaltsverzeichnis
- Die Prosaauflösungen der Elisabeth von Lothringen, Gräfin von Nassau-Saarbrücken
- Hug Schapler als moderner Held
- Entwicklung von der Handschrift zu den Versionen von 1500 und 1537
- Von der Handschrift zum Druck Straßburg 1500
- Neubearbeitung für den Druck Straßburg 1537
- Hugs zweifelhafte Abstammung
- Hug als Held und als Höfling
- Der Held als Einzelgänger
- Integration in die höfische Welt
- Moralische Ambivalenz
- Gewalt und Brutalität
- Ungehemmte Sexualität
- Verschwendungssucht und finanzielle Kurzsicht
- Vereinbarung von Hugs Charaktereigenschaften
- Hug Schapler als Soldat und Ritter
- Entwicklung des Charakters
- Jugendlicher Haudegen
- Geläuterter Höfling
- Weitsichtiger König
- Hug Schapler: Typus oder Individuum?
- Entwicklung von der Handschrift zu den Versionen von 1500 und 1537
- Exkurs: Roman vs. Epos in Prosa
- Elisabeths Bedeutung für den deutschen Prosaroman
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert den „Hug Schapler" der Elisabeth von Nassau-Saarbrücken als exemplarischen Prosaroman des späten Mittelalters. Sie untersucht die Entwicklung des Werks von der Handschrift zu den Druckversionen von 1500 und 1537 und beleuchtet die Darstellung des Protagonisten als „moderner Held“. Die Arbeit befasst sich mit der Ambivalenz des Charakters Hug Schapler, der trotz seiner Brutalität und moralischen Zweifel zum König aufsteigt, und analysiert, wie Elisabeths Werk den Übergang von der Epos- zur Romanform widerspiegelt.
- Die Prosaauflösungen der Elisabeth von Nassau-Saarbrücken im Kontext der deutschen Literaturgeschichte
- Die Entwicklung des Hug Schapler vom Epos in Prosa zum frühen Roman
- Die Ambivalenz des Helden und die Darstellung von Gewalt, Sexualität und moralischen Konflikten
- Elisabeths Bedeutung für die Entwicklung des deutschen Prosaromans
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Prosaauflösungen der Elisabeth von Nassau-Saarbrücken und ihren Stellenwert in der deutschen Literaturgeschichte. Das zweite Kapitel analysiert den Hug Schapler als „modernen Helden" und geht auf seine Entwicklung von der Handschrift zu den Druckversionen von 1500 und 1537 ein. Es untersucht die Ambivalenz des Charakters, seine moralischen Zweifel und seine Entwicklung vom Haudegen zum König. Das dritte Kapitel widmet sich dem Vergleich zwischen Roman und Epos in Prosa. Das vierte Kapitel beleuchtet Elisabeths Bedeutung für die Entwicklung des deutschen Prosaromans.
Schlüsselwörter
Prosaroman, Elisabeth von Nassau-Saarbrücken, Hug Schapler, Ambivalenz, Individualität, Mittelalter, Literaturgeschichte, Epos, Roman, Heldenfigur, Gewalt, Sexualität, Moral, Entwicklung, Druckversionen.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Elisabeth von Nassau-Saarbrücken?
Elisabeth war eine Gräfin im 15. Jahrhundert, die bedeutende französische Epen in deutsche Prosa übertrug und damit am Anfang der Tradition des deutschen Prosaromans steht.
Warum ist die Prosaform im 15. Jahrhundert so bedeutend?
Die Entscheidung, Verserzählungen in Prosa aufzulösen, markiert einen Wandel in der Literatur. Prosa wurde zur neuen, den veränderten Lesegewohnheiten angepassten Textform für den aufkommenden Buchmarkt.
Was macht Hug Schapler zu einem "modernen Helden"?
Im Gegensatz zu idealisierten Rittern ist Hug Schapler ein ambivalenter Charakter. Er zeigt Gewalt, ungehemmte Sexualität und finanzielle Schwächen, steigt aber dennoch durch Tüchtigkeit zum König auf.
Was bedeutet "moralische Ambivalenz" in diesem Roman?
Hug Schapler handelt oft brutal oder moralisch fragwürdig. Diese Vielschichtigkeit unterscheidet ihn vom typischen Helden des Epos und macht ihn zu einer individuelleren Romanfigur.
Welche Rolle spielt die Herkunft von Hug Schapler?
Seine zweifelhafte Abstammung ist ein zentrales Motiv. Der Roman thematisiert den Aufstieg eines Außenseiters in die höfische Welt und schließlich auf den Thron.
- Quote paper
- Andrea Soprek (Author), 2008, Ambivalenz und Individualität - Der Hug Schapler der Elisabeth von Nassau-Sarbrücken als moderner Held, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/161074