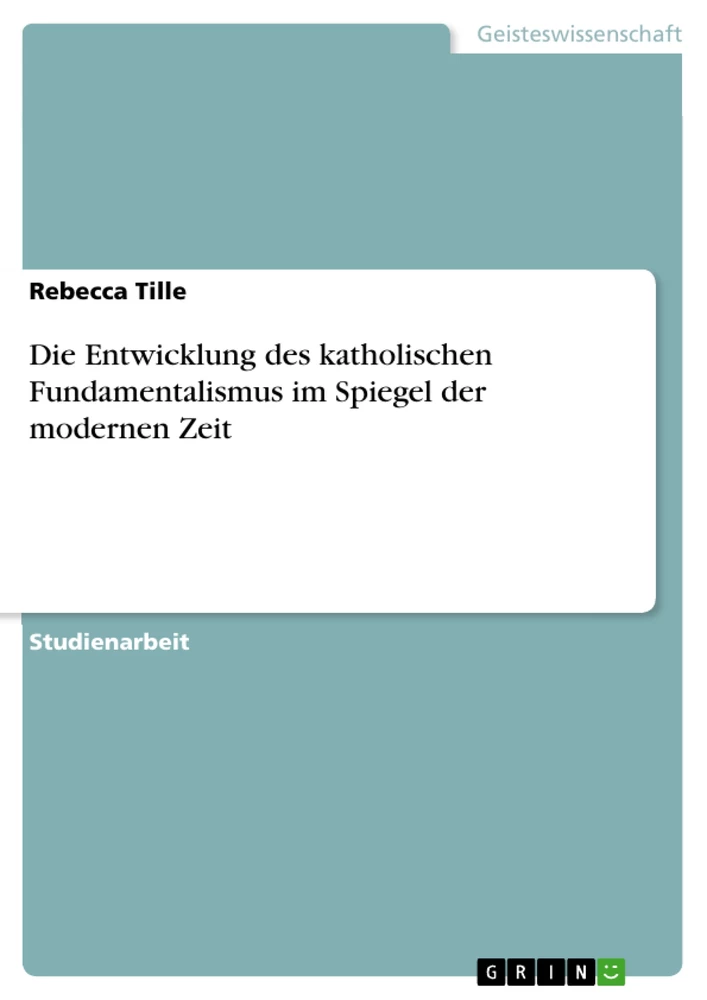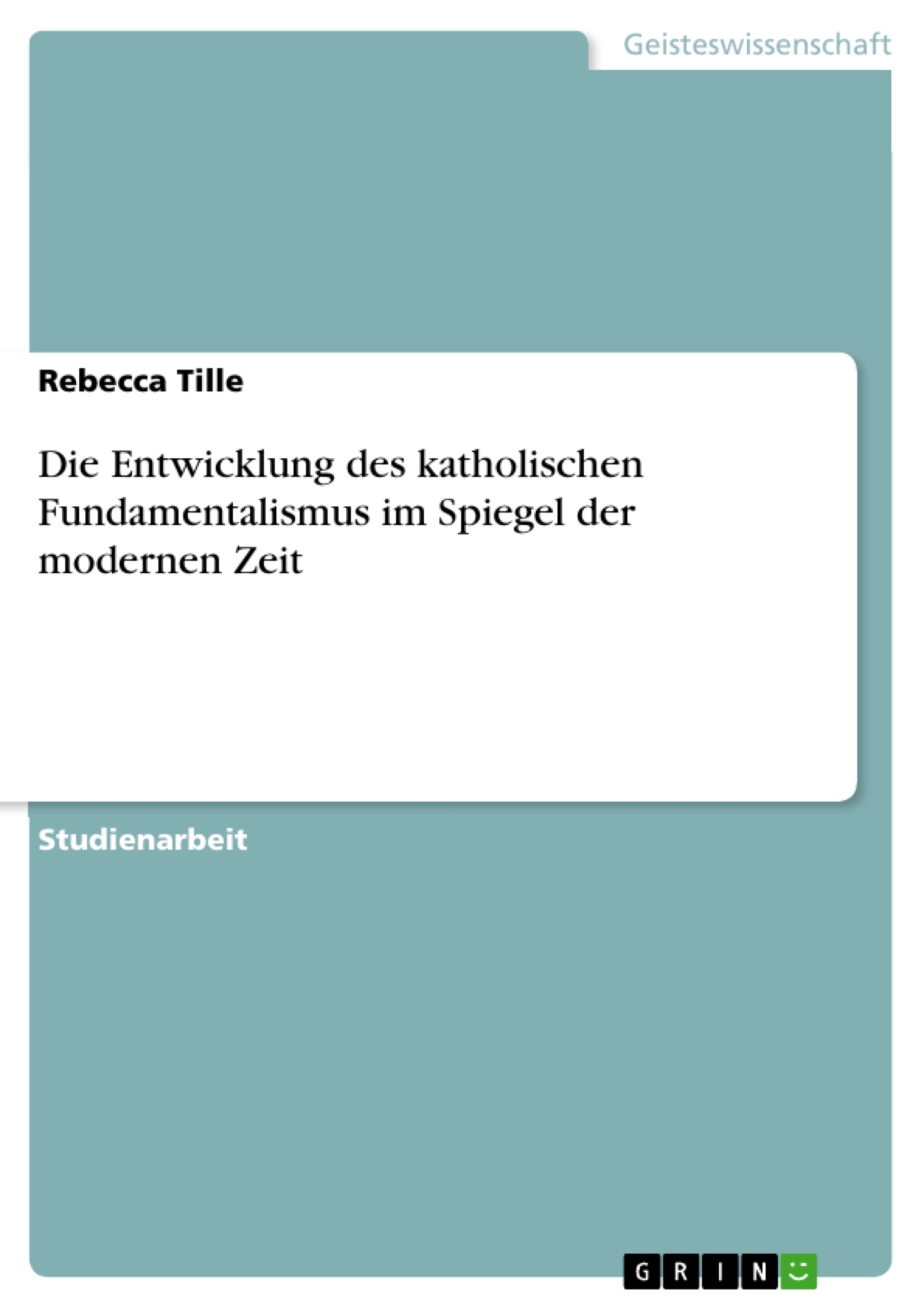„Wir leben in einer Welt der Kriege, der Gewalt, der Lügen, der persönlichen und sexuellen Unverantwortlichkeit. Es ist eine Welt, in der sich Menschen vor der Atombombe und dem Wahnsinn des Wettrüstens fürchten, und in der die einzigen Nachrichten schlechte Nachrichten zu sein scheinen.“ Allein der katholische Fundamentalismus scheint auf solche komplexen Fragen einfache Antworten zu liefern und sieht sich als „letzten Hort des wahren Glaubens im Kampf gegen eine sündhafte (moderne) Welt“ Seines Erachtens führt er einen kosmischen Kampf gegen das Böse – die Moderne.
In der vorliegenden Hausarbeit soll der katholische Fundamentalismus eine eingehende Betrachtung und Untersuchung erfahren. Dies hinsichtlich seiner Entwicklung und Merkmale und ausgehend von seinen historischen Wurzeln bis in das 21. Jahrhundert hinein. Des Weiteren soll seine Leitfigur Marcel Lefebvre in Anbetracht seines begründeten Traditionalismus und seiner Einflüsse vorgestellt werden. Neben Lebebvres Berufung auf die Tradition als solche, entwickelte er eine Erkenntnistheorie, welche die menschliche Vernunft rapide herabsetzt.
Es gibt einige Fragen, welche sich hinsichtlich dieser fundamentalistischen Strömung stellen, wie zum Beispiel: Worin liegt der Ursprung des katholischen Traditionalismus ? Welche Ziele verfolgen die katholischen Fundamentalisten im Einzelnen? Existieren in der heutigen Zeit noch solche Fundamentalisten und welchen Einfluss haben sie? Wie viele Untergruppen haben sich herausgebildet? All diese Fragestellungen sollen in der folgenden Arbeit eine Antwort erfahren und eine umfassende Darstellung des katholischen Fundamentalismus komplettieren.
Die Ausprägungen des katholischen Fundamentalismus in verschiedene Gruppierungen werden überblicksweise in einer kurzen Form dargestellt. Eine eingehende Betrachtung erfährt die sogenannte Piusbruderschaft sowie das Opus Dei.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Historie und Entwicklung des katholischen Fundamentalismus
- Marcel Lefebvres Traditionalismus
- Das moderne Bild des katholischen Fundamentalismus
- Gruppierungen und Ausprägungen des katholischen Fundamentalismus
- Priesterbruderschaft St. Pius X.
- Opus Dei
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert die Entwicklung und Merkmale des katholischen Fundamentalismus, beginnend mit seinen historischen Wurzeln bis ins 21. Jahrhundert. Im Zentrum steht die Leitfigur Marcel Lefebvre, dessen Traditionalismus und seine Einflüsse beleuchtet werden. Zudem werden die Ziele der katholischen Fundamentalisten und ihre verschiedenen Ausprägungen, insbesondere die Priesterbruderschaft St. Pius X. und Opus Dei, vorgestellt.
- Die Entstehung des katholischen Fundamentalismus im Kontext der Katholischen Restauration und des 1. Vatikanischen Konzils
- Der Traditionalismus von Marcel Lefebvre und seine Kritik an der Moderne
- Die Reaktion des katholischen Fundamentalismus auf das 2. Vatikanische Konzil
- Die wichtigsten Gruppierungen des katholischen Fundamentalismus
- Der Einfluss des katholischen Fundamentalismus auf die heutige Kirche
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den katholischen Fundamentalismus als Reaktion auf die moderne Welt dar und erläutert die Forschungsfragen der Hausarbeit. Das zweite Kapitel beleuchtet die Entstehung des katholischen Fundamentalismus im Kontext der Katholischen Restauration und des 1. Vatikanischen Konzils. Der Traditionalismus von Marcel Lefebvre und seine Kritik an der Moderne werden im dritten Kapitel behandelt. Das vierte Kapitel analysiert die Reaktion des katholischen Fundamentalismus auf das 2. Vatikanische Konzil. Abschließend stellt das fünfte Kapitel verschiedene Gruppierungen des katholischen Fundamentalismus vor.
Schlüsselwörter
Katholischer Fundamentalismus, Traditionalismus, Marcel Lefebvre, Katholische Restauration, 1. Vatikanisches Konzil, 2. Vatikanisches Konzil, Priesterbruderschaft St. Pius X., Opus Dei, Moderne, Religionsfreiheit, Ökumenismus, Toleranz.
Häufig gestellte Fragen
Was ist katholischer Fundamentalismus?
Er versteht sich als "letzter Hort des wahren Glaubens" und führt einen Kampf gegen die Moderne, die er als sündhaft und bedrohlich ablehnt.
Wer war Marcel Lefebvre?
Lefebvre war die Leitfigur des katholischen Traditionalismus, gründete die Piusbruderschaft und lehnte die Reformen des Zweiten Vatikanischen Konzils strikt ab.
Warum lehnen Fundamentalisten das 2. Vatikanische Konzil ab?
Sie kritisieren insbesondere die Einführung der Religionsfreiheit, den Ökumenismus und die Abkehr von der lateinischen Messe als Verrat an der Tradition.
Was ist die Priesterbruderschaft St. Pius X.?
Es ist eine traditionalistische Gruppierung, die von Lefebvre gegründet wurde, um den vorkonziliaren Ritus und die traditionelle katholische Lehre zu bewahren.
Welche Rolle spielt das Opus Dei in diesem Kontext?
Die Arbeit untersucht das Opus Dei als eine weitere einflussreiche, konservative Ausprägung innerhalb des Spektrums fundamentalistischer Strömungen in der Kirche.
- Quote paper
- Rebecca Tille (Author), 2010, Die Entwicklung des katholischen Fundamentalismus im Spiegel der modernen Zeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/161082