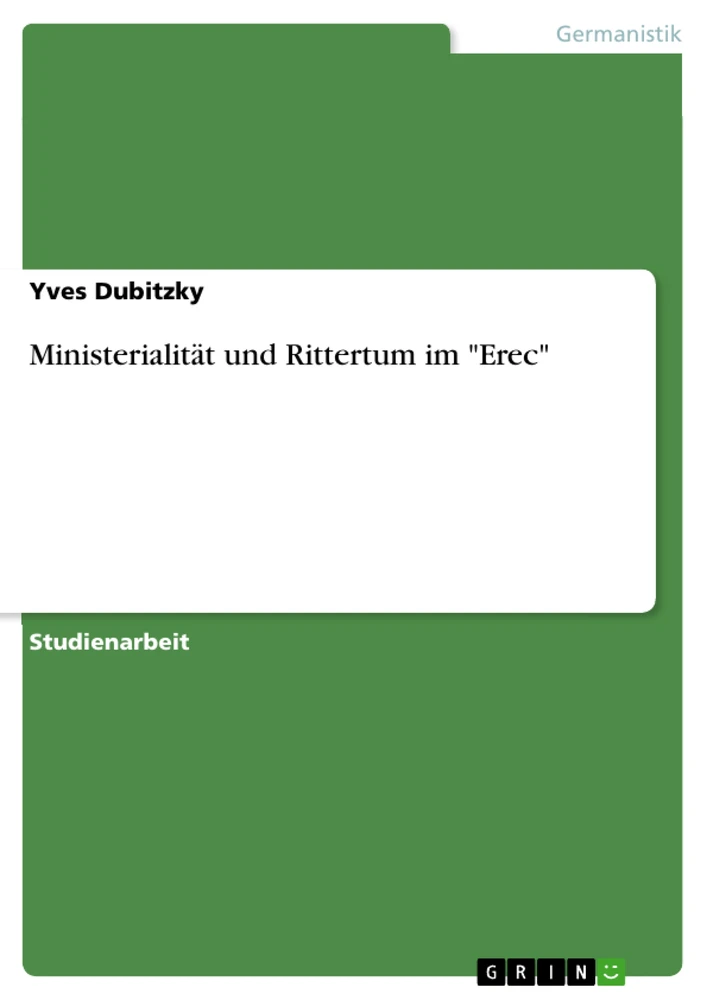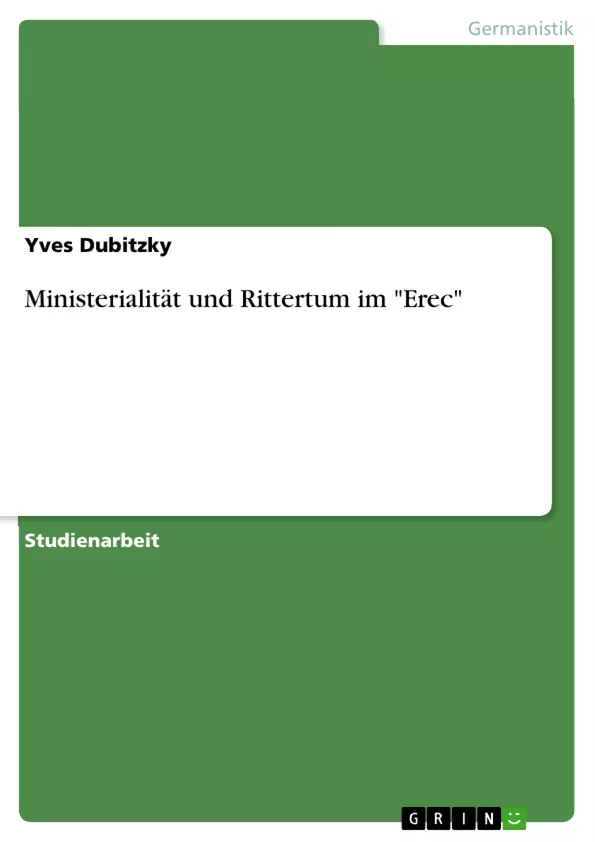Würde man heutzutage einen Katalog, bestehend aus deutschen Sprichwörtern und Redensarten, erstellen wollen, so kämen zweifelsohne Wendungen vor wie zum Beispiel: etwas im Schilde führen, für jemanden eine Lanze brechen oder jemanden in die Schranken weißen. Ihre Ursprünge sind im Mittelalter, speziell in Zeit der der Herausbildung des Rittertums zu suchen. Wie wohl kaum ein zweiter Begriff in der mediävistischen Literaturwissenschaft ist mit einem derartigen Zwiespalt zwischen dichterischem Mythos und sozialer Wirklichkeit versehen. Insofern scheint es wichtig zu erwähnen, dass wenn immer man sich diesem Thema zu nähern beabsichtigt, ein Spagat zwischen Literaturwissenschaft und mittelalterlicher Geschichtswissenschaft gelingen muss.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Dreiständelehre des Mittelalters
- Die Ministerialität in ihrer historischen Bedeutung
- Ritterideal und Wirklichkeit
- Turnierdarstellung als Ausdruck des Ritterideals
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die komplexe Beziehung zwischen Ministerialität und Rittertum im „Erec“ von Hartmann von Aue. Sie zielt darauf ab, die historische Entwicklung des Rittertums im Kontext der Dreiständelehre zu beleuchten und diese Erkenntnisse mit den literarischen Darstellungen des „Erec“ in Beziehung zu setzen.
- Die historische Entwicklung des Rittertums und der Ministerialität
- Die Rolle des Turniers als Ausdruck des Ritterideals
- Die literarische Darstellung des Rittertums in „Erec“
- Die mögliche Kritik des Adels in den Werken der deutschen Epiker
- Die Trennung von dichterischem Mythos und sozialer Wirklichkeit im Kontext des Rittertums
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die zentrale Frage der Arbeit vor: Wie verhält sich das Ritterideal, das in literarischen Werken wie dem „Erec“ dargestellt wird, zur sozialen Wirklichkeit des Mittelalters, insbesondere zur Ministerialität? Der Fokus liegt auf der historischen Entwicklung des Rittertums und der Notwendigkeit, zwischen literarischer Verklärung und historischer Realität zu unterscheiden.
Kapitel 2 beleuchtet die Dreiständelehre des Mittelalters, die die Gesellschaft in drei Stände einteilte: Klerus, Adel und Bauern. Diese Lehre bildet den historischen Hintergrund für die Untersuchung des Rittertums und der Ministerialität. Die problematische zeitliche Eingrenzung des Mittelalters wird ebenfalls angesprochen.
Kapitel 3 widmet sich der historischen Bedeutung der Ministerialität. Es geht um die Entstehung und Entwicklung dieser sozialen Schicht und ihre Rolle im mittelalterlichen Gesellschaftssystem. Die Abgrenzung zwischen Ministerialität und Rittertum wird diskutiert.
Kapitel 4 behandelt das Ritterideal und seine Beziehung zur Wirklichkeit. Es wird untersucht, inwiefern die romantisierenden Darstellungen des 19. Jahrhunderts die historische Sicht auf das Rittertum verzerrt haben. Die Frage nach der möglichen Kritik des Adels in den Werken der deutschen Epiker wird gestellt.
Kapitel 5 analysiert die Darstellung von Turnieren in Hartmanns „Erec“ als Ausdruck des Ritterideals. Die Frage, ob die Werke der Epiker eine soziale Reflexion der Lebensverhältnisse am Hofe widerspiegeln, wird aufgeworfen.
Schlüsselwörter
Rittertum, Ministerialität, Dreiständelehre, Mittelalter, "Erec", Hartmann von Aue, Turnier, Dichtung, Wirklichkeit, Literaturwissenschaft, Geschichtswissenschaft, Ideal, soziales System, Kritik.
Häufig gestellte Fragen
Was war die Ministerialität im Mittelalter?
Ministerialen waren ursprünglich unfreie Dienstleute des Adels, die durch militärische und administrative Aufgaben in den Ritterstand aufstiegen und eine wichtige soziale Schicht bildeten.
Worum geht es in Hartmann von Aues „Erec“?
Der „Erec“ ist ein Artusroman, der die Entwicklung eines Ritters zwischen seinen ehelichen Pflichten und seinem ritterlichen Ehre-Anspruch (Aventiure) thematisiert.
Wie wird das Ritterideal im „Erec“ dargestellt?
Das Ideal wird vor allem durch Turniere und Kämpfe (Aventiure) vermittelt, die Mut, Geschicklichkeit und die Einhaltung höfischer Tugenden erfordern.
Was ist die Dreiständelehre?
Ein mittelalterliches Gesellschaftsmodell, das die Menschen in drei Gruppen einteilte: Lehrstand (Klerus), Wehrstand (Adel/Ritter) und Nährstand (Bauern/Handwerker).
Entspricht das literarische Ritterbild der sozialen Wirklichkeit?
Die Arbeit zeigt einen Zwiespalt zwischen dem dichterischen Mythos des edlen Ritters und der oft harten sozialen Realität der Ministerialität auf.
- Quote paper
- Yves Dubitzky (Author), 2004, Ministerialität und Rittertum im "Erec", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/161089